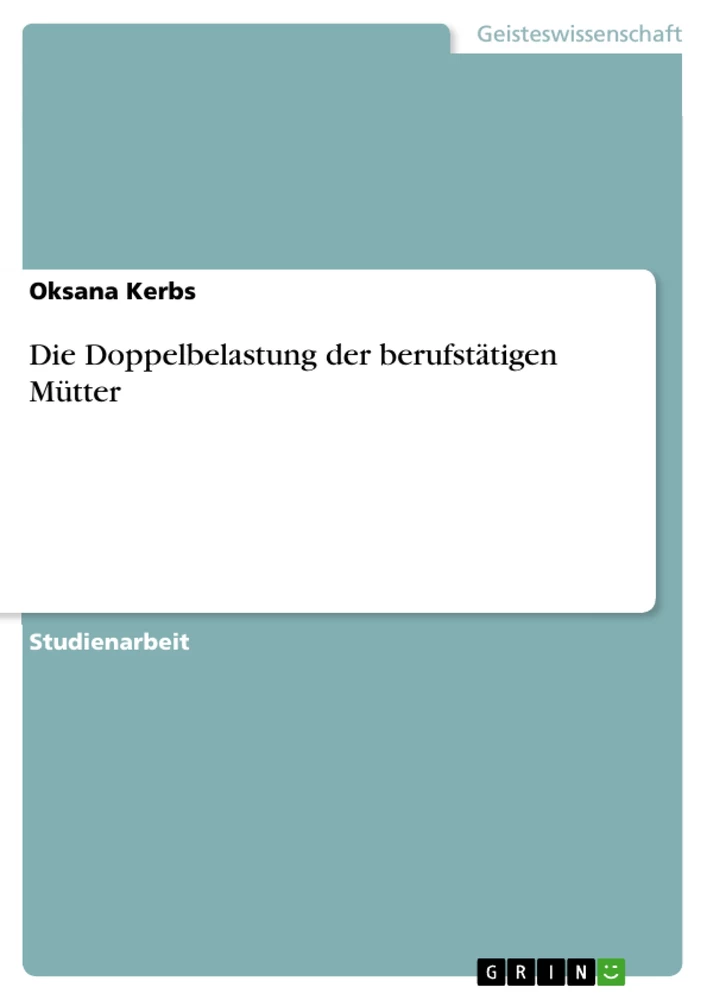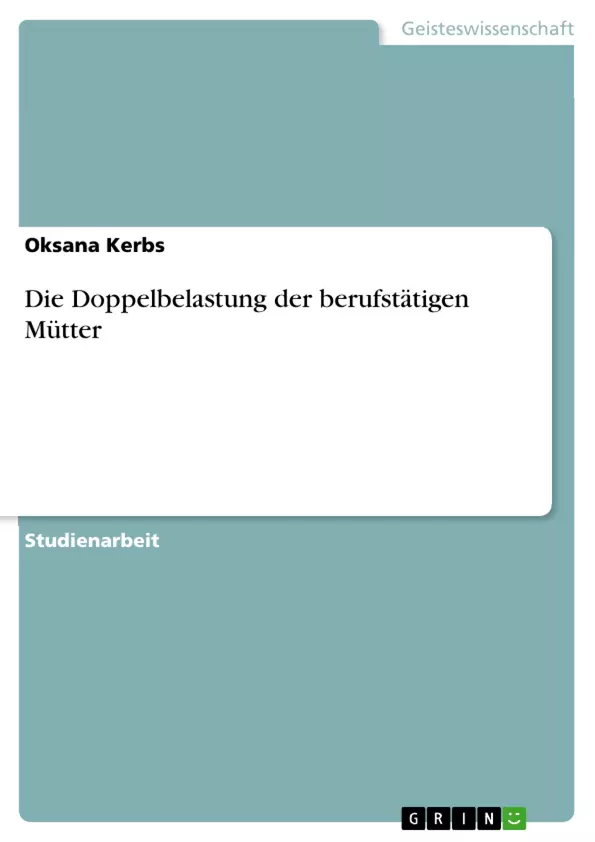Einleitung
Immer mehr rückt die Familie in den Blickpunkt der Öffentlichkeit, wobei jedoch oft maßgebliche Funktionsbedingungen, Strukturmerkmale und Leistungsfähigkeiten des Intimsystems Familie, welche die Erweiterung des Funktionssystems Ehe durch Kinder ist, als fragwürdig und veränderungsbedürftig angesehen werden. Im Zentrum dieser Diskussion steht dabei oftmals die Frage nach der Rollenverteilung innerhalb der Familie, denn die, in vielen Haushalten bestehende, Differenz in der Verteilung von Haus- und Erwerbstätigkeit zwischen den Geschlechtern führt zu einer Doppelbelastung der Frau.
So möchte auch die vorliegende Hausarbeit unter anderem diese Diskussion aufgreifen und sich in erster Linie auf die Doppelorientierung der erwerbstätigen Mutter und Hausfrau beziehen. Es soll gezeigt werden, dass diese doppelte Orientierung zwischen Haus- und Erwerbstätigkeit einen enormen Aufwand und eine extreme Belastung für die Frau darstellt. Die Familienarbeit hat sowohl in der Planung innerhalb der Familie als auch in der Beurteilung durch die Gesellschaft große Beachtung verdient, welche ihr jedoch heutzutage immer noch nicht bzw. kaum gewährt wird. Kindererziehung und Hausarbeit gelten auch heute immer noch nicht als ökonomische Tätigkeiten. So hat auch der deutsche Nationalökonom Friedrich List bereits über 150 Jahren eine wichtige Bemerkung gemacht, die nach Meinung der Professorin für Philosophie Angelika Krebs auch heute noch unverändert fortbestehe:
„Wer Schweine erzieht ist ein produktives, wer Menschen erzieht, ein unproduktives Mitglied der Gesellschaft“.
Die vorliegende Hausarbeit möchte versuchen, die sozialethische Frage nach dem Guten und Gerechten in diesem Zusammenhang zu bearbeiten und zu werten: Ist es gerecht, dass Familienarbeit nicht entlohnt wird? Kann die gesellschaftliche Zuweisung der Familientätigkeiten an Frauen eine gute oder auch nur eine akzeptable Sache sein?
Es soll noch erwähnt werden, dass sich die vorliegende Hausarbeit auf die erwerbstätigen Mütter in der Bundesrepublik Deutschland bezieht. Ein Vergleich mit den EU-Staaten würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Familienarbeit
- Funktion von Familie
- Alles Frauensache?
- Erwartungen an Kinder
- Erwerbsarbeit
- Die zeitliche Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Soziale Rollen
- Die Rolle der Frau in der Familie
- Gesellschaftliche Zuweisung (der Familientätigkeit)
- Die stärkere Integration von Männern in die Familienarbeit
- Werden Familien- und Erwerbsarbeit in unserer Gesellschaft gerecht bewertet?
- Die ökonomische, symbolische und soziale Formen der Anerkennung
- Der Mangel an Anerkennung für Familienarbeit
- Herausforderungen an eine gerechtere Familienpolitik
- Das ethische Dreick
- Resümee
- Abkürzungsverzeichnis
- Anhang
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Doppelbelastung berufstätiger Mütter in der Bundesrepublik Deutschland. Sie analysiert die ungleiche Verteilung von Familien- und Erwerbsarbeit zwischen den Geschlechtern und untersucht die Folgen dieser Ungleichheit für die Frauen. Die Arbeit beleuchtet die gesellschaftliche und ethische Dimension der Familienarbeit und hinterfragt die mangelnde Anerkennung und Wertschätzung dieser Arbeit.
- Die Funktion der Familie in der Gesellschaft
- Die ungleiche Verteilung von Familienarbeit zwischen den Geschlechtern
- Die Folgen der Doppelbelastung für berufstätige Mütter
- Die gesellschaftliche und ethische Bewertung von Familienarbeit
- Herausforderungen an eine gerechtere Familienpolitik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik der Doppelbelastung berufstätiger Mütter in den Kontext der gesellschaftlichen Diskussion über die Familie und die Rollenverteilung innerhalb der Familie. Sie führt den Leser in die Thematik ein und erläutert die Zielsetzung der Hausarbeit.
Das Kapitel "Familienarbeit" definiert den Begriff der Familienarbeit und beleuchtet die verschiedenen Aufgaben und Funktionen der Familie in der Gesellschaft. Es wird die traditionelle Rollenverteilung zwischen Mann und Frau in der Familie kritisch betrachtet und die Folgen für die Frauen aufgezeigt.
Das Kapitel "Erwerbsarbeit" befasst sich mit der Situation der berufstätigen Mütter und den Herausforderungen, die sich aus der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ergeben. Es werden die rechtlichen Rahmenbedingungen für eine gerechtere Arbeitsteilung im familiären Bereich beleuchtet.
Das Kapitel "Die zeitliche Vereinbarkeit von Familie und Beruf" analysiert die Schwierigkeiten, die sich für berufstätige Mütter aus der zeitlichen Organisation von Familien- und Erwerbsarbeit ergeben. Es werden verschiedene Modelle der Vereinbarkeit von Familie und Beruf vorgestellt und diskutiert.
Das Kapitel "Soziale Rollen" befasst sich mit der gesellschaftlichen Konstruktion von Geschlechterrollen und den Auswirkungen auf die Verteilung von Familien- und Erwerbsarbeit. Es werden die Stereotypen und Vorurteile gegenüber Frauen in der Familie und im Beruf beleuchtet.
Das Kapitel "Die Rolle der Frau in der Familie" untersucht die traditionelle Rolle der Frau in der Familie und die Folgen dieser Rolle für die Frauen. Es werden die Herausforderungen für Frauen in der heutigen Gesellschaft diskutiert, die sich aus der traditionellen Rollenverteilung ergeben.
Das Kapitel "Gesellschaftliche Zuweisung (der Familientätigkeit)" analysiert die gesellschaftliche Zuweisung von Familienarbeit an Frauen und die Folgen dieser Zuweisung für die Frauen. Es werden die Ursachen für die ungleiche Verteilung von Familienarbeit zwischen den Geschlechtern untersucht.
Das Kapitel "Die stärkere Integration von Männern in die Familienarbeit" befasst sich mit der Notwendigkeit einer stärkeren Integration von Männern in die Familienarbeit. Es werden verschiedene Ansätze und Modelle für eine gerechtere Verteilung von Familienarbeit zwischen den Geschlechtern vorgestellt.
Das Kapitel "Werden Familien- und Erwerbsarbeit in unserer Gesellschaft gerecht bewertet?" untersucht die Frage, ob Familien- und Erwerbsarbeit in unserer Gesellschaft gerecht bewertet werden. Es werden die ökonomische, symbolische und soziale Formen der Anerkennung von Familienarbeit beleuchtet.
Das Kapitel "Herausforderungen an eine gerechtere Familienpolitik" befasst sich mit den Herausforderungen an eine gerechtere Familienpolitik. Es werden verschiedene politische Maßnahmen und Strategien vorgestellt, die zur Förderung einer gerechteren Verteilung von Familienarbeit zwischen den Geschlechtern beitragen können.
Das Kapitel "Das ethische Dreick" analysiert die ethische Dimension der Familienarbeit und die Frage, ob es gerecht ist, dass Familienarbeit nicht entlohnt wird.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Doppelbelastung, Familienarbeit, Erwerbsarbeit, Geschlechterrollen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, gesellschaftliche Anerkennung, Familienpolitik, ethische Bewertung und Gerechtigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter der Doppelbelastung berufstätiger Mütter?
Es beschreibt die gleichzeitige Verantwortung für Erwerbsarbeit und die unbezahlte Familienarbeit (Haushalt, Kindererziehung), die oft ungleich verteilt ist.
Warum wird Familienarbeit oft gesellschaftlich geringgeschätzt?
Da sie nicht als ökonomische Tätigkeit gilt und kein direktes Einkommen generiert, fehlt ihr oft die symbolische und materielle Anerkennung im Vergleich zur Erwerbsarbeit.
Welche Folgen hat die ungleiche Rollenverteilung?
Frauen haben oft weniger Zeit für Erholung und Karriere, sind einem höheren Stressrisiko ausgesetzt und erleiden häufiger finanzielle Nachteile (Gender Pension Gap).
Ist es gerecht, dass Familienarbeit nicht entlohnt wird?
Sozialethische Diskussionen hinterfragen, ob die Zuweisung dieser Aufgaben an Frauen gerecht ist und ob staatliche Transferleistungen (z.B. Elterngeld) eine ausreichende Kompensation darstellen.
Wie kann eine gerechtere Familienpolitik aussehen?
Maßnahmen sind der Ausbau der Kinderbetreuung, Anreize für Väter, mehr Familienarbeit zu übernehmen, und eine bessere steuerliche sowie rentenrechtliche Anerkennung von Erziehungszeiten.
- Quote paper
- Oksana Kerbs (Author), 2008, Die Doppelbelastung der berufstätigen Mütter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/152460