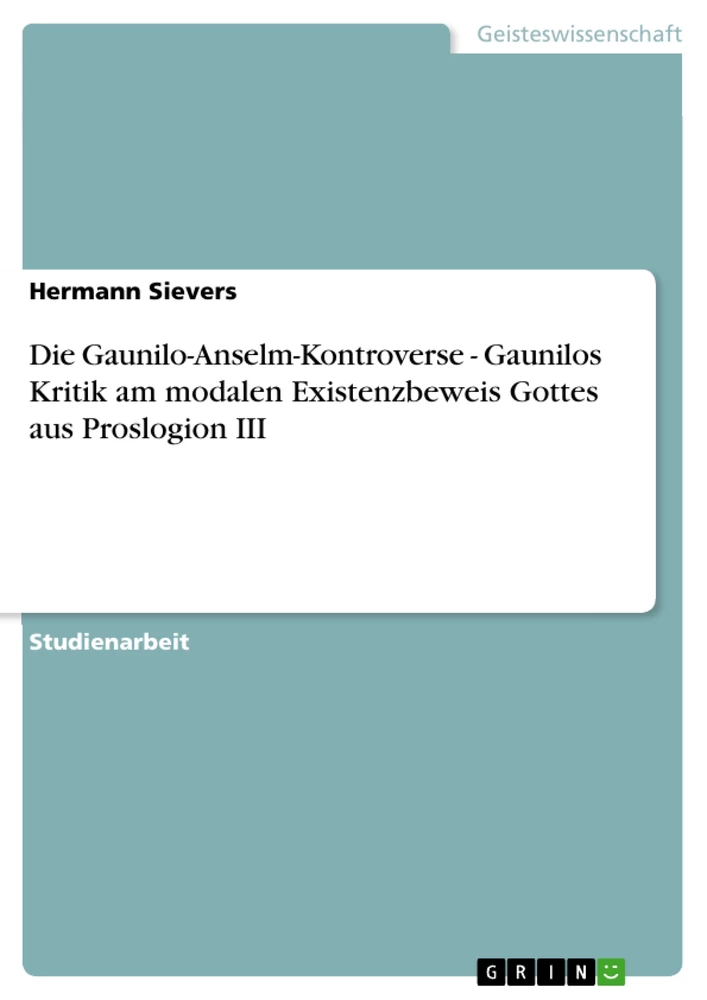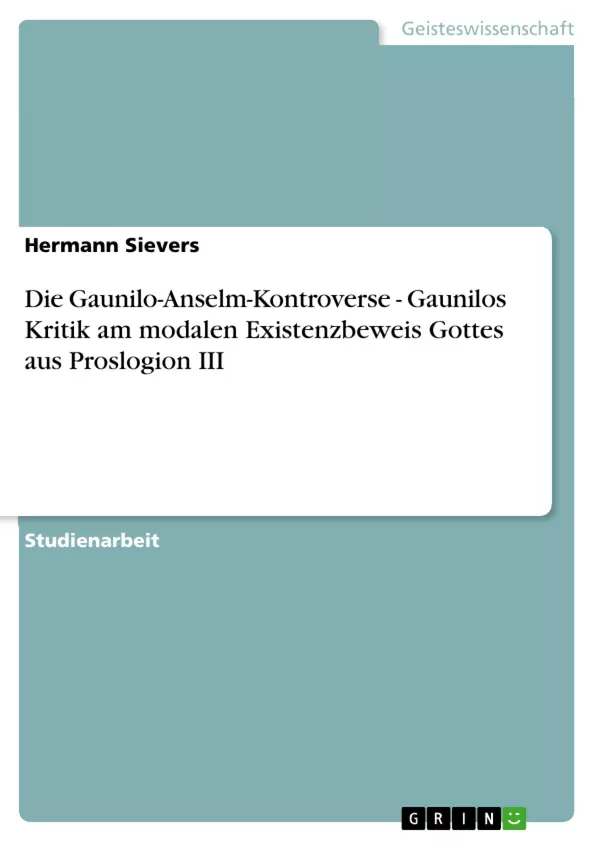Anselm von Canterbury legte im 2. und 3. Kapitel seines Werkes "Proslogion" (abgekürzt P), das vermutlich in den Jahren 1077/78 verfasst wurde, einen Beweis für die Existenz Gottes vor.
Anselm sprach in seinem Namen und in dem seiner benediktinischen Glaubensbrüder Gott als dasjenige an, von dem nichts Größeres gedacht werden kann.
Während er im PII die Existenz-in-Wirklichkeit von demjenigen, von dem nichts Größeres gedacht werden kann nachweist, zielt sein Beweis aus PIII darauf ab zu zeigen, dass es nicht einmal denkbar ist, dass dasjenige von dem nichts Größeres gedacht werden kann nicht in Wirklichkeit existiert. Beide Beweise gelten jeweils als ontologischer Gottesbeweis - Der Beweis aus Proslogion III wird zudem als modaler Gottesbeweis angesprochen.
Anselms frühester Kritiker war der Mönch Gaunilo von Marmoutiers.
Dieser unterzog in seiner Schrift "Quid ad haec respondeat quidam pro insipiente" (=Was jemand anstelle des Toren hierauf erwidern könnte; abgekürzt LPI) die Beweise aus PII und PIII einer eingehenden Untersuchung. Sein Ziel war es nicht, die Gottesbeweise Anselms zu entkräften, wohlmöglich sogar, um die Nicht-Existenz Gottes zu postulieren, sondern es ging Gaunilo um die Formulierung einer konstruktiven Kritik, auf dessen Basis eine stärkere Begründung der ontologischen Gottesbeweise möglich wäre.
Die vorliegende Arbeit setzt sich mit der Kritik Gaunilos am modalisierten Gottesbeweis Anselms auseinander.
Das Hauptziel ist es, ein fundiertes Verständnis seiner Kritik zu gewinnen. Handelt es sich hierbei um
eine destruktive oder um eine konstruktive Kritik? Zweifelt er die Undenkbarkeit der Nicht-Existenz
Gottes an oder (lediglich) die Beweisführung Anselms? Legen Gaunilo und Anselm hinsichtlich der
Begriffe „Undenkbarkeit“ und „Unverstehbarkeit“ dieselben Bedeutungen zugrunde oder nicht – sprich:
reden sie im schlimmsten Fall aneinander vorbei?
Zur Klärung dieser Fragen ist es unerlässlich die kritischen Überlegungen Gaunilos hinsichtlich PIII
richtig erfassen zu können. Zu diesem Zweck wird eine Rekonstruktion der argumentativen Passagen
aus LPI [7] erstellt.
Darüber hinaus soll eine Antwort auf die Frage gegeben werden, warum Gaunilo in LPI [7] einen
sogenannten Sprecherwechsel vollzieht. Dieser hat u. a. J. SCHERB dazu veranlasst, von der
Standarteinteilung des LPI durch F. S. SCHMIDT abzuweichen und den siebenten Abschnitt in zwei
eigenständige Kapitel zu unterteilen.
Inhaltsverzeichnis
- Die Anselm-Gaunilo-Kontroverse
- Zielsetzung und Aufbau dieser Arbeit – Die Interpretationsfragen
- Interpretation des Liber pro insipiente [7]
- Präliminarien
- Die Textgrundlage
- Die Kritik des Toren am modalisierten Existenzbeweis
- Rekonstruktion der Gaunilo-Kritik am modalisierten Existenzbeweis
- Zusammenfassung der Ergebnisse der Rekonstruktion
- Anselms Erwiderung auf die Kritik Gaunilos in Responsio [4]
- Beantwortung der Interpretationsfragen
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit Gaunilos Kritik am modalisierten Gottesbeweis Anselms, wie er im Liber pro insipiente (LPI) [7] formuliert wird. Das Hauptziel ist es, ein tiefes Verständnis von Gaunilos Kritik zu entwickeln und zu analysieren, ob es sich um eine destruktive oder konstruktive Kritik handelt. Außerdem wird untersucht, ob Gaunilo die Undenkbarkeit der Nicht-Existenz Gottes in Frage stellt oder lediglich Anselms Beweisführung. Schließlich soll geklärt werden, ob Gaunilo und Anselm hinsichtlich der Begriffe „Undenkbarkeit“ und „Unverstehbarkeit“ die gleichen Bedeutungen zugrunde legen oder nicht.
- Rekonstruktion der Gaunilo-Kritik am modalisierten Gottesbeweis
- Analyse der Unterschiedlichen Interpretationen der Begriffe "Undenkbarkeit" und "Unverstehbarkeit" bei Gaunilo und Anselm
- Untersuchung der Rolle des "Sprecherwechsels" in Gaunilos Argumentation
- Bewertung der Bedeutung der Kritik Gaunilos für Anselms Beweisführung
- Beurteilung der Wirksamkeit von Anselms Antwort auf Gaunilos Kritik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Anselm-Gaunilo-Kontroverse, die sich aus Anselms Proslogion (P) und Gaunilos Kritik in LPI [7] entwickelt. Anschließend wird die Zielsetzung und der Aufbau der Arbeit vorgestellt, wobei die zentralen Interpretationsfragen definiert werden.
Im nächsten Abschnitt wird die Interpretation von LPI [7] mit vorbereitenden Hinweisen zum Vorgehen eingeleitet. Es werden die Textgrundlage, die Kritik des Toren am modalisierten Gottesbeweis sowie die Rekonstruktion der Gauniloschen Kritik analysiert. Abschließend wird Anselms Erwiderung in Responsio (R) [4] untersucht.
Die Arbeit endet mit der Beantwortung der Interpretationsfragen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Begriffen der Anselm-Gaunilo-Kontroverse, darunter der Gottesbeweis, das "famose Objekt", "Undenkbarkeit", "Unverstehbarkeit" und der "Sprecherwechsel". Die Arbeit analysiert die Argumente der beiden Philosophen und untersucht die Interpretationsprobleme, die aus dem LPI [7] und der R [4] resultieren.
- Citation du texte
- Hermann Sievers (Auteur), 2009, Die Gaunilo-Anselm-Kontroverse - Gaunilos Kritik am modalen Existenzbeweis Gottes aus Proslogion III, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/153374