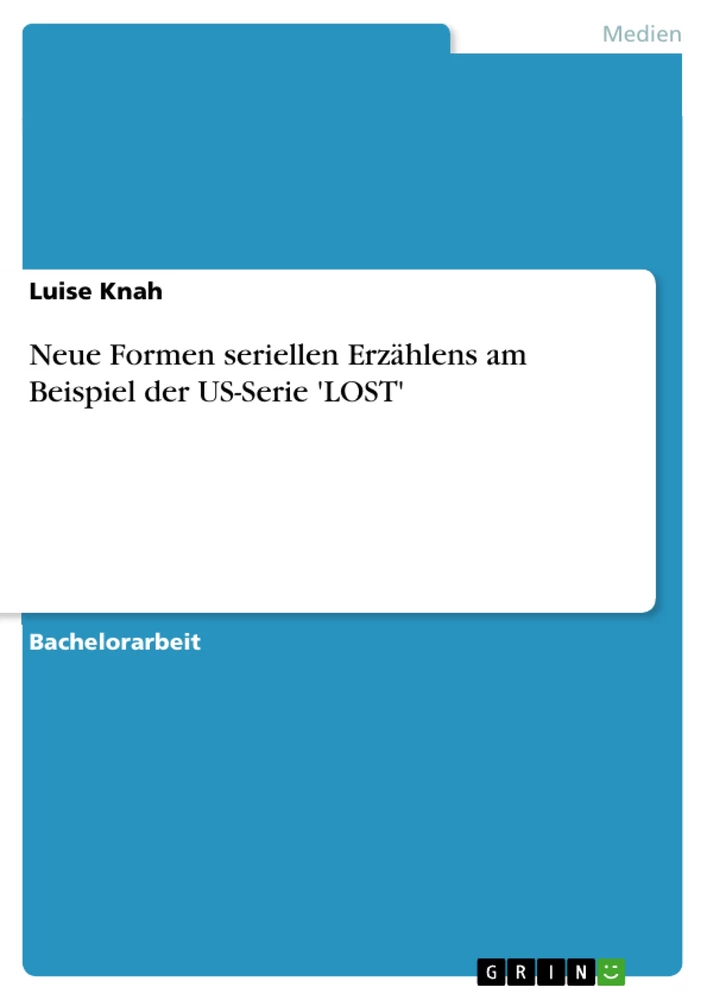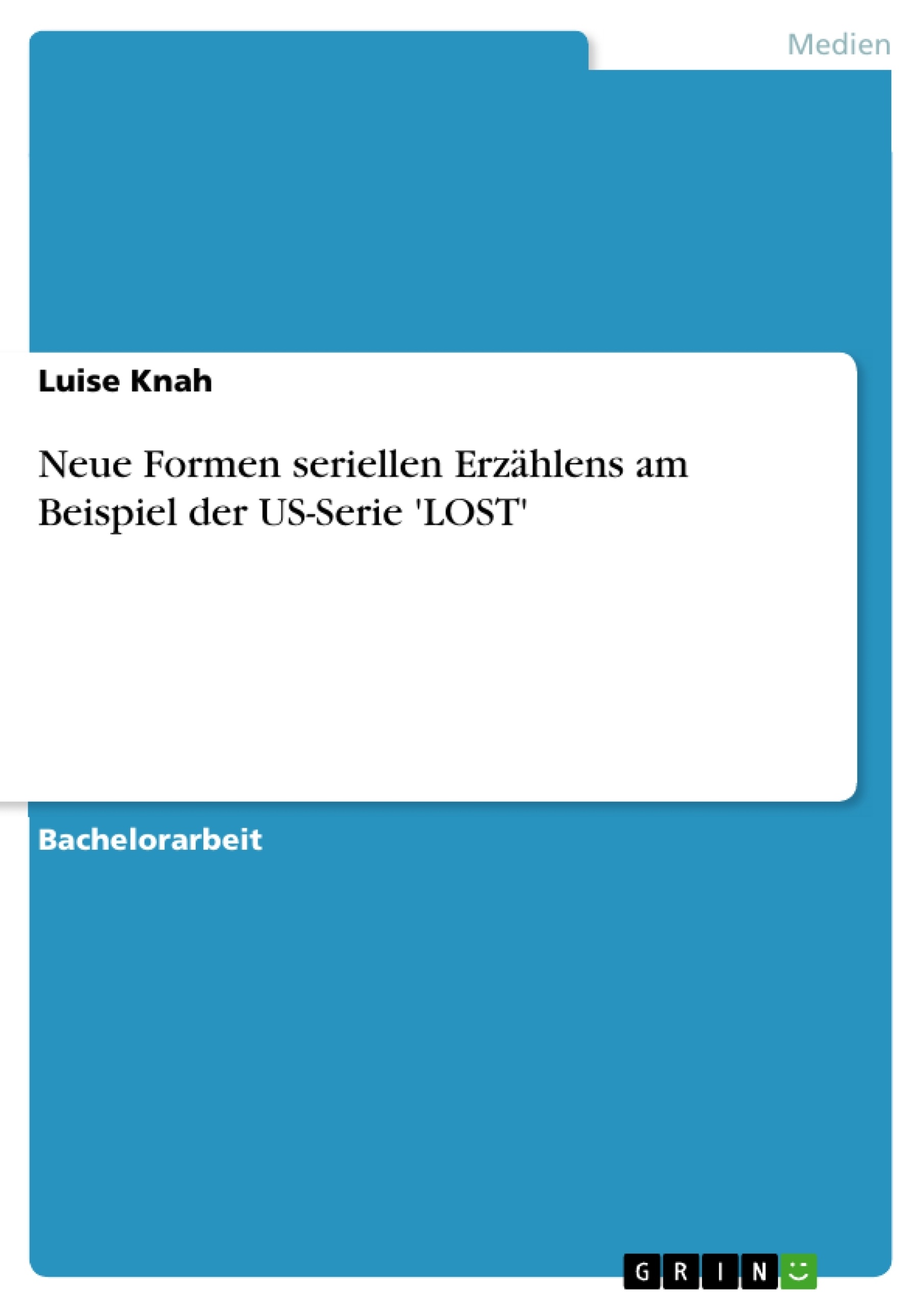Fernsehserien nehmen einen großen Teil der deutschen Fernsehlandschaft ein. Besonders
Formate älteren Produktionsdatums stehen hierbei in der Kritik, „nebenbei“ konsumierbar
zu sein und für den Zuschauer eine vereinfachte Variante der Realität wiederzugeben.1
Anlass für die Relevanz einer Überdenkung der alten Thesen gibt ein neuer Trend in
neueren amerikanischen Publikationen, der einen Kontrapunkt zu den starren
Serienkonventionen und (Genre-) Abgrenzungen der 90er Jahre setzt, welche besonders
häufig in deutscher Forschungsliteratur definiert wird (z.B. Schneider, Giesenfeld). Jenkins
und Mittell sprechen hier von einer neuen Komplexität in der Seriennarration und einer
Kulturkonvergenz verschiedener Medien. Kristin Thompson schlägt für die
Kategorisierung neuerer Serienformen sogar den Begriff „art television“ vor, um der
Adaptierung cineastischer Werte in die Fernsehform gerecht zu werden.2
„A new form of entertainment television has emerged over the past two decades to both
critical and popular acclaim. This model of television storytelling is distinct for its use
of narrative complexity as an alternative to the conventional episodic and serial forms
that we have typified most American television since its inception.”3
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit diesem Phänomen des Wandels narrativer
Formen in der amerikanischen Fernsehserie am Beispiel der Serie Lost4. Es soll diskutiert
werden, ob diese Serie als Vertreter neuer narrativer Serienmodelle gehandelt werden kann
und eine Definition dieser Modelle formuliert werden. Das Problemfeld wird durch eine
kurze Einführung in die existierende Terminologie und Serienklassifizierung eröffnet. Aus
Übersichtsgründen wird auf eine selbstständige Analyse verzichtet und lediglich mit
bestehenden Definitionen gearbeitet. An dieser Stelle schließt sich ein Exkurs über die
Qualitätsdebatte bei alten Serienformaten an.[...]
==
1 Vgl.: Prugger, Prisca: Wiederholung, Variation, Alltagnähe, S. 97.
2 Vgl. Thompson, Kristin. Zitiert nach: Mittell, Jason: Narrative Complexity in Contemporary American
Television, S. 28.
3 Mittell, Jason: Narrative Complexity in Contemporary American Television, S. 28.
4 Abrams, Jeffrey Jacob (u.A.): Lost.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der alte Serienbegriff
- Terminologie Serial/Series
- Qualitätsdebatte bei traditionellen Serien
- Lost als Beispiel neuartigem seriellen Erzählens
- Hintergründe
- Inhalt und Gerneverordnung
- Charaktere und narrative Vielschichtigkeit
- Inhaltliche Konfliktnarration
- Der innere Kampf mit der Vergangenheit – Figur vs. Figur
- Der äußere Kampf der Positionierung – Figur vs. Gruppe
- Der Kampf gegen die äußeren Einflüsse – Gruppe vs. Insel
- Analyse der Erzählstruktur
- Zuschauerwahrnehmung und Spannung
- Entstehung einer neuen seriellen Form
- Historische Transformation
- Strukturelle Definition
- Inhaltliche Elemente
- Ästhetische Mittel
- Rezeption und Verarbeitung eines Multitextes
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Wandel narrativer Formen in der amerikanischen Fernsehserie am Beispiel von "Lost". Sie befasst sich mit der Frage, ob die Serie als Vertreter eines neuen narrativen Serienmodells gilt und welche Definition für diese Modelle formuliert werden kann.
- Die Entwicklung neuer narrativer Serienmodelle
- Analyse der Serie "Lost" als Beispiel für diese neuen Modelle
- Die Rezeption und Verarbeitung der Serie durch das Publikum
- Die Bedeutung von "Lost" für die Transformation der zeitgenössischen Serienwelt
- Verknüpfung bestehender Theorie mit neuen Positionen zur Serienanalyse
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit führt in die Thematik des Wandels in der Serienlandschaft ein und stellt die Relevanz der Untersuchung von "Lost" als Beispiel für neue narrative Formen heraus.
- Der alte Serienbegriff: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der etablierten Terminologie und Klassifizierung von Serien, insbesondere dem Unterschied zwischen "Series" und "Serial". Es werden auch die Kritikpunkte an traditionellen Serienformaten im Bezug auf Originalität und Zuschauerbindung beleuchtet.
- Lost als Beispiel neuartigem seriellen Erzählens: Dieses Kapitel analysiert "Lost" auf verschiedene narrative Elemente wie Genre, Charaktere, Konflikte und Erzählstruktur.
- Entstehung einer neuen seriellen Form: Aufbauend auf der Analyse von "Lost" werden neuere Entwicklungen in der Serienlandschaft untersucht, inklusive historischer Einordnung, struktureller Definition und inhaltlicher und ästhetischer Elemente.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Serienanalyse, narrative Komplexität, Fernsehserien, "Lost", "art television", "Serial", "Series", Rezeption, Transformation, Zuschauerbindung, Inhaltsanalyse, Konfliktnarration, Erzählstruktur.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Besondere an der Erzählstruktur von „Lost“?
„Lost“ gilt als Paradebeispiel für „narrative Komplexität“. Die Serie nutzt cineastische Mittel, vielschichtige Charaktere und eine nicht-lineare Erzählweise, die über traditionelle Serienkonventionen hinausgeht.
Was versteht man unter dem Begriff „art television“?
Kristin Thompson nutzt diesen Begriff für Serien, die cineastische Werte und komplexe Narrationen adaptieren, um sich von der „nebenbei“ konsumierbaren Standard-Fernsehunterhaltung abzuheben.
Wie unterscheidet sich „Serial“ von „Series“?
Ein „Serial“ erzählt eine fortlaufende Geschichte über viele Episoden hinweg, während eine klassische „Series“ meist abgeschlossene Folgen pro Episode hat. „Lost“ verbindet beide Elemente zu einer neuen Form.
Welche Rolle spielt die Zuschauerbindung bei komplexen Serien?
Die narrative Vielschichtigkeit und die Rätsel (wie die Insel in Lost) fordern eine aktive Rezeption des Publikums, was zu einer tieferen emotionalen Bindung und intensiven Verarbeitung führt.
Welche Konflikte werden in „Lost“ narrativ verarbeitet?
Die Arbeit analysiert drei Ebenen: den inneren Kampf der Figuren mit ihrer Vergangenheit, den Kampf um die Positionierung innerhalb der Gruppe und den Kampf der Gruppe gegen die äußeren Einflüsse der Insel.
- Arbeit zitieren
- Luise Knah (Autor:in), 2010, Neue Formen seriellen Erzählens am Beispiel der US-Serie 'LOST', München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/153700