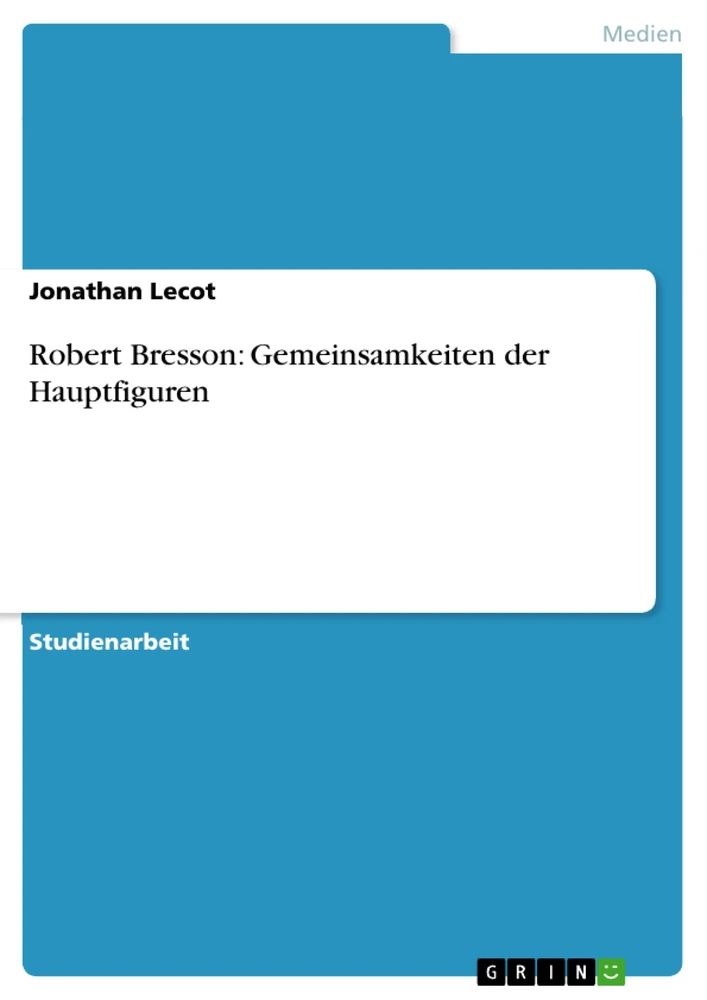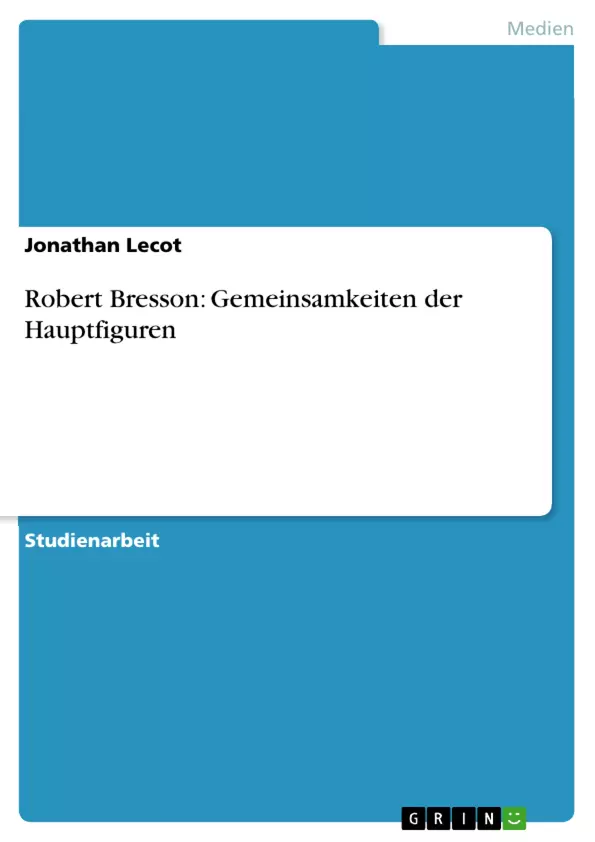„Die Schönheit von Robert Bressons Filmen ist eine der reinen Informationen. Es scheint, dass kein anderer Filmemacher jemals - so leidenschaftlich - eine so direkte Kommunikation mit dem Betrachter (gemeint ist hier ein Verhältnis der Gleichheit, nicht das einer Unterordnung, wie etwa bei Hitchcock) gesucht hat. Jacques Rivette
Robert Bresson (*25. September 1901 in Bromont-Lamothe; † 18. Dezember 1999 in Paris) war einer der größten Filmregisseure des 20. Jahrhunderts. In den dreißiger Jahren beschäftigte er sich zum ersten Mal mit dem Film. Er schrieb an mehreren Drehbüchern mit und inszenierte 1934 den Kurzfilm, „Les affaires publiques“. Eine Komödie, die lange Zeit als verschollen galt, von der in den neunziger Jahren aber eine Kopie gefunden wurde. 1943 drehte er seinen ersten Langfilm als Regisseur, „Les Anges du Péché“.
Insgesamt führte Bresson bei vierzehn Filmen Regie. Weltbekannt wurde zum Beispiel „Pickpocket“, der 1959 herausgebracht wurde. Auf verschiedenen Festivals erhielt Bresson Preise. Unter anderem 1951, den Großen Preis der Biennale Venedig für „Journal d’un curé de campagne“, 1962 den Spezialpreis der Jury in Cannes für „Procès de Jeanne d’Arc“ und 1977 den Spezialpreis bei den Berliner Festspielen für „Le diable probablement“.
Besonders interessant finde ich, dass Bresson ab dem Film „Les dames du bois de Boulogne“ seine Figuren nur noch mit Laien besetzte. In der folgenden Hausarbeit werde ich mich zunächst damit befassen, aus welchem Grund Bresson sich gegen professionelle Schauspieler entschied.
Kann sich der Betrachter deshalb besser mit den Figuren identifizieren? Daraus ergibt sich für mich die Frage, wer die Figuren, welche die Modelle darstellen, sind. Sind Laien für die Besetzung der Rollen am Besten geeignet? Ich betrachte deshalb im Anschluss einige seiner Protagonisten näher und versuche Parallelen zwischen den verschiedenen Hauptfiguren der Filme festzustellen. Dabei gehe ich besonders auf die Filme „Journal d’un curé de campagne“, „Un condamné à mort s’est échappé“, „Pickpocket“, „Procès de Jeanne d’Arc“ und „Mouchette“ ein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Laien als Hauptfiguren
- Bressons Figuren
- Allgemeines über die Helden
- Der Kampf um Ansehen und Liebe
- Leidenschaft
- Gefängnis
- Sind Bressons Modelle mit Kindern vergleichbar?
- Bezug von den Personen und deren Lebensraum zur Wirklichkeit
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit den Hauptfiguren in Robert Bressons Filmen und analysiert insbesondere die Entscheidung des Regisseurs, Laien statt professionelle Schauspieler zu besetzen. Der Fokus liegt auf den Motiven für diese Wahl sowie auf den Auswirkungen auf die Darstellung der Charaktere und deren Interaktion mit der Umgebung.
- Bressons Entscheidung, ausschließlich Laien in seinen Filmen einzusetzen
- Analyse der Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Bressons Hauptfiguren
- Die Beziehung zwischen den Figuren und der Wirklichkeit
- Die Bedeutung von Emotionen, Sprache und Wahrnehmung in Bressons Filmen
- Die Rolle des Todes und der Krankheit in der Darstellung der Figuren
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und erläutert die Bedeutung von Robert Bressons Filmen für das 20. Jahrhundert. Sie stellt die zentralen Fragen der Arbeit dar, die sich um die Wahl der Laien als Hauptfiguren drehen. Das zweite Kapitel beleuchtet Bressons Entscheidung, ausschließlich Laien als Schauspieler zu verwenden, und analysiert die Gründe und Beweggründe für diesen Schritt.
Im dritten Kapitel werden die Hauptfiguren in Bressons Filmen näher betrachtet. Es werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Charakteren aufgezeigt, sowie deren Beziehung zur Gesellschaft und zur Wirklichkeit. Das Kapitel analysiert die Darstellung von Emotionen, Sprache und Wahrnehmung in den Filmen. Es untersucht zudem die Rolle des Todes und der Krankheit in den Filmen, und wie sie die Leben der Figuren prägen.
Schlüsselwörter
Robert Bresson, Laien, professionelle Schauspieler, Modelle, Filmfiguren, Hauptfiguren, Authentizität, Emotionen, Sprache, Wahrnehmung, Todes, Krankheit, Gesellschaft, Wirklichkeit.
Häufig gestellte Fragen
Warum setzte Robert Bresson Laien statt Profi-Schauspieler ein?
Bresson suchte nach reiner Information und Authentizität. Er wollte keine „Darstellung“, sondern dass seine „Modelle“ (wie er Laien nannte) die Emotionen unbewusst durch ihre bloße Präsenz vermitteln.
Was unterscheidet Bressons „Modelle“ von herkömmlichen Schauspielern?
Während Profis Rollen interpretieren, sollten Modelle bei Bresson keine psychologische Deutung vornehmen, sondern Bewegungen und Worte fast mechanisch ausführen.
Welche Gemeinsamkeiten haben die Hauptfiguren in Bressons Filmen?
Seine Helden kämpfen oft um Ansehen und Liebe, befinden sich häufig in (metaphorischen oder realen) Gefängnissen und sind von einer tiefen Leidenschaft oder Isolation geprägt.
In welchen Filmen ist dieser Stil besonders deutlich?
Besonders prägend ist dieser Stil in Werken wie „Pickpocket“, „Mouchette“ und „Un condamné à mort s’est échappé“ (Ein zum Tode Verurteilter ist entflohen).
Welche Rolle spielen Tod und Krankheit in seinen Werken?
Tod und Krankheit sind wiederkehrende Motive, die das Schicksal der Figuren prägen und die existenzielle Schwere ihrer Lebensrealität unterstreichen.
- Quote paper
- Dipl. Jonathan Lecot (Author), 2006, Robert Bresson: Gemeinsamkeiten der Hauptfiguren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/153727