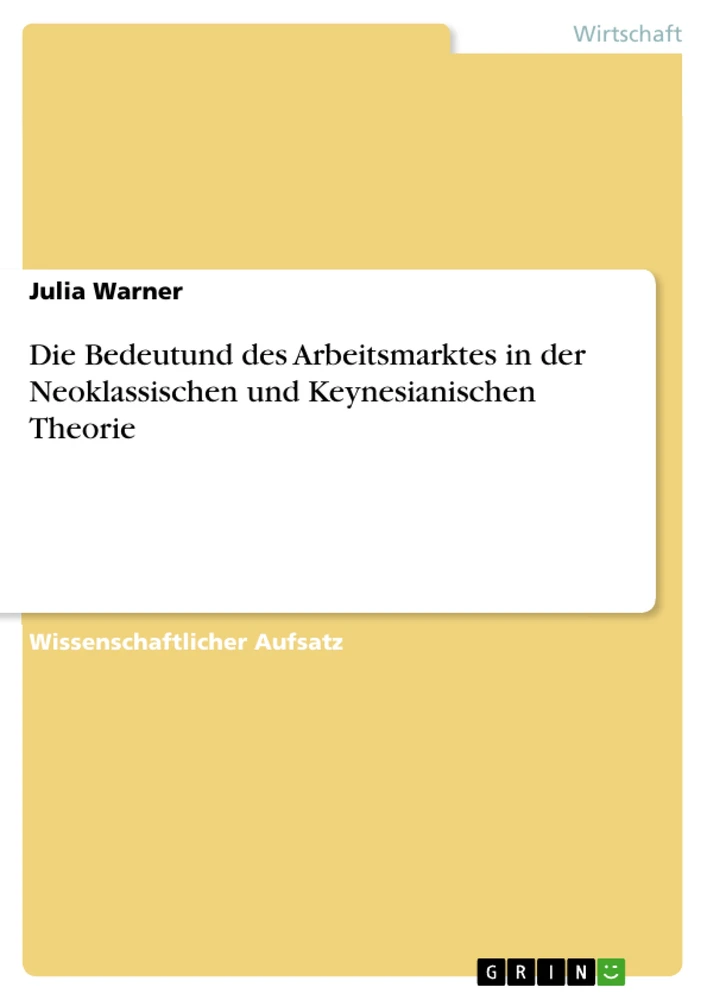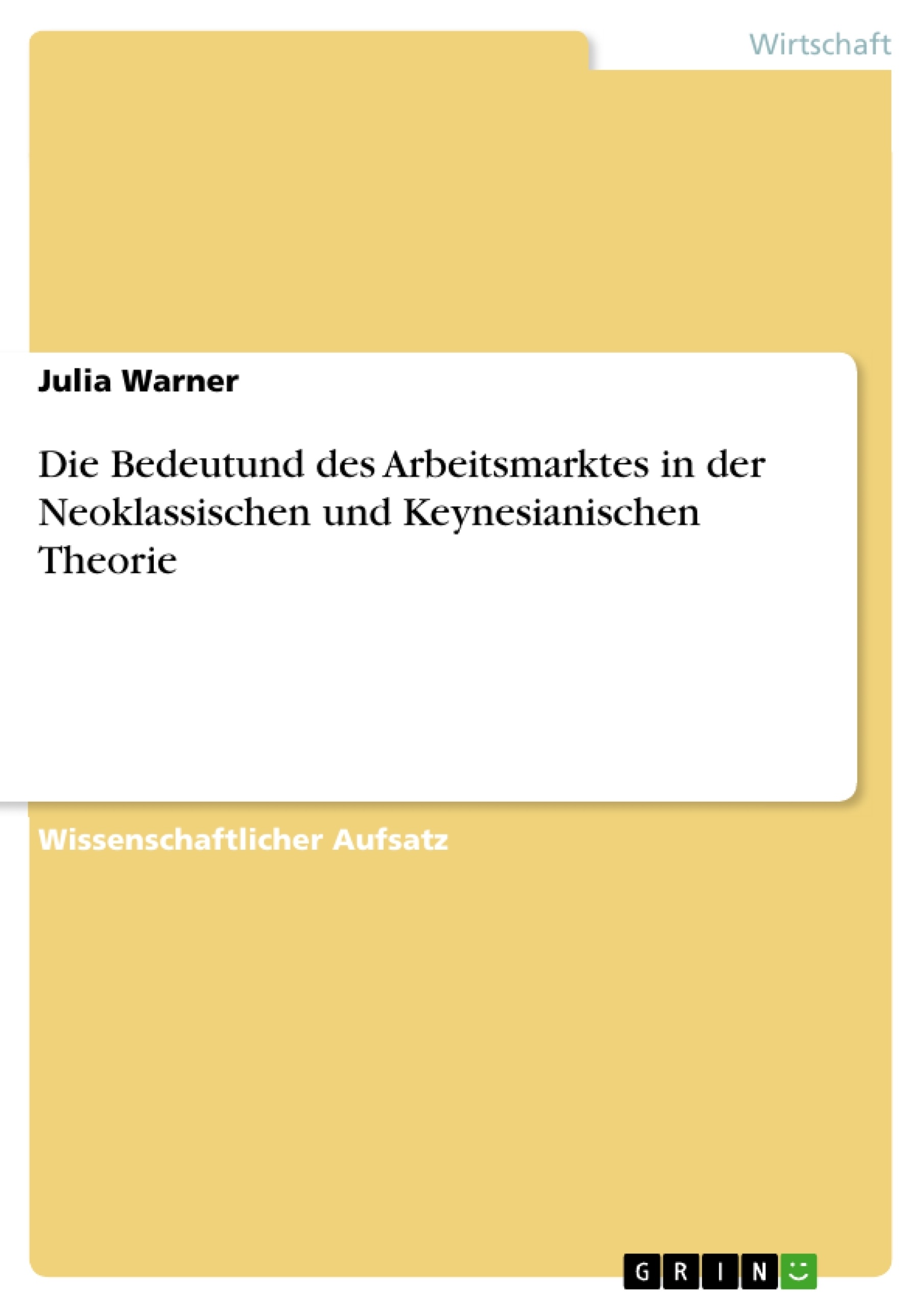1. Einleitung
2. Die Neoklassische Theorie
2.1 Grundzüge
2.2 Der Arbeitsmarkt im Gesamtmodell
3. Die Keynesianische Theorie
3.1 Grundzüge
3.2 Der Arbeitsmarkt im Gesamtmodell
4. Fazit
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Es wird die Bedeutung des Arbeitsmarktes in der Neoklassischen und Keynesianischen Theorie dargestellt. Dabei werden die Merkmale herausgearbeitet, um einen Eindruck der verschiedenen Theorien zu erlangen. Desweiteren wird der Arbeitsmarkt im Gesamtmodell erläutert. Es werden die Märkte der jeweiligen Totalmodelle erklärt, wobei der Arbeitsmarkt ausführlicher behandelt wird. Abschließend wird ein Fazit gebildet. In der gesamten Arbeit sind die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Theorien gut ersichtlich.
2. Die Neoklassische Theorie
2.1 Grundzüge
Die Neoklassik ist mit der Vorstellung verbunden, dass die Einflussnahme des Staates nicht notwendigerweise zur optimalen Allokation der Ressourcen führt. Die Märkte (Arbeits-, Güter-, Geld- und Wertpapiermarkt) regulieren sich selbst. Auf allen Einzelmärkten herrscht also ein Gleichgewicht und selbst eine Störung...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Neoklassische Theorie
- Grundzüge
- Der Arbeitsmarkt im Gesamtmodell
- Die Keynesianische Theorie
- Grundzüge
- Der Arbeitsmarkt im Gesamtmodell
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die Bedeutung des Arbeitsmarktes innerhalb der neoklassischen und keynesianischen Wirtschaftstheorien. Sie beleuchtet die spezifischen Merkmale beider Theorien, um ein umfassendes Verständnis der unterschiedlichen Ansätze zu ermöglichen. Darüber hinaus wird der Arbeitsmarkt im Kontext der jeweiligen Gesamtmodelle untersucht, um die Interaktion mit anderen Märkten und die Auswirkungen von Störungen zu verdeutlichen.
- Unterschiede und Gemeinsamkeiten der neoklassischen und keynesianischen Theorien hinsichtlich des Arbeitsmarktes
- Analyse der Rolle des Arbeitsmarktes im Gesamtmodell der neoklassischen Theorie
- Analyse der Rolle des Arbeitsmarktes im Gesamtmodell der keynesianischen Theorie
- Die Bedeutung des Arbeitsmarktes für die Wirtschaftsentwicklung
- Die Auswirkungen von Störungen auf den Arbeitsmarkt
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in die Thematik der Hausarbeit ein und stellt die Bedeutung des Arbeitsmarktes innerhalb der neoklassischen und keynesianischen Theorie heraus. Sie beschreibt den Umfang der Arbeit und benennt die zentralen Fragestellungen, die im weiteren Verlauf behandelt werden.
Die Neoklassische Theorie
Grundzüge
Dieser Abschnitt erläutert die grundlegenden Prinzipien der neoklassischen Theorie. Dabei werden die zentralen Annahmen, wie die Selbstregulierung der Märkte und die Bedeutung des Preismechanismus, hervorgehoben.
Der Arbeitsmarkt im Gesamtmodell
Dieses Kapitel präsentiert das Gesamtmodell der neoklassischen Theorie, in dem der Arbeitsmarkt zusammen mit dem Kapital- und Geldmarkt betrachtet wird. Durch die Verwendung einer graphischen Darstellung werden die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Märkten und die Auswirkungen von Störungen verdeutlicht.
Die Keynesianische Theorie
Grundzüge
Dieser Abschnitt beschreibt die Grundzüge der keynesianischen Theorie, mit dem Fokus auf die Rolle des Staates bei der Stabilisierung der Wirtschaft und der Bedeutung von Nachfrage und Investitionen.
Der Arbeitsmarkt im Gesamtmodell
Dieses Kapitel analysiert den Arbeitsmarkt im Kontext des keynesianischen Gesamtmodells. Dabei werden die Interaktionen mit anderen Märkten und die Bedeutung der Staatsintervention bei der Bekämpfung von Arbeitslosigkeit beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter der Hausarbeit umfassen: Neoklassische Theorie, Keynesianische Theorie, Arbeitsmarkt, Gesamtmodell, Vollbeschäftigung, Reallohnsatz, Arbeitsnachfrage, Arbeitsangebot, Preismechanismus, Marktgleichgewicht, Staatsintervention, Nachfrage, Investitionen, Wirtschaftsentwicklung.
Häufig gestellte Fragen
Wie sieht die Neoklassik den Arbeitsmarkt?
Die Neoklassik geht davon aus, dass sich der Arbeitsmarkt durch den Preismechanismus (Lohn) selbst reguliert und stets zum Gleichgewicht (Vollbeschäftigung) tendiert.
Was ist der zentrale Unterschied der keynesianischen Theorie?
Keynes betont, dass Märkte nicht automatisch zum Gleichgewicht führen und unfreiwillige Arbeitslosigkeit durch mangelnde Nachfrage entstehen kann, die staatliche Eingriffe erfordert.
Welche Rolle spielt der Reallohn in der Neoklassik?
Der Reallohn bestimmt das Angebot und die Nachfrage nach Arbeit; sinkende Löhne führen laut Theorie zur Beseitigung von Arbeitslosigkeit.
Warum fordert Keynes Staatsinterventionen?
Um die gesamtwirtschaftliche Nachfrage anzukurbeln, wenn private Investitionen nicht ausreichen, um Vollbeschäftigung zu sichern.
Was bedeutet „Marktselbstregulierung“?
Die Annahme, dass Angebot und Nachfrage ohne äußere Hilfe durch Preisänderungen immer wieder zueinander finden.
- Quote paper
- Julia Warner (Author), 2010, Die Bedeutund des Arbeitsmarktes in der Neoklassischen und Keynesianischen Theorie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/153939