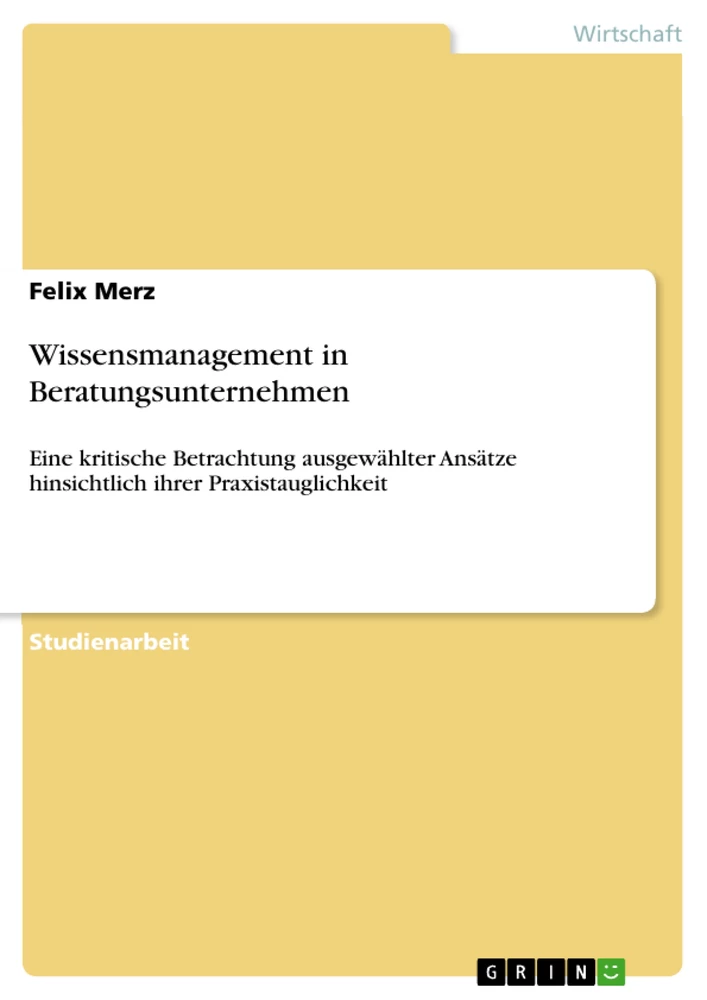John Sparrow hat vor über zehn Jahren geschrieben: „It seems that we need to understand the „knowledge‟ that organizational participants „have‟ in order to perform their jobs.” Heute scheint es nicht mehr notwendig zu sein, sondern es ist notwendig. Mit dem Übergang von der Industrie- zur Informations- und Wissensgesellschaft sowie im Zuge der Globalisierung von Märkten wird Wissen als vierter Produktionsfaktor und strategischer Wettbewerbsvorteil angesehen. Es ist eine Ressource, die sich durch den Gebrauch vermehrt, also vernutzt – sie findet im Prozess der Leistungserstellung Einsatz und ist zugleich Ergebnis dieses Prozesses. Die Arbeit von Beratungsunternehmen ist stark vom Projektgeschäft geprägt und mit der einhergehenden dezentralen Organisation sind Bereitstellung und Austausch von Wissen wichtige Erfolgsfaktoren im Beratungsgeschäft.„Vielfältiges Wissen sinnvoll zu strukturieren, um es in den Beratungsprozessen gezielt einsetzen zu können, ist ein entscheidender Bestandteil der Leistungsfähigkeit von Beratungsunternehmen und ein Herausstellungsmerkmal ersten Ranges.“ Es sollte daher dem Wissensmanagement ein hoher Stellenwert eingeräumt werden, denn die Existenzberechtigung liegt in einer kollektiven wissensbasierten Leistungserbringung,bei der verschiedene Wissensträger (Berater) ihr Wissen integrieren, um gemeinsam eine Beratungsleistung zu erbringen.Beratungsprozess besteht in der Transformation von bisherigem Wissen in neues Wissen und stellt damit einen Wissensverarbeitungsprozess dar. Das Ergebnis ist neu geschaffenes Wissen, welches wieder die Grundlage für künftige Projekte begründen kann. Es besthet also die Notwendigkeit eines effizienten Wissensmanagements.Besonders in den letzten Jahren ist eine Vielzahl an Literatur zum Thema Wissensmanagement in Unternehmensberatungen in Büchern wie Aufsätzen in Fachzeitschriften veröffentlicht worden, was dessen Aktualität aufzeigt. Eines sollte nicht vergessen werden: Schon 1605 hat der englische Philosoph Francis Bacon festgestellt, das Wissen Macht sei – und dies gilt immer noch. Doch die Zeiten sind dynamischer und komplexer geworden. Im Sinne Bacons liegt die Macht nicht mehr im Wissen des Einzelnen, sondern im kollektiven Wissen aller Mitarbeiter.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Methodisches Vorgehen
- Wissensmanagement in Beratungsunternehmen
- Theoretische Grundlagen
- Wissen
- Beratungswissen
- Wissensmanagement
- Ansätze des Wissensmanagements
- Der Ansatz von Nonaka und Takeuchi
- Ansatz von Willke
- Ansatz von Probst, Raub und Romhardt
- Theoretische Grundlagen
- Schluss
- Ergebnisse
- Konsequenzen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit dem Thema Wissensmanagement in Beratungsunternehmen. Ziel ist es, ausgewählte Ansätze des Wissensmanagements kritisch zu betrachten und ihre Praxistauglichkeit zu bewerten. Hierbei wird insbesondere auf die Besonderheiten von Beratungsunternehmen als wissensintensive Dienstleistungsanbieter eingegangen.
- Die Bedeutung von Wissen als strategischem Wettbewerbsvorteil in Beratungsunternehmen
- Die Herausforderungen des Wissensmanagements in einem projektorientierten und dezentralen Umfeld
- Die Analyse und Bewertung verschiedener Ansätze des Wissensmanagements hinsichtlich ihrer Praxistauglichkeit
- Die Bedeutung der Integration von Wissen in die Beratungsprozesse
- Die Rolle von Wissensträgern (Beratern) in der kollektiven Wissensgenerierung und -verwertung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemstellung und das methodische Vorgehen der Arbeit dar. Kapitel 2 beleuchtet die theoretischen Grundlagen des Wissensmanagements in Beratungsunternehmen und betrachtet verschiedene Ansätze. Es werden wichtige Konzepte wie Wissen, Beratungswissen und Wissensmanagement erläutert. Die Arbeit konzentriert sich auf die Ansätze von Nonaka und Takeuchi, Willke sowie Probst, Raub und Romhardt, wobei deren Praxistauglichkeit kritisch analysiert wird. Abschließend werden die Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst und die daraus resultierenden Konsequenzen für die Praxis diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt zentrale Themen wie Wissensmanagement, Beratungswissen, Wissensintensivität, Dienstleistungsanbieter, Praxistauglichkeit, Nonaka und Takeuchi, Willke, Probst, Raub und Romhardt.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Wissensmanagement für Beratungsunternehmen so wichtig?
Da Beratung eine wissensintensive Dienstleistung ist, stellt kollektives Wissen einen strategischen Wettbewerbsvorteil dar. Effektives Wissensmanagement ermöglicht es, Wissen aus Projekten zu systematisieren und für künftige Aufgaben nutzbar zu machen.
Welche theoretischen Ansätze werden in der Arbeit analysiert?
Die Arbeit untersucht die Ansätze von Nonaka und Takeuchi, Willke sowie Probst, Raub und Romhardt hinsichtlich ihrer Praxistauglichkeit für Unternehmensberatungen.
Was bedeutet Wissen als „vierter Produktionsfaktor“?
Neben Kapital, Arbeit und Boden wird Wissen in der modernen Informationsgesellschaft als entscheidende Ressource angesehen, die sich durch Gebrauch vermehrt statt zu verbrauchen.
Welche Rolle spielen die einzelnen Berater im Wissensprozess?
Berater sind die primären Wissensträger. Die Herausforderung besteht darin, ihr individuelles Wissen in ein kollektives Wissenssystem zu integrieren, besonders in dezentralen Projektstrukturen.
Was ist das Ziel des Wissensverarbeitungsprozesses in der Beratung?
Ziel ist die Transformation von bestehendem Wissen in neues Wissen, das als Ergebnis einer Beratungsleistung dient und die Basis für zukünftige Projekte bildet.
- Citation du texte
- Dipl.-Betriebswirt (FH) Felix Merz (Auteur), 2010, Wissensmanagement in Beratungsunternehmen , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/154018