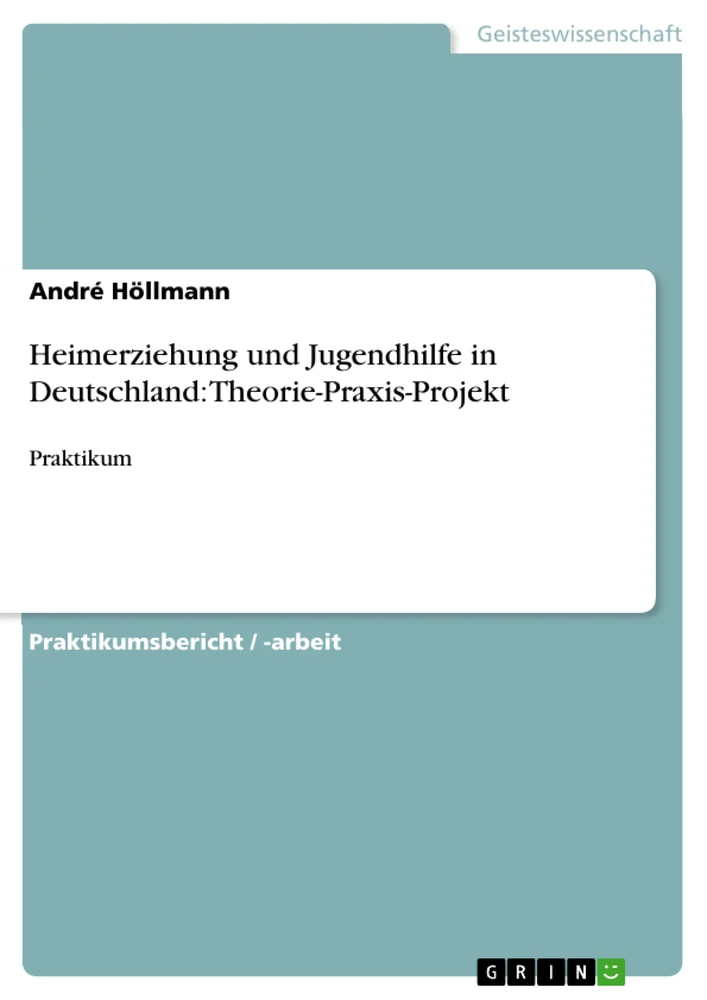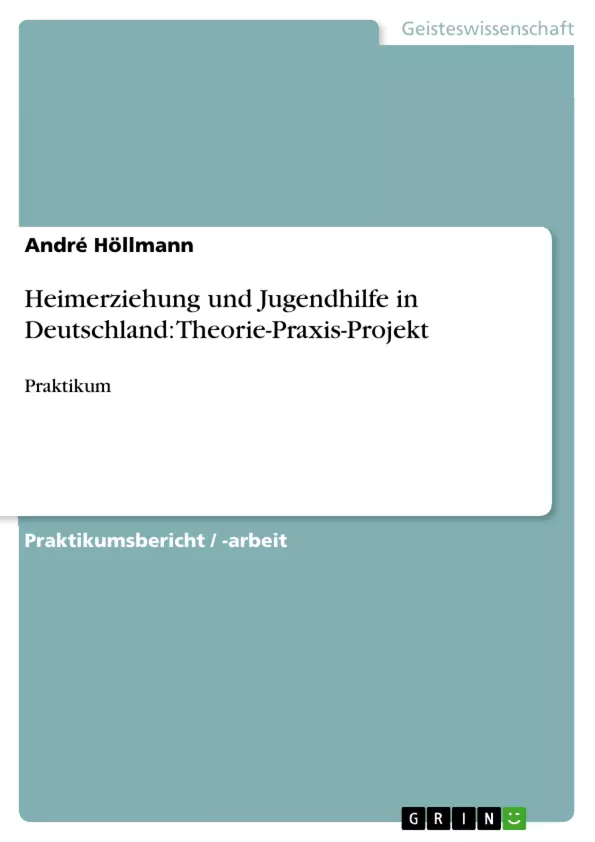Die Heimerziehung ist mit seinen ausdifferenzierten, sowie dezentralisierten Unterbringungsformen fester Bestandteil der Jugendhilfe in Deutschland. Eine weite Spannbreite von konzeptionellen Ansätzen zeugt von einer sehr konkreten Antwort auf die individuellen Bedürfnisse und Problemstellungen ihrer Klientel. Die tatsächliche Hilfe wird von den Einrichtungen verschiedenster Träger und deren Mitarbeitern ausgeführt und vom Jugendamt initiiert, überwacht und kontrolliert.
In dem vorliegenden Band möchte ich den Träger, die Einrichtung und die Praxisstelle vorstellen, sowie meine gewonnenen Erkenntnisse eingehend beschreiben. Darüber hinaus möchte ich den Bezug zu den theoretischen Erkenntnissen aus der Begleitveranstaltung dem Theorie-Praxis-Seminar verdeutlichen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Darstellung des Trägers - ein Teil der Diakonie
- Historisches zur Einrichtung des Trägers
- Fachbereiche, Einrichtungen und Organigramm des Trägers
- Leitbild der Diakonischen Erziehungshilfen Weißenstein
- Vorstellung der Einrichtung und Praxisstelle
- Außenwohngruppe in Hagen Fley
- Leistungskategorie
- Betreuungsdichte und Qualifikation der Mitarbeiter
- Rechtliche Grundlagen
- Zielgruppe
- Grundleistungen
- Kosten
- Zusammenarbeit mit anderen Diensten
- Dokumentationsformen
- Außenwohngruppe in Hagen Fley
- Praktikumsverlauf
- Zeitlicher Ablauf
- Art und Umfang der Aufgaben
- Inhaltliche/methodische Gewichtung
- Besondere Ereignisse
- Auswertung
- Ertrag an Informationen und Wissen durch das Praktikum
- Erfahrungen, Affekte, Phantasien in Bezug auf Klienten und Vorgesetzte
- Theoretische Erkenntnisse der Begleitveranstaltung im Praxisbezug
- Konsequenzen und Perspektiven für die berufliche Entwicklung
- Schlussbemerkung
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Bericht zum Theorie-Praxis-Projekt befasst sich mit der Außenstelle der Diakonischen Erziehungshilfen Weißenstein in Hagen Fley. Das Projekt zielte darauf ab, theoretische Kenntnisse aus dem Studium der Sozialen Arbeit in den Kontext der Praxis zu übertragen und zu vertiefen. Der Bericht beleuchtet die verschiedenen Facetten der Einrichtung, wie die Organisation, die Leistungskategorie und die Zusammenarbeit mit anderen Diensten.
- Die Geschichte und Entwicklung des Trägers, der Diakonischen Erziehungshilfen Weißenstein
- Die Organisation des Trägers und die Einordnung der Außenwohngruppe in Hagen Fley
- Die Leistungskategorie und Zielgruppe der Außenwohngruppe
- Der praktische Einsatz und die Reflexion theoretischer Erkenntnisse im Rahmen des Praktikums
- Die Bedeutung des Theorie-Praxis-Projekts für die berufliche Entwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel stellt die Einbindung des Praktikums in das Studium der Sozialen Arbeit dar. Der Autor beschreibt seine eigene Erfahrung im Bereich der Jugendhilfe und die Relevanz seiner vorherigen Tätigkeiten. Kapitel 2 widmet sich dem Träger der Einrichtung, dem Diakonischen Werk Ennepe-Ruhr/ Hagen, und seinen historischen Wurzeln. In Kapitel 3 werden die Außenwohngruppe in Hagen Fley, ihre Leistungskategorie, die Zielgruppe und die Zusammenarbeit mit anderen Diensten vorgestellt. Kapitel 4 fokussiert auf den Praktikumsverlauf und die Aufgaben, die der Autor während seines Einsatzes übernommen hat. Kapitel 5 beinhaltet die Auswertung der Erfahrungen des Praktikums, die Erträge und Reflexionen der gewonnenen Erkenntnisse. Das letzte Kapitel bietet eine Zusammenfassung der Ergebnisse und Perspektiven für die eigene berufliche Entwicklung.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Berichts sind Diakonisches Werk Ennepe-Ruhr/ Hagen, Diakonische Erziehungshilfen Weißenstein, Außenwohngruppe, Hagen Fley, Jugendhilfe, Praxisprojekt, Theorie-Praxis-Transfer, Sozialarbeit, Reflexion, berufliche Entwicklung.
- Quote paper
- André Höllmann (Author), 2010, Heimerziehung und Jugendhilfe in Deutschland: Theorie-Praxis-Projekt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/154261