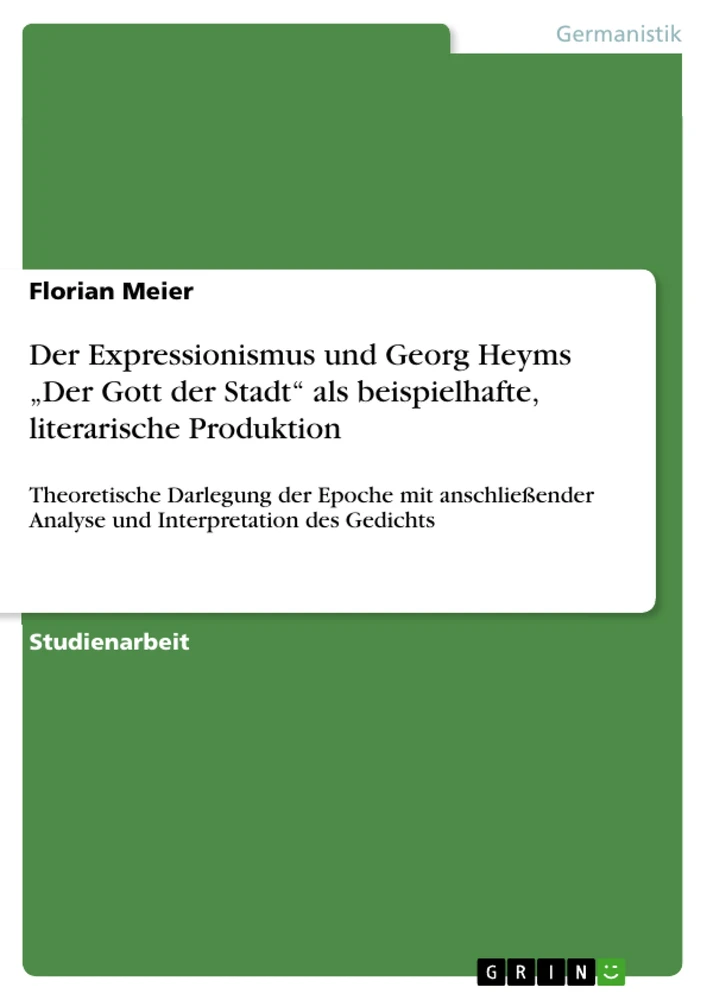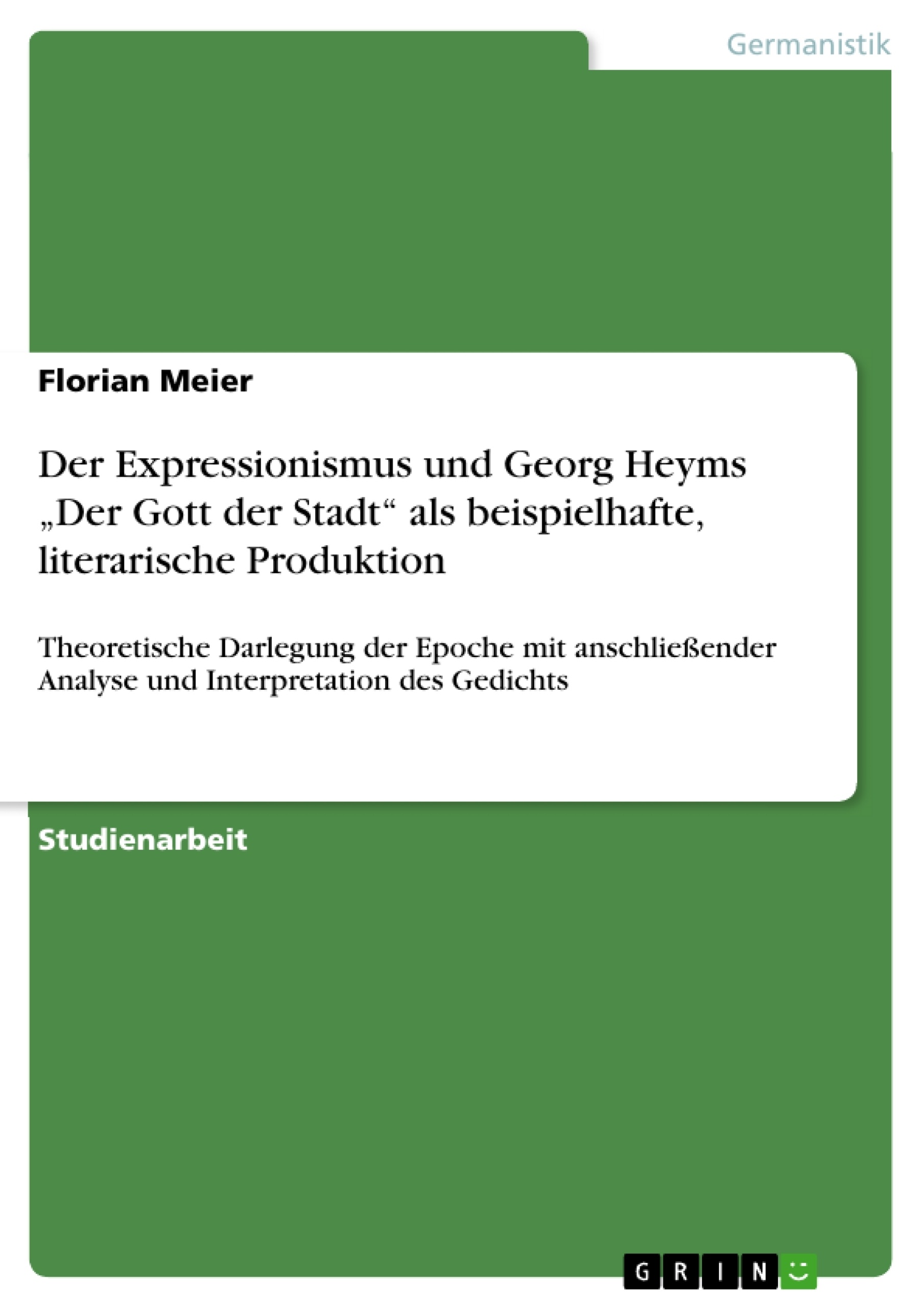Literaturgeschichte und die dazu existierende Forschung sieht sich oftmals mit diversen Schwierigkeiten konfrontiert[...]
In den Fokus dieser Abhandlung rückt die Strömung des Expressionismus und ihr literarisches Werk. [...] Die stilistischen Merkmale des Expressionismus werden in vielen literaturwissenschaftlichen Werken genannt, am besten lässt sich jedoch für den Rezipienten die geistige Grundhaltung und der literarische Stil der Autorschaft an den Werken selbst nachvollziehen. In dieser Ausarbeitung wird zunächst der Expressionismus theoretisch vorgestellt. Dabei geht es zunächst darum, eine zeitliche Verortung vorzunehmen, bevor auf wichtige Vertreter der Strömung eingegangen wird. Es handelt sich vorwie-gend um Autoren, die als Avantgarde der Bewegung gelten oder um Personen, die gerade in der Anfangszeit der Strömung eine große Rolle für ihre Etablie-rung gespielt haben. Im folgenden Gliederungspunkt werden übergreifende Themen- , Formen- und Stilcharakteristika des Expressionismus vorgestellt. Viele literarische Epochen sind von einer überwiegend auftretenden Textsorte, bestimmter stilistischer Eigenheiten oder wiederkehrenden thematischen Schwerpunkten gekennzeichnet, was auch auf diese Epoche zutrifft.
Um einen praktischen Bezug zu diesem theoretischen Teil der Abhandlung zu liefern, folgt darauf die Analyse und Interpretation des Gedichts „Der Gott der Stadt“ von Georg Heym. Es wird zunächst formal analysiert, wobei hier neben dem Reimschema und dem Metrum auf die Form der Verse selbst eingegangen wird, was bei expressionistischen Werken eine wichtige Grundlage für weitere Analysen und Interpretationsansätze bieten kann.
Danach wird der Inhalt der einzelnen Strophen kurz geschildert, um bei der anschließenden Interpretation auf diese im Detail einzugehen und übergreifen-de Aspekte des Gedichts beleuchten zu können.
Im letzten Gliederungspunkt dieser Ausarbeitung wird dann ein übergreifendes Fazit aus den Erkenntnissen der Interpretation gezogen. Hierbei wird darauf eingegangen, welche epochentypischen Stil-, Formen- und Themencharakteris-tika in dem Gedicht vorliegen, beziehungsweise inwieweit Abwandlungen und Eigenheiten von Seiten des Autors vorliegen. Es wird am Ende noch ange-dacht, welche Intention Georg Heym mit dem Gedicht verfolgte und ob diese der geistigen Grundhaltung der übrigen Autorschaft entspricht.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- DER EXPRESSIONISMUS
- ZEITLICHE EINORDNUNG
- WICHTIGE VERTRETER IN DER LITERATUR
- THEMEN, FORMEN UND STIL IN DER LITERATUR
- GEDICHTANALYSE UND INTERPRETATION VON GEORG HEYMS „DER GOTT DER STADT“
- FORMALE ANALYSE
- INHALTLICHE ZUSAMMENFASSUNG DER EINZELNEN STROPHEN
- INTERPRETATION
- DIE SEMANTISCHE FUNKTION DER ADJEKTIVE UND VERBEN IM GEDICHT
- SCHLUSSBETRACHTUNG: „DER GOTT DER STADT“ ALS MUSTERBEISPIEL FÜR DEN LITERARISCHEN EXPRESSIONISMUS?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Abhandlung befasst sich mit dem Expressionismus als literarischer Strömung im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts. Ziel ist es, die Epoche des Expressionismus theoretisch zu beleuchten und anhand des Gedichts „Der Gott der Stadt“ von Georg Heym die typischen Merkmale dieser Strömung zu verdeutlichen.
- Zeitliche Einordnung und Abgrenzung des Expressionismus zu anderen Strömungen
- Wichtige Vertreter und Charakteristika des Expressionismus in der Literatur
- Analyse und Interpretation von Georg Heyms Gedicht „Der Gott der Stadt“
- Das Gedicht als Beispiel für typische Merkmale des Expressionismus
- Die Bedeutung des Gedichts im Kontext der Expressionistischen Bewegung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik der Epochenabgrenzung in der Literaturgeschichte dar und verdeutlicht die Bedeutung des Expressionismus als einer stilistisch prägnanten Bewegung. Anschließend wird der Expressionismus in seiner zeitlichen Einordnung, seinen wichtigen Vertretern und seinen charakteristischen Themen, Formen und Stilmerkmalen vorgestellt. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der formalen Analyse und Interpretation des Gedichts „Der Gott der Stadt“ von Georg Heym. Es werden die Reimschema und das Metrum des Gedichts untersucht, sowie die Inhalte der einzelnen Strophen zusammengefasst. Die Interpretation des Gedichts konzentriert sich auf übergreifende Aspekte und die sematische Funktion der Adjektive und Verben.
Schlüsselwörter
Expressionismus, Georg Heym, „Der Gott der Stadt“, Zeitliche Einordnung, Wichtige Vertreter, Themen, Formen und Stil, Gedichtanalyse, Interpretation, Semantische Funktion, Avantgarde, Epochenbegriffe, literarische Strömungen, Formalanalyse, Stilmerkmale.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptziel dieser Abhandlung über den Expressionismus?
Das Ziel ist es, die literarische Strömung des Expressionismus theoretisch vorzustellen und ihre typischen Merkmale anhand einer Analyse von Georg Heyms Gedicht „Der Gott der Stadt“ praktisch zu verdeutlichen.
Welche zeitliche Einordnung wird für den Expressionismus vorgenommen?
Die Arbeit verortet den Expressionismus als literarische Strömung im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts.
Welche formalen Aspekte werden in der Analyse von „Der Gott der Stadt“ untersucht?
Die Analyse umfasst das Reimschema, das Metrum sowie die spezifische Form der Verse, die eine wichtige Grundlage für die Interpretation expressionistischer Werke bilden.
Welche Rolle spielen Adjektive und Verben in der Gedichtinterpretation?
Ein spezieller Fokus der Arbeit liegt auf der semantischen Funktion der Adjektive und Verben, um die Ausdruckskraft und die geistige Grundhaltung des Autors zu beleuchten.
Wird Georg Heym als typischer Vertreter des Expressionismus betrachtet?
Ja, die Arbeit untersucht im Fazit, inwieweit das Gedicht als Musterbeispiel für den literarischen Expressionismus gelten kann und ob Heyms Intention der allgemeinen Grundhaltung der damaligen Autorschaft entspricht.
Welche Themen sind charakteristisch für die Epoche des Expressionismus?
Die Arbeit thematisiert übergreifende Stilcharakteristika sowie wiederkehrende thematische Schwerpunkte wie die Großstadtproblematik und die geistige Avantgarde der Bewegung.
- Quote paper
- Florian Meier (Author), 2010, Der Expressionismus und Georg Heyms „Der Gott der Stadt“ als beispielhafte, literarische Produktion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/154455