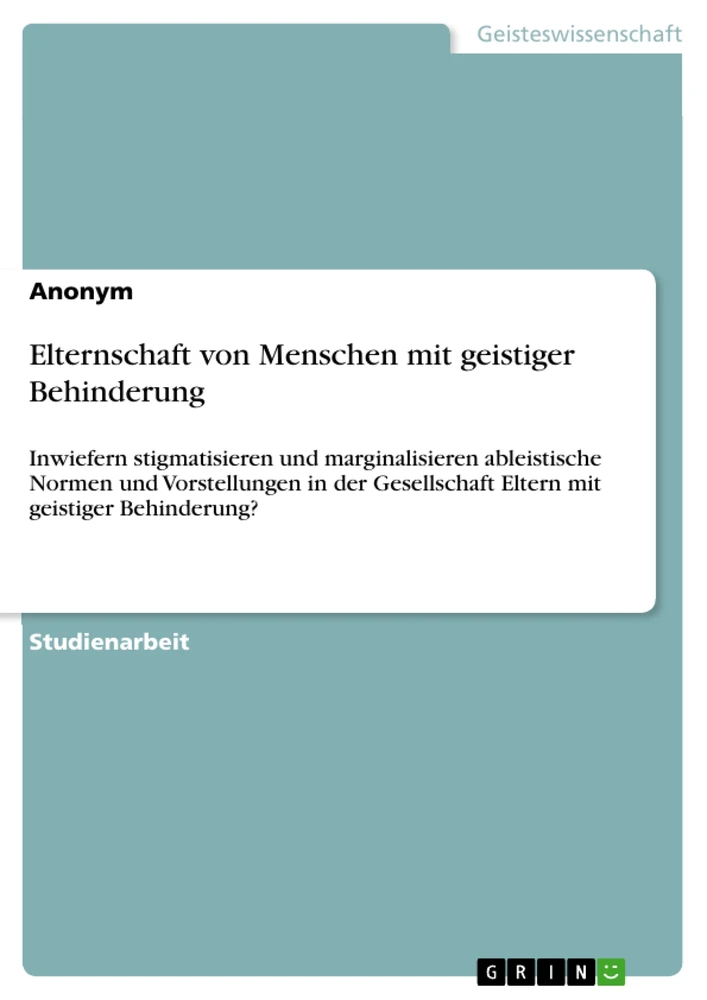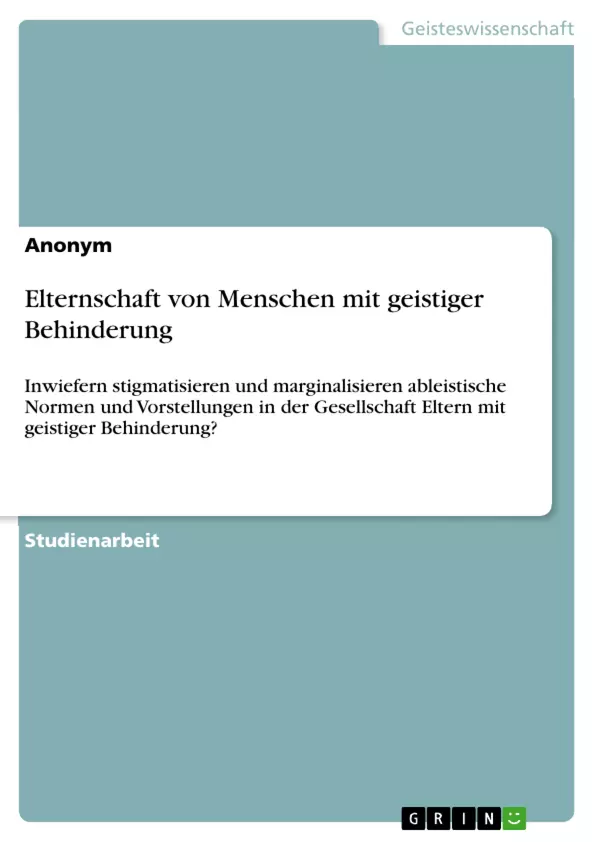Inwiefern stigmatisieren und marginalisieren ableistische Normen und Vorstellungen in der Gesellschaft Eltern mit geistiger Behinderung? Um den Rahmen dieser Arbeit nicht zu sprengen, wurde sie auf folgende Themenschwerpunkte eingeschränkt. Zunächst wird auf die konstruierten Chancen und Barrieren für eine Familiengründung mit Kindern eingegangen. Danach folgt ein differenzierter Blick auf die Fähigkeiten und Belastungen bezüglich der Erziehung und Versorgung der Kinder. Weiterhin folgt die Untersuchung von Diskriminierungsformen und Fremdzuschreibungen, die Eltern mit geistiger Behinderung erfahren. Das Phänomen Elternschaft mit geistiger Behinderung soll anhand der sozialen, historischen sowie rechtlichen Entwicklungen beleuchtet werden.
Die gesetzliche Situation unterliegt einem historisch-politischen Wandel, sodass in der Vergangenheit auf strenge Maßnahmen gegen das Elternsein von Menschen mit geistiger Behinderung zurückgegriffen wurde, wie zum Beispiel mit „Zwangssterilisationen" in Zeiten des Nationalsozialismus. Der Kinderwunsch und das Elternsein von Menschen mit geistiger Behinderung wird somit einerseits durch gesetzliche Regelungen und andererseits durch das gesellschaftliche und persönliche Umfeld beeinflusst. Denn ihr Wunsch, eigene Kinder zu haben, wird nicht ernst genommen oder er wird kategorisch abgelehnt. Heute sind die Diskussionen im deutschsprachigen Raum bezüglich des Forschungsproblems vor allem durch Normalisierungsdebatten und Empowermentbewegungen in den letzten Jahren gestiegen. Obwohl Ergebnisse zeigen, dass es in Deutschland tausende Eltern mit geistiger Behinderung gibt, handelt es sich nach wie vor um ein tabuisiertes Thema.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Hauptteil
- 2.1. Familiengründung
- 2.2. Erziehung und Versorgung der Kinder
- 2.3. Diskriminierende Zuschreibungsprozesse
- 3. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Stigmatisierung und Marginalisierung von Eltern mit geistiger Behinderung durch ableistische Normen und Vorstellungen in der Gesellschaft. Sie beleuchtet die konstruierten Chancen und Barrieren bei der Familiengründung, die Fähigkeiten und Belastungen in der Erziehung und Versorgung der Kinder, sowie Diskriminierungsformen und Fremdzuschreibungen, die diese Eltern erfahren. Der Fokus liegt auf der sozialen, historischen und rechtlichen Entwicklung dieses Themas.
- Chancen und Barrieren bei der Familiengründung für Menschen mit geistiger Behinderung
- Fähigkeiten und Herausforderungen in der Erziehung und Versorgung von Kindern durch Eltern mit geistiger Behinderung
- Diskriminierung und Stigmatisierung von Eltern mit geistiger Behinderung in der Gesellschaft
- Rechtliche und gesellschaftliche Entwicklungen im Umgang mit Elternschaft von Menschen mit geistiger Behinderung
- Unterstützungsangebote und ihre Rolle bei der Förderung selbstbestimmter Elternschaft
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den historischen und rechtlichen Wandel bezüglich des Rechts von Menschen mit Behinderung, Eltern zu sein. Sie verweist auf die UN-Behindertenkonvention und das Grundgesetz, betont aber gleichzeitig die historischen Diskriminierungen, wie Zwangssterilisationen im Nationalsozialismus. Die Arbeit fokussiert auf die Frage, inwiefern ableistische Normen Eltern mit geistiger Behinderung stigmatisieren und marginalisieren, und skizziert die drei zentralen Themenbereiche der Untersuchung: Familiengründung, Erziehung und Versorgung der Kinder, sowie Diskriminierungsprozesse.
2. Hauptteil: Der Hauptteil gliedert sich in drei Unterkapitel. Zuerst wird der Kinderwunsch von Menschen mit geistiger Behinderung aus wissenschaftlicher Perspektive beleuchtet, wobei die Ähnlichkeiten und Unterschiede zu nichtbehinderten Personen, sowie die gesellschaftlichen Reaktionen und Vorurteile thematisiert werden. Der historische Kontext, insbesondere die Zwangssterilisationen im Nationalsozialismus und die Entwicklung des Betreuungsgesetzes, wird umfassend dargestellt. Die rechtliche Entwicklung hin zu mehr Selbstbestimmung und die Bedeutung von Unterstützungsangeboten für eine gelingende Elternschaft werden hervorgehoben. Schließlich wird die Bedeutung der Anerkennung des Kinderwunsches und die Ermöglichung eines gesellschaftlich anerkannten Familienlebens betont.
Schlüsselwörter
Elternschaft, geistige Behinderung, Ableismus, Diskriminierung, Stigmatisierung, Familiengründung, Kindererziehung, Selbstbestimmung, Unterstützungsangebote, Betreuungsgesetz, UN-Behindertenkonvention, Inklusion, Normalisierung, Empowerment.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel dieser Arbeit über Elternschaft und geistige Behinderung?
Diese Arbeit untersucht die Stigmatisierung und Marginalisierung von Eltern mit geistiger Behinderung durch ableistische Normen und Vorstellungen in der Gesellschaft. Sie beleuchtet die konstruierten Chancen und Barrieren bei der Familiengründung, die Fähigkeiten und Belastungen in der Erziehung und Versorgung der Kinder, sowie Diskriminierungsformen und Fremdzuschreibungen, die diese Eltern erfahren. Der Fokus liegt auf der sozialen, historischen und rechtlichen Entwicklung dieses Themas.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf folgende Themenschwerpunkte:
- Chancen und Barrieren bei der Familiengründung für Menschen mit geistiger Behinderung.
- Fähigkeiten und Herausforderungen in der Erziehung und Versorgung von Kindern durch Eltern mit geistiger Behinderung.
- Diskriminierung und Stigmatisierung von Eltern mit geistiger Behinderung in der Gesellschaft.
- Rechtliche und gesellschaftliche Entwicklungen im Umgang mit Elternschaft von Menschen mit geistiger Behinderung.
- Unterstützungsangebote und ihre Rolle bei der Förderung selbstbestimmter Elternschaft.
Was wird in der Einleitung der Arbeit behandelt?
Die Einleitung beschreibt den historischen und rechtlichen Wandel bezüglich des Rechts von Menschen mit Behinderung, Eltern zu sein. Sie verweist auf die UN-Behindertenkonvention und das Grundgesetz, betont aber gleichzeitig die historischen Diskriminierungen, wie Zwangssterilisationen im Nationalsozialismus. Die Arbeit fokussiert auf die Frage, inwiefern ableistische Normen Eltern mit geistiger Behinderung stigmatisieren und marginalisieren, und skizziert die drei zentralen Themenbereiche der Untersuchung: Familiengründung, Erziehung und Versorgung der Kinder, sowie Diskriminierungsprozesse.
Wie ist der Hauptteil der Arbeit strukturiert?
Der Hauptteil gliedert sich in drei Unterkapitel: Familiengründung, Erziehung und Versorgung der Kinder, sowie Diskriminierende Zuschreibungsprozesse.
Was wird im Hauptteil über Familiengründung behandelt?
Der Kinderwunsch von Menschen mit geistiger Behinderung wird aus wissenschaftlicher Perspektive beleuchtet, wobei die Ähnlichkeiten und Unterschiede zu nichtbehinderten Personen, sowie die gesellschaftlichen Reaktionen und Vorurteile thematisiert werden. Der historische Kontext, insbesondere die Zwangssterilisationen im Nationalsozialismus und die Entwicklung des Betreuungsgesetzes, wird umfassend dargestellt. Die rechtliche Entwicklung hin zu mehr Selbstbestimmung und die Bedeutung von Unterstützungsangeboten für eine gelingende Elternschaft werden hervorgehoben. Schließlich wird die Bedeutung der Anerkennung des Kinderwunsches und die Ermöglichung eines gesellschaftlich anerkannten Familienlebens betont.
Welche Schlüsselwörter sind für diese Arbeit relevant?
Relevante Schlüsselwörter sind: Elternschaft, geistige Behinderung, Ableismus, Diskriminierung, Stigmatisierung, Familiengründung, Kindererziehung, Selbstbestimmung, Unterstützungsangebote, Betreuungsgesetz, UN-Behindertenkonvention, Inklusion, Normalisierung, Empowerment.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2021, Elternschaft von Menschen mit geistiger Behinderung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1547627