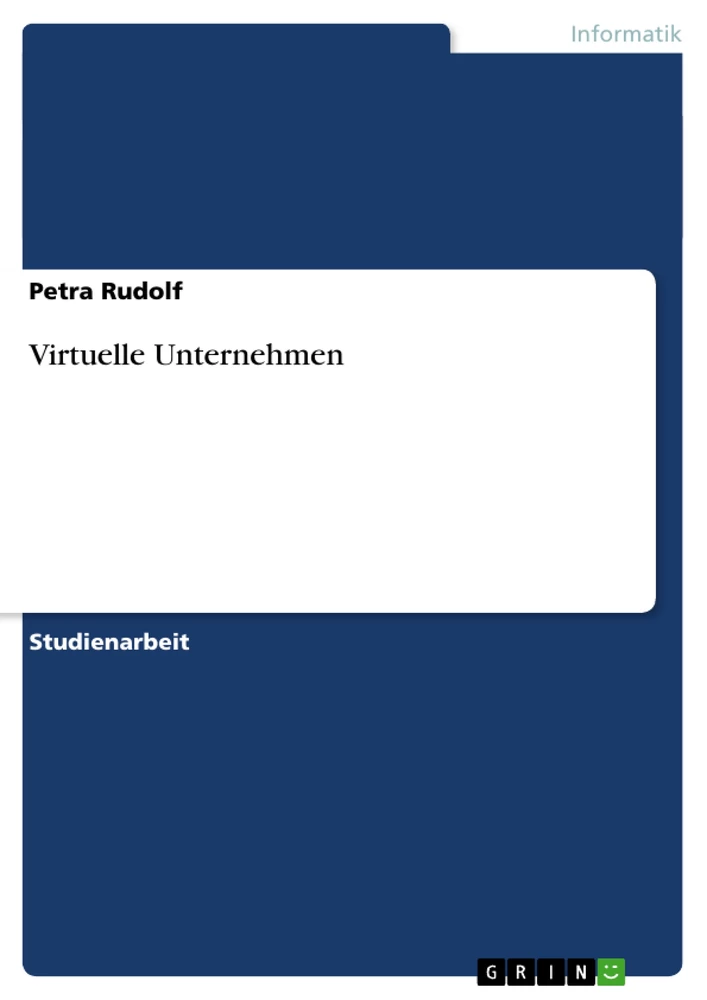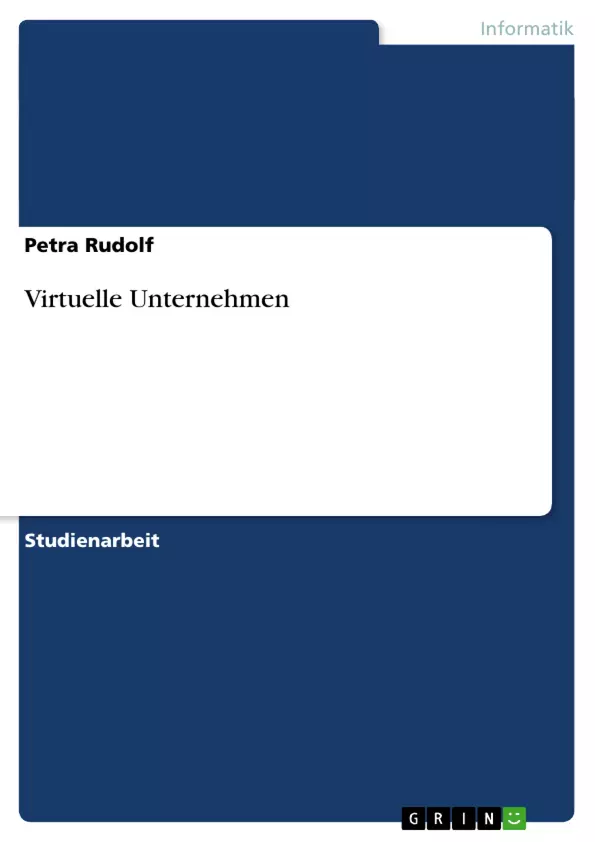In den letzten Jahren befindet sich die Weltwirtschaft und damit der Wettbewerb in allen
Branchen und allen Märkten in einem grundlegenden Wandel. Vor allem die
Wettbewerbsbedingungen sind härter geworden. Die Gründe liegen neben einer allgemeinen
Tendenz zur Globalisierung, die durch die Liberalisierung der Märkte und den Ausbau der
Kommunikationsinfrastruktur ausgelöst wurde, auch bei der Verkürzung der Technologieund
Produktlebenszyklen sowie der steigenden Komplexität der Produkte und
Dienstleistungen. Gleichzeitig ermöglichen Fortschritte in der Informations- und
Kommunikationstechnik neue Produkte, Prozessinnovationen, neue Formen der
Arbeitsorganisation und Arbeitsteilung.1 Firmen, die in Ihrer Branche seit Jahren eine
Spitzenstellung innehatten, müssen sich auf Grund des veränderten Umfelds wieder neu
orientieren und den komplexen Anforderungen stellen. Vor allem Unternehmen, die im
Zuliefermarkt wettbewerbsfähig bleiben wollen, müssen über ein breites Know-how verfügen
und in der Lage sein, kostengünstig zu produzieren.2 Traditionelle Organisationsformen
vermögen diesen Ansprüchen nicht mehr zu genügen, da sie weder über das Know-how noch
über ausreichende Finanzmittel verfügen.3 In den Vordergrund treten Eigenschaften wie
Flexibilität, Schnelligkeit und Kundenorientierung. Einen Lösungsansatz bietet eine neue
Organisationsform, die in der Lage ist, die erforderlichen Problemlösungskompetenzen
schnell aufzubauen, und auf die wechselnden Kundenpräferenzen mit einer effizienten
Leistungserstellung reagieren kann. Diese Kombination von Eigenschaften wird durch das
Konzept des virtuellen Unternehmens (VU) realisiert.
Dem Kern der Arbeit – Grundzüge eines VU darzustellen – geht die Begriffsbestimmung des
VU voraus. Das Kapitel 2.2 zeigt eine Beschreibung der wichtigsten Merkmale auf, die die
Struktur und Besonderheiten eines VU aufweisen. Im weiteren Verlauf werden die vier
Lebensphasen eines VU von der Anbahnungsphase bis hin zur Abwicklungsphase dargelegt.
Ferner wird im Kapitel 2.4. eine klare Abgrenzung des virtuellen Unternehmensbegriffs zu
ähnlichen Konzepten getroffen. Das dritte Kapitel behandelt zunächst ein allgemeines Beispiel eines VU sowie anschließend die Anwendung der virtuellen Organisation am
Beispiel der Virtuellen Fabrik (VF) „Euregio Bodensee“. Zum Abschluss wird das Thema
einer kritischen Würdigung unterzogen.
1 vgl. Picot, A., Rohbach, P., Wigand, R. (1996), S. 3
2 vgl. Gillessen, A. (1999)
3 Kemmer, G., Gillessen, A. (2000), S. 1
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1 Einleitung und Zielsetzung der Arbeit
2 Das Virtuelle Unternehmen als neue Organisationsform
2.1 Der Begriff des Virtuellen Unternehmens
2.2 Merkmale von Virtuellen Unternehmen
2.2.1 Netzwerk wirtschaftlich voneinander unabhängiger Unternehmen
2.2.2 Konzentration auf Kernkompetenzen
2.2.3 Zusammenarbeit in vertikalen und/ oder horizontalen Strukturen
2.2.4 Informations- und Kommunikationssysteme
2.2.5 Bildung von Identität und Vertrauen
2.2.6 Zeitlich begrenzte Synergie
2.3 Lebensphasen von Virtuellen Unternehmen
2.3.1 Anbahnungsphase
2.3.2 Entstehungsphase
2.3.3 Existenzphase
2.3.4 Abwicklungsphase
2.4 Abgrenzung zu ähnlichen Konzepten
3 Beispiele für Virtuelle Unternehmen
3.1 Allgemeines Beispiel
3.2 Die Virtuelle Fabrik „Euregio Bodensee“
4 Kritische Würdigung
Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Abgrenzung des virtuellen Unternehmens zu anderen Organisationsformen
Abbildung 2: Vereinfachte Darstellung eines virtuellen Unternehmens
1 Einleitung und Zielsetzung der Arbeit
In den letzten Jahren befindet sich die Weltwirtschaft und damit der Wettbewerb in allen Branchen und allen Märkten in einem grundlegenden Wandel. Vor allem die Wettbewerbsbedingungen sind härter geworden. Die Gründe liegen neben einer allgemeinen Tendenz zur Globalisierung, die durch die Liberalisierung der Märkte und den Ausbau der Kommunikationsinfrastruktur ausgelöst wurde, auch bei der Verkürzung der Technologie- und Produktlebenszyklen sowie der steigenden Komplexität der Produkte und Dienstleistungen. Gleichzeitig ermöglichen Fortschritte in der Informations- und Kommunikationstechnik neue Produkte, Prozessinnovationen, neue Formen der Arbeitsorganisation und Arbeitsteilung.[1] Firmen, die in Ihrer Branche seit Jahren eine Spitzenstellung innehatten, müssen sich auf Grund des veränderten Umfelds wieder neu orientieren und den komplexen Anforderungen stellen. Vor allem Unternehmen, die im Zuliefermarkt wettbewerbsfähig bleiben wollen, müssen über ein breites Know-how verfügen und in der Lage sein, kostengünstig zu produzieren.[2] Traditionelle Organisationsformen vermögen diesen Ansprüchen nicht mehr zu genügen, da sie weder über das Know-how noch über ausreichende Finanzmittel verfügen.[3] In den Vordergrund treten Eigenschaften wie Flexibilität, Schnelligkeit und Kundenorientierung. Einen Lösungsansatz bietet eine neue Organisationsform, die in der Lage ist, die erforderlichen Problemlösungskompetenzen schnell aufzubauen, und auf die wechselnden Kundenpräferenzen mit einer effizienten Leistungserstellung reagieren kann. Diese Kombination von Eigenschaften wird durch das Konzept des virtuellen Unternehmens (VU) realisiert.
Dem Kern der Arbeit – Grundzüge eines VU darzustellen – geht die Begriffsbestimmung des VU voraus. Das Kapitel 2.2 zeigt eine Beschreibung der wichtigsten Merkmale auf, die die Struktur und Besonderheiten eines VU aufweisen. Im weiteren Verlauf werden die vier Lebensphasen eines VU von der Anbahnungsphase bis hin zur Abwicklungsphase dargelegt. Ferner wird im Kapitel 2.4. eine klare Abgrenzung des virtuellen Unternehmensbegriffs zu ähnlichen Konzepten getroffen. Das dritte Kapitel behandelt zunächst ein allgemeines Beispiel eines VU sowie anschließend die Anwendung der virtuellen Organisation am Beispiel der Virtuellen Fabrik (VF) „Euregio Bodensee“. Zum Abschluss wird das Thema einer kritischen Würdigung unterzogen.
2 Das Virtuelle Unternehmen als neue Organisationsform
2.1 Der Begriff des Virtuellen Unternehmens
Der Begriff „virtuell“ (abgeleitet vom lateinischen "virtus"= Tüchtigkeit, Mannhaftigkeit) bedeutet, dass etwas „der Kraft oder Möglichkeit vorhanden, scheinbar“[4] ist. Scholz definiert virtuell als Eigenschaft einer Sache, die zwar nicht real ist, aber doch zumindest der Möglichkeit existiert.[5] Idealtypisch sind demnach VU nicht körperschaftlich organisiert. VU haben keine juristische Persönlichkeit, welche im Außenverhältnis als einheitlicher Anknüpfungspunkt von Rechten und Pflichten dienen könnte.
Für VU existieren in der Literatur mehrere Definitionen. Eine der viel zitiertesten Begriffsbestimmungen ist die von Byrne, in der er VU definiert als „...a temporary network of companies that come together quickly to exploit fast-changing opportunities. In a virtual corporation, companies can share costs, skills and access to global markets, with each partner contributing it’s best at”.[6] Hier wird bereits von einer zielorientierten Zusammenarbeit gesprochen, in der jeder Partner das dazu beiträgt, was er am Besten kann. Zugleich wird auf die Wichtigkeit der Informations- und Kommunikationstechnik in VU hingewiesen. Weiterhin werden Nutzeneffekte wie z. B. das Teilen von Kosten, Fähigkeiten und globalem Marktzugang erwähnt. Für den deutschsprachigen Raum wurde 1995 im Rahmen eines Forschungsprojektes schließlich folgende Definition entworfen: „Ein virtuelles Unternehmen ist eine Kooperationsform rechtlich unabhängiger Unternehmen, Institutionen und/oder Einzelpersonen, die eine Leistung aufgrund eines gemeinsamen Geschäftsverständnisses erbringen. Die kooperierenden Einheiten beteiligen sich an der horizontalen und/oder vertikalen Zusammenarbeit vorrangig mit ihren Kernkompetenzen und wirken bei der Leistungserstellung gegenüber Dritten als ein einheitliches Unternehmen. Dabei wird auf die Institutionalisierung zentraler Funktionen weitgehend verzichtet und der notwendige Kommunikations- und Abstimmungsbedarf durch geeignete Informations- und Kommunikationssysteme realisiert. Das virtuelle Unternehmen besteht solange, bis sein Geschäftszweck erfüllt oder hinfällig geworden ist.“[7]
[...]
[1] vgl. Picot, A., Rohbach, P., Wigand, R. (1996), S. 3
[2] vgl. Gillessen, A. (1999)
[3] Kemmer, G., Gillessen, A. (2000), S. 1
[4] Duden (2000)
[5] vgl. Scholz, Ch. (1997), S.13
[6] Byrne, J., Brand, R., Port, O. (1993), S. 36 ff.
[7] Arnold, O., Härtling, M. (1995), S. 21
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein virtuelles Unternehmen (VU)?
Ein virtuelles Unternehmen ist ein temporäres Netzwerk rechtlich unabhängiger Unternehmen, die ihre Kernkompetenzen bündeln, um gemeinsam eine Marktchance zu nutzen und nach außen wie ein einheitliches Unternehmen auftreten.
Was sind die wichtigsten Merkmale eines virtuellen Unternehmens?
Wichtige Merkmale sind die Konzentration auf Kernkompetenzen, eine vertikale oder horizontale Zusammenarbeit, der Einsatz moderner IuK-Systeme sowie der Verzicht auf eine feste Institutionalisierung.
Welche Lebensphasen durchläuft ein virtuelles Unternehmen?
Ein VU durchläuft vier Phasen: die Anbahnungsphase, die Entstehungsphase, die Existenzphase und schließlich die Abwicklungsphase nach Erreichung des Ziels.
Warum gewinnen virtuelle Unternehmen heute an Bedeutung?
Gründe sind die zunehmende Globalisierung, kürzere Produktlebenszyklen und der Bedarf an hoher Flexibilität und Schnelligkeit, den traditionelle Organisationsformen oft nicht mehr erfüllen können.
Was ist die „Virtuelle Fabrik Euregio Bodensee“?
Es handelt sich um ein praktisches Anwendungsbeispiel eines virtuellen Unternehmensverbundes, das in der Arbeit detailliert vorgestellt wird.
- Arbeit zitieren
- Petra Rudolf (Autor:in), 2003, Virtuelle Unternehmen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/15477