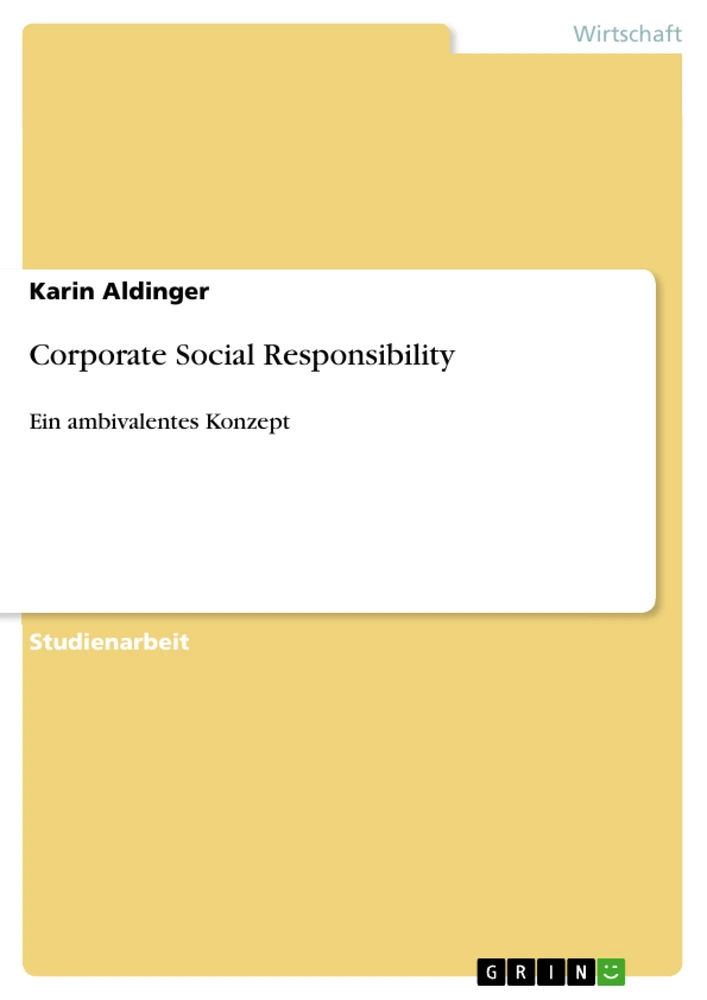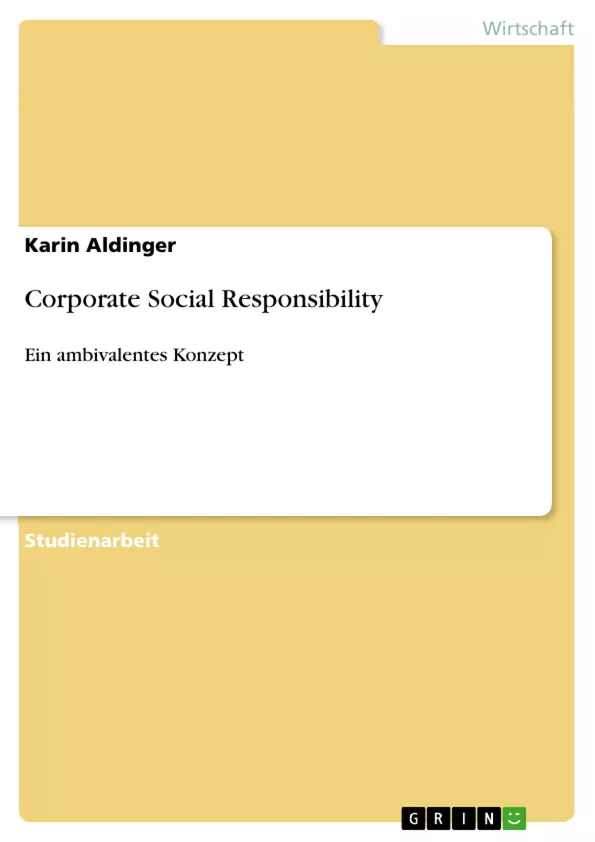Heutzutage führen der gesellschaftliche Wandel, der zunehmende Druck von Stakeholdern oder einfach nur schlaue Marketingstrategien dazu, dass sich Unternehmen ihrer gesellschaftlichen Verantwortung stellen. Ein Konzept, auf das seit den 1950er Jahre zurückgegriffen
wird, ist das sogenannte Corporate Social Responsibility. Wenn wir von Corporate Social Responsibility sprechen bewegen wir uns auf der Ebene der Unternehmensethik, die als ein Teilbereich der Wirtschaftsethik betrachtet werden kann. In der folgenden Arbeit möchte ich die Begrifflichkeiten, wie Wirtschaftsethik, Unternehmensethik sowie Corporate Social Responsibility grob abgrenzen und die Strategien, die dahinter stecken kurz diskutieren.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Wirtschafts- und Unternehmensethik
3 Corporate Social Responsibility
3.1 Grundgedanken des Gebens
3.2 Begriffsbestimmung — Corporate Social Responsibility
3.3 Instrumente der Corporate Social Responsibility
4 Problematisierung: Ethisches Handeln von Unternehmen
5 Diskussion: Corporate Social Responsibily - Ein fragliches Konzept?
6 Literatur
- Quote paper
- M.A. Karin Aldinger (Author), 2010, Corporate Social Responsibility, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/155129