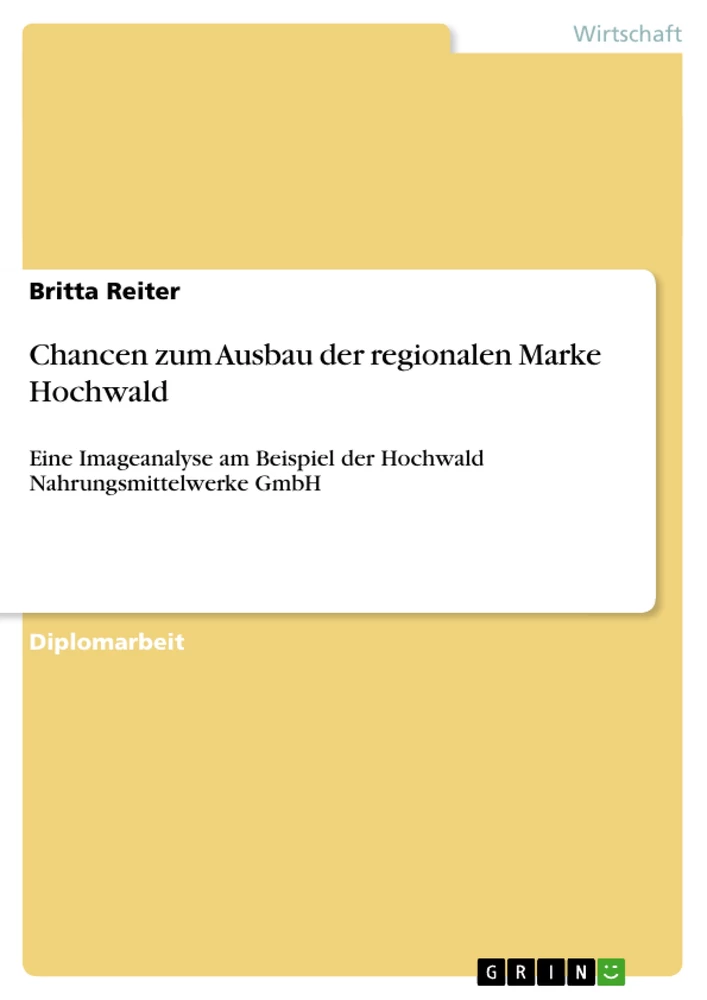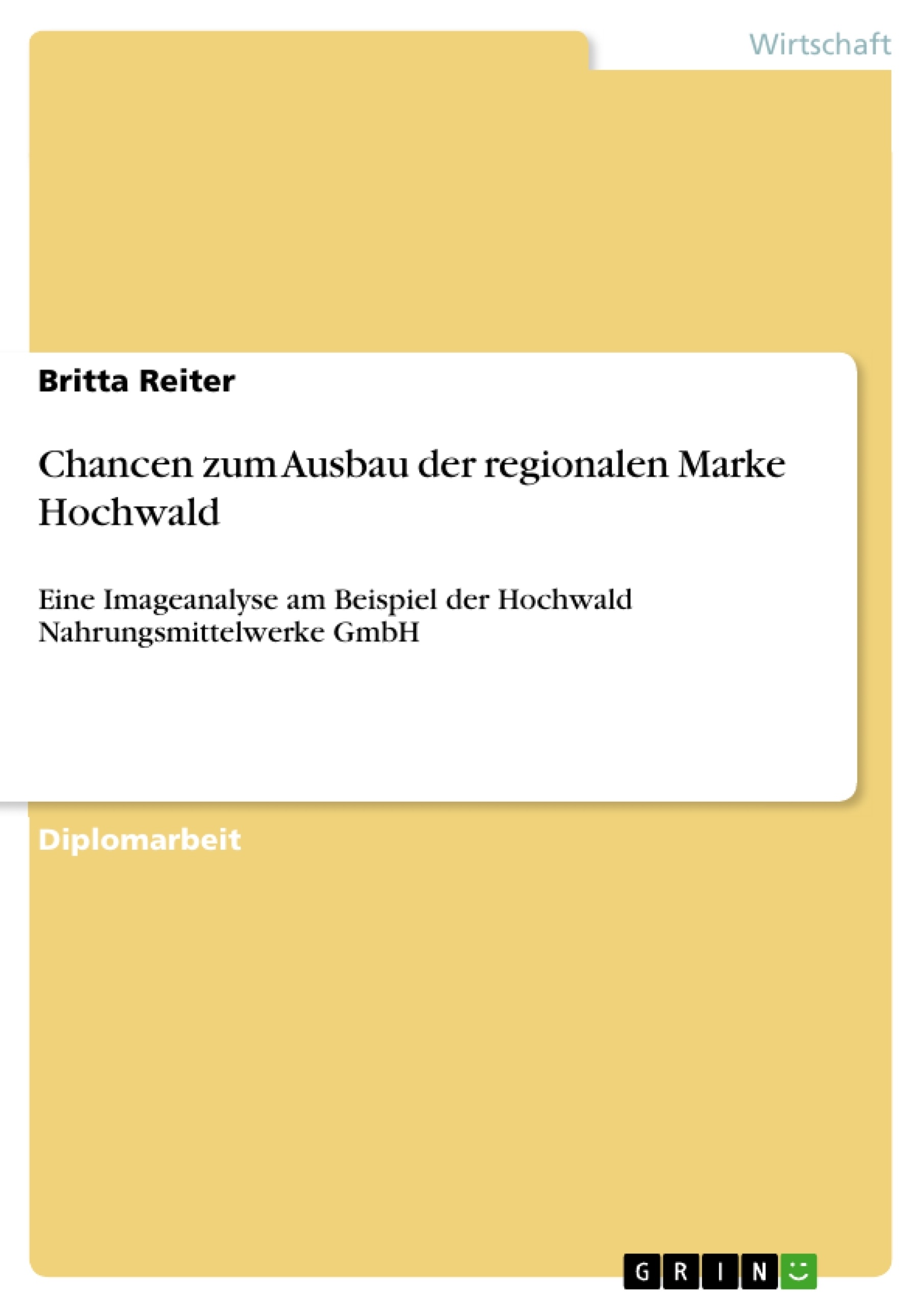Veränderte Bedingungen auf den Gütermärkten haben dazu geführt, dass sich Marken in der heutigen Zeit nicht mehr allein durch physisch-technische Eigenschaften differenzieren lassen. Zahlreiche Faktoren machen den zusätzlichen Aufbau eines Images, d. h. eines subjektiven Bildes, das sich der Konsument aufgrund der ihm verfügbaren Informationen macht, notwendig, um sich gegenüber anderen Marken zu profilieren. Ein solches Markenimage besteht neben den physischen Eigenschaften auch aus Persönlichkeitscharakteristika. Ausschlaggebend für eine solche Entwicklung im Bereich der Markenführung ist zunächst die Angebotsvielfalt an Produkten und Dienstleistungen. Die Zahl der Anbieter auf den Gütermärkten wächst stetig. Hinzu kommt, dass diese zunehmende Menge an verfügbaren Gütern, dadurch dass sich die physikalisch-technischen Eigenschaften mehr und mehr einander angleichen, immer homogener wird. Bedingt durch eine in diesem Bereich stattfindende Nivellierung lassen sich die Produkte nicht mehr anhand ihrer Qualität unterscheiden. Zusammenfassend kann demnach gesagt werden, dass aufgrund gesättigter Märkte die konkret-funktionalen Leistungseigenschaften zunehmend gegenüber den imaginär-symbolischen Produkteigenschaften an Bedeutung verlieren. Diese neuen Herausforderungen machen es notwendig, im Zuge der Markenführung einen emotionalen Zusatznutzen zu schaffen.
Vershofen unterscheidet in seiner klassischen Nutzenlehre zwischen dem Grundnutzen und dem Zusatznutzen. „Danach stiftet jedes Gut zunächst einen Grundnutzen, der aus den wirtschaftlichen, technisch-stofflichen und funktionalen Eigenschaften eines Produktes resultiert. Einen Zusatznutzen erlangt man, wenn dieses […] auch seelisch-geistige Bedürfnisse befriedigt.“ Ein solcher Zusatznutzen kann im Bereich der Markenführung vor allem durch das Konzept der Markenpersönlichkeit erreicht werden. Unter Markenpersönlichkeit wird hierbei „the set of human characteristics associated with a brand” verstanden. Es werden der Marke Persönlichkeitszüge ähnlich denen eines Menschen zugeordnet. So kann Vodka z. B. als eine coole, hippe Person im Alter von ungefähr 25 Jahren charakterisiert werden.
...
Inhaltsverzeichnis
- 1. IMAGEANALYSE AM BEISPIEL DER HOCHWALD NAHRUNGSMITTEL-WERKE GMBH
- 1.1 HERAUSFORDERUNGEN AN DIE MARKENFÜHRUNG
- 1.2 WEITERE VORGEHENSWEISE
- 2. BESCHREIBUNG DES UNTERSUCHUNGSUMFELDES
- 2.1 DAS UNTERNEHMEN HOCHWALD NAHRUNGSMITTEL-WERKE GMBH
- 2.2 KONKURRENZMARKEN DER HOCHWALD NAHRUNGSMITTEL-WERKE GMBH
- 3. MEANS-END-THEORIE ALS UNTERSUCHUNGSHINTERGRUND
- 3.1 GRUNDLAGEN DER MEANS-END-THEORIE
- 3.2 ELEMENTE DER MEANS-END-KETTE
- 3.2.1 Eigenschaft
- 3.2.2 Nutzenkomponente
- 3.2.3 Werthaltung
- 3.3 BEZUG DER MEANS-END-KETTE ZU DEN EINSTELLUNGSMODELLEN
- 3.4 FAZIT UND AUSBLICK
- 4. EINSTELLUNGS- UND IMAGEANALYSE
- 4.1 ABGRENZUNG DER BEGRIFFE „EINSTELLUNG“ UND „IMAGE“
- 4.1.1 Die Drei-Komponenten-Theorie der Einstellung
- 4.1.2 Der Begriff „Image“
- 4.2 EINSTELLUNGS-VERHALTENS-HYPOTHESE
- 4.2.1 Grundlagen der EV-Hypothese
- 4.2.2 Kritik an der EV-Hypothese
- 4.3 VERFAHREN DER EINSTELLUNGSMESSUNG
- 4.3.1 Eindimensionale Messmodelle
- 4.3.2 Multiattributmodelle
- 4.3.2.1 Das Modell von Rosenberg
- 4.3.2.2 Das Modell von Fishbein
- 4.3.2.3 Das Imagedifferential von Trommsdorff
- 4.4 FAZIT UND AUSBLICK
- 5. MARKENEINSTELLUNG
- 5.1 UNTERSCHIEDLICHE PERSPEKTIVEN DES BEGRIFFES „MARKE“
- 5.2 DIMENSIONEN DER MARKENEINSTELLUNG
- 5.2.1 Funktionale Dimension - Markenfähigkeit
- 5.2.2 Markenpersönlichkeit – Brand Personality Scale
- 5.2.3 Markenbeziehungsqualität
- 5.3 FAZIT UND AUSBLICK
- 6. EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG
- 6.1 KONZEPTION UND DURCHFÜHRUNG DER EMPIRISCHEN UNTERSUCHUNG
- 6.1.1 Auswahl und Zusammensetzung der Stichprobe
- 6.1.2 Aufbau des Fragebogens
- 6.1.2.1 Operationalisierung der Dimension Markenfähigkeit
- 6.1.2.2 Operationalisierung der Dimension Markenpersönlichkeit
- 6.1.2.3 Operationalisierung der Dimension Markenbeziehungsqualität
- 6.2 ERGEBNISSE DER EMPIRISCHEN UNTERSUCHUNG
- 6.2.1 Deskription der Ergebnisse
- 6.2.1.1 Markenfähigkeit als funktionale Dimension der Markeneinstellung
- 6.2.1.2 Markenpersönlichkeit als Dimension der Markeneinstellung
- 6.2.1.3 Markenbeziehungsqualität als relationale Dimension der Markeneinstellung
- 6.2.2 Limitation der empirischen Untersuchungen
- 6.3 FAZIT UND AUSBLICK
- 7. IMPLIKATIONEN FÜR DIE HOCHWALD NAHRUNGSMITTEL-WERKE GMBH
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit analysiert das Image der Hochwald Nahrungsmittel-Werke GmbH. Ziel ist es, die Herausforderungen an die Markenführung zu beleuchten und Handlungsempfehlungen für den Ausbau der regionalen Marke zu entwickeln. Die Arbeit stützt sich auf die Means-End-Theorie und untersucht die Einstellungen der Konsumenten.
- Imageanalyse der Hochwald Nahrungsmittel-Werke GmbH
- Anwendbarkeit der Means-End-Theorie auf die Markenführung
- Analyse der Dimensionen der Markeneinstellung (Markenfähigkeit, Markenpersönlichkeit, Markenbeziehungsqualität)
- Empirische Untersuchung der Konsumentenmeinungen
- Ableitung von Implikationen für die Markenstrategie von Hochwald
Zusammenfassung der Kapitel
1. IMAGEANALYSE AM BEISPIEL DER HOCHWALD NAHRUNGSMITTEL-WERKE GMBH: Dieses einführende Kapitel beschreibt die Problemstellung und den Forschungsansatz der Arbeit. Es benennt die Herausforderungen der Markenführung im Kontext der regionalen Verankerung von Hochwald und skizziert den weiteren Aufbau der Untersuchung.
2. BESCHREIBUNG DES UNTERSUCHUNGSUMFELDES: Dieses Kapitel charakterisiert das Unternehmen Hochwald Nahrungsmittel-Werke GmbH und beschreibt den relevanten Wettbewerb. Es liefert den notwendigen Kontext für die anschließende Image- und Einstellungsanalyse.
3. MEANS-END-THEORIE ALS UNTERSUCHUNGSHINTERGRUND: Hier werden die Grundlagen der Means-End-Theorie erläutert, ein wichtiges theoretisches Fundament der Arbeit. Es wird auf die Elemente der Means-End-Kette (Eigenschaft, Nutzenkomponente, Werthaltung) eingegangen und deren Bezug zu gängigen Einstellungsmodellen hergestellt. Das Kapitel dient der methodischen Fundierung der späteren empirischen Untersuchung.
4. EINSTELLUNGS- UND IMAGEANALYSE: Dieses Kapitel befasst sich mit den Begriffen „Einstellung“ und „Image“ und differenziert diese klar voneinander ab. Es werden verschiedene Modelle der Einstellungs- und Imagemessung vorgestellt, darunter die Drei-Komponenten-Theorie der Einstellung und Multiattributmodelle von Rosenberg, Fishbein und Trommsdorff. Die Einstellungs-Verhaltens-Hypothese wird kritisch diskutiert.
5. MARKENEINSTELLUNG: Dieses Kapitel analysiert verschiedene Perspektiven des Markenbegriffs und differenziert die Dimensionen der Markeneinstellung: Markenfähigkeit, Markenpersönlichkeit und Markenbeziehungsqualität. Diese bilden die Basis für die spätere empirische Erhebung.
6. EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG: In diesem zentralen Kapitel wird die empirische Untersuchung detailliert beschrieben. Es beinhaltet die Konzeption und Durchführung, die Auswahl der Stichprobe, den Aufbau des Fragebogens und die Operationalisierung der relevanten Dimensionen der Markeneinstellung. Die Ergebnisse der Untersuchung werden deskriptiv dargestellt und kritisch diskutiert, inklusive einer Reflexion der methodischen Limitationen.
7. IMPLIKATIONEN FÜR DIE HOCHWALD NAHRUNGSMITTEL-WERKE GMBH: Dieses Kapitel, das vor der Schlussfolgerung steht, leitet aus den gewonnenen Erkenntnissen Implikationen für die Hochwald Nahrungsmittel-Werke GmbH ab. Es fokussiert sich auf konkrete Handlungsempfehlungen, die auf den Ergebnissen der empirischen Untersuchung basieren.
Schlüsselwörter
Hochwald Nahrungsmittel-Werke GmbH, Markenführung, Imageanalyse, Means-End-Theorie, Markeneinstellung, regionale Marke, Konsumentenverhalten, empirische Untersuchung, Markenfähigkeit, Markenpersönlichkeit, Markenbeziehungsqualität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Imageanalyse der Hochwald Nahrungsmittel-Werke GmbH
Was ist das Thema der Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit analysiert das Image der Hochwald Nahrungsmittel-Werke GmbH und untersucht die Herausforderungen an deren Markenführung. Ziel ist die Entwicklung von Handlungsempfehlungen für den Ausbau der regionalen Marke, basierend auf der Means-End-Theorie und der Analyse von Konsumenteneinstellungen.
Welche Methoden werden in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit stützt sich auf die Means-End-Theorie, ein wichtiges Instrument zur Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Produkteigenschaften, Konsumentenbedürfnissen und Werthaltungen. Es werden verschiedene Modelle der Einstellungs- und Imagemessung eingesetzt, darunter die Drei-Komponenten-Theorie der Einstellung und Multiattributmodelle (Rosenberg, Fishbein, Trommsdorff). Die zentrale Methode ist eine empirische Untersuchung mit Fragebögen.
Welche Aspekte der Markeneinstellung werden untersucht?
Die Arbeit untersucht drei Dimensionen der Markeneinstellung: Markenfähigkeit (funktionale Dimension), Markenpersönlichkeit und Markenbeziehungsqualität (relationale Dimension). Diese Dimensionen werden im Rahmen der empirischen Untersuchung operationalisiert und analysiert.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Kapitel 1 führt in die Problemstellung ein; Kapitel 2 beschreibt das Unternehmen und den Wettbewerb; Kapitel 3 erläutert die Means-End-Theorie; Kapitel 4 behandelt die Einstellungs- und Imageanalyse; Kapitel 5 analysiert die Dimensionen der Markeneinstellung; Kapitel 6 präsentiert die empirische Untersuchung (inkl. Methodik, Ergebnisse und Limitationen); und Kapitel 7 leitet Implikationen für Hochwald ab.
Welche Ergebnisse liefert die empirische Untersuchung?
Die empirische Untersuchung liefert deskriptive Ergebnisse zu den drei Dimensionen der Markeneinstellung (Markenfähigkeit, Markenpersönlichkeit, Markenbeziehungsqualität). Diese Ergebnisse werden detailliert dargestellt und hinsichtlich methodischer Limitationen kritisch reflektiert. Die Ergebnisse bilden die Grundlage für die Handlungsempfehlungen in Kapitel 7.
Wer ist die Zielgruppe der Arbeit?
Die Arbeit richtet sich primär an die Hochwald Nahrungsmittel-Werke GmbH und an Personen, die sich mit Markenführung, Imageanalyse und Konsumentenverhalten im Kontext regionaler Marken auseinandersetzen. Die akademische Zielgruppe umfasst Studierende und Wissenschaftler im Bereich Marketing und Marktforschung.
Welche konkreten Handlungsempfehlungen werden für Hochwald gegeben?
Die konkreten Handlungsempfehlungen für Hochwald basieren auf den Ergebnissen der empirischen Untersuchung und werden in Kapitel 7 detailliert dargelegt. Sie fokussieren auf Maßnahmen zur Stärkung der regionalen Marke und zur Verbesserung der Konsumenteneinstellungen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Hochwald Nahrungsmittel-Werke GmbH, Markenführung, Imageanalyse, Means-End-Theorie, Markeneinstellung, regionale Marke, Konsumentenverhalten, empirische Untersuchung, Markenfähigkeit, Markenpersönlichkeit, Markenbeziehungsqualität.
- Citar trabajo
- Britta Reiter (Autor), 2004, Chancen zum Ausbau der regionalen Marke Hochwald, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/155171