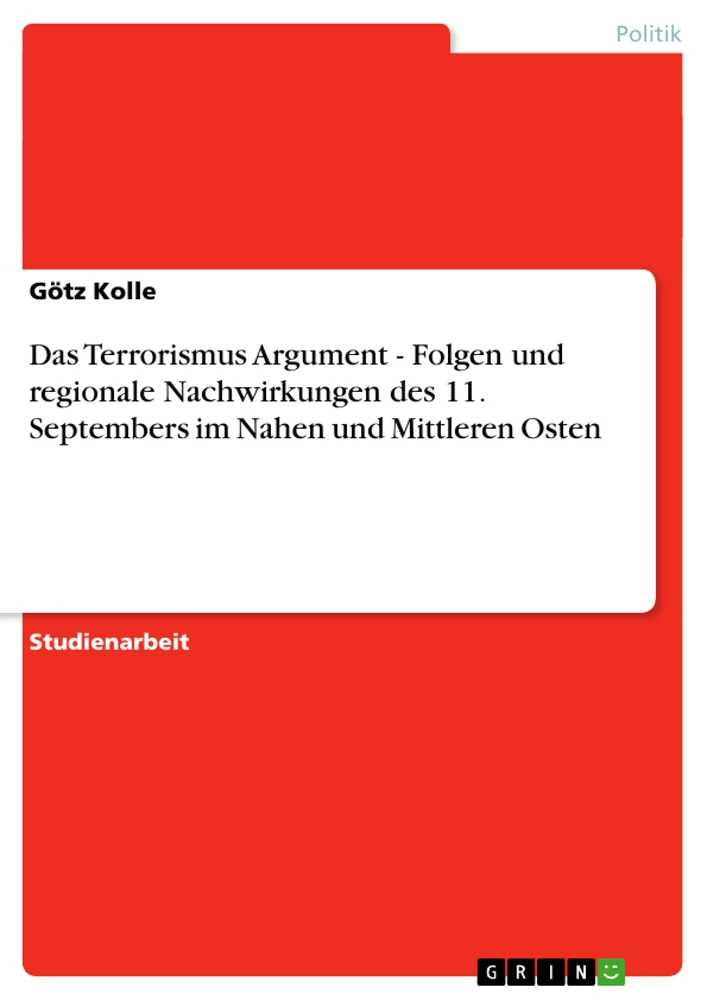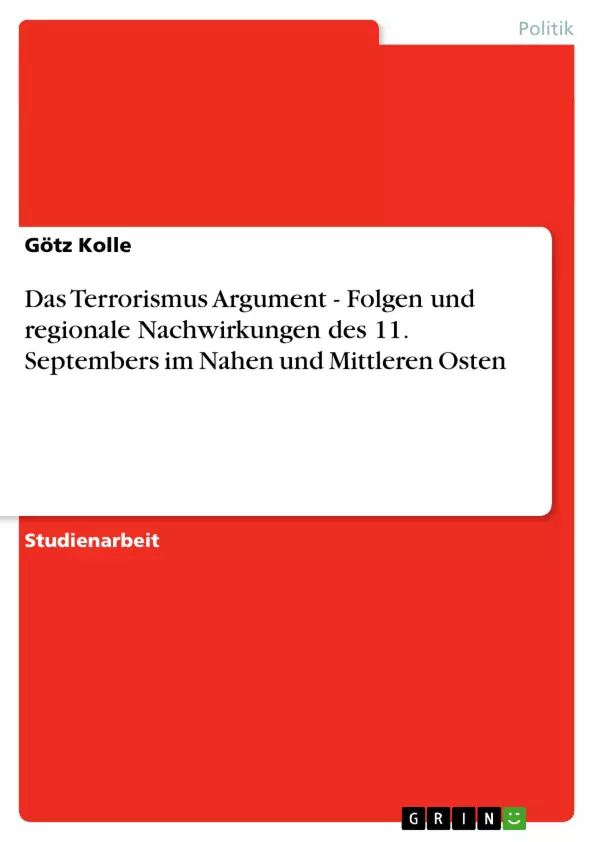In der Arbeit wird dargestellt, daß:
1. "Terrorismus" ein sehr breiter, ambivalenter und damit unklarer Begriff ist
2. Nach dem 11. September eine verschiedenartige Interpretation und Zuschreibung von "Terrorismus" erfolgte (am Beispiel der USA, Israels und arabischen Regimen).
3. Damit höchst unterschiedliche politische Interessen und Maßnahmen legitimiert werden konnten.
Drei Konflikte prägen die politische Situation im Nahen und Mittleren Osten heute in besonderem Maße:
1. Der Konflikt zwischen dem Irak und den USA (und ihren Unterstützern).
2. Der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern
3. Der Konflikt zwischen Regimen arabischer Staaten und ihrer nationalen islamistischen Opposition.
Alle drei Konfliktlinien sind nicht neu. Aber in allen Fällen wurden die Auseinandersetzungen nach dem 11. September zwischen den Konfliktparteien verschärft. Interessanter Weise beruft sich jeweils eine der Konfliktparteien auf den "Kampf gegen den Terror".
Die USA, Israel und auch die Regime arabischer Staaten wie Ägypten, Jemen oder Algerien kämpfen gegen den Terrorismus in der Region, aber alle bekämpften andere Terroristen. Israel zieht vor allem gegen die Hamas und die Hisbolla in den Kampf, Ägypten gegen Al Jihad; Jemens Regierung macht Front gegen die Islah-Partei, der Iran ruft zur Opposition gegen den "israelischen Staatsterror" auf und selbst die USA nutzen Ihre gesamten Kräfte, um nach dem Kampf gegen die Taliban gegen ein Regime, den Irak, vorzugehen.
Ist das die neue Politik nach dem 11. September? Oder werden hier nur alte Rechnungen unter neuem Vorwand beglichen?
Die hier dargelegte These geht davon aus, daß die wesentlichen politischen Ziele und Interessenlagen, die nach dem 11. September mit dem Schlagwort "Terrorismusbekämpfung" begründet wurden, bereits vor den verheerenden Anschlägen erwägt und von mindestens einem Teil der Administration der einzelnen Staaten bereits unterstützt wurden. Erst aber die Anschläge auf New York und Washington, vor allem aber die darauf erfolgte Ausrufung des "Krieges gegen den Terror" haben eine breite, international akzeptierte Legitimationsgrundlage geschaffen und damit die konsequente und oft militärische Durchsetzung dieser (alten) Interessen ermöglicht.
Die Hinterfragung des Terrorismusarguments soll letztlich dazu dienen den Schleier der öffentlichen Argumentation zu lüften und den Blick auf reale Interessenlagen freizugeben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Probleme bei der Definition von "Terrorismus"
- Definitionsmerkmale des Phänomens "Terrorismus"
- Die Vielfalt des Terrorbegriffs
- Der Kampf gegen ein Regime - die Vereinigten Staaten von Amerika
- Die Anti-Terrordokrin
- Eine neue "allgemeine" Feinddefinition
- Der Irak als terroristische Bedrohung
- Der Kampf gegen nationalistische Bewegungen - Israel
- Der Kampf gegen die Opposition - Die arabischen Staaten
- Undemokratische Menschenrechtsverletzungen vor 2001
- Anti-Terrorkampf nach dem 11. September
- Resümee
- Keine gemeinsame Definition von "Terrorismus"
- Instrumentale Verallgemeinerung
- Quellen
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Folgen und regionalen Nachwirkungen des 11. Septembers im Nahen und Mittleren Osten. Sie analysiert, wie das "Terrorismus-Argument" von verschiedenen Akteuren eingesetzt wird, um politische Interessen durchzusetzen. Der Fokus liegt dabei auf den Vereinigten Staaten, Israel und den arabischen Staaten.
- Die vielschichtige und komplexe Definition von "Terrorismus"
- Die Instrumentalisierung des "Terrorismus-Arguments" durch verschiedene Akteure
- Die Auswirkungen des 11. Septembers auf die politischen Konflikte in der Region
- Die Rolle des "Krieges gegen den Terror" in der Legitimation von politischen Interessen
- Die Frage nach der Verfolgung realer Interessen unter dem Deckmantel der "Terrorismusbekämpfung"
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit dar und beleuchtet die drei zentralen Konflikte im Nahen und Mittleren Osten: den Konflikt zwischen Irak und USA, den Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern sowie den Konflikt zwischen arabischen Regimen und islamistischer Opposition. Dabei wird die besondere Relevanz des "Kampfes gegen den Terror" im Kontext der verschärften Auseinandersetzungen nach dem 11. September hervorgehoben.
Das erste Kapitel befasst sich mit den Schwierigkeiten bei der Definition von "Terrorismus". Es werden verschiedene Definitionsmerkmale und die Vielfältigkeit des Begriffs diskutiert, wobei auch die politische Instrumentalisierung des Begriffs hervorgehoben wird.
Im zweiten Kapitel wird die Anti-Terrordoktrin der USA nach dem 11. September analysiert. Die Arbeit zeigt auf, wie die USA den "Terrorismus-Argument" verwenden, um ihre eigenen Interessen in der Region durchzusetzen und den Irak als terroristische Bedrohung darzustellen.
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit dem Kampf Israels gegen nationalistische Bewegungen, während das vierte Kapitel den Konflikt zwischen arabischen Regimen und ihrer Opposition beleuchtet. Hier wird der Fokus auf die undemokratischen Menschenrechtsverletzungen vor 2001 und die Instrumentalisierung des Anti-Terrorkampfes nach dem 11. September gelegt.
Das Resümee fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen und unterstreicht die fehlende gemeinsame Definition von "Terrorismus" sowie die instrumentale Verallgemeinerung des Begriffs.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Begriffen wie "Terrorismus", "Anti-Terrordoktrin", "Terrorismusbekämpfung", "Politische Interessen", "Regionale Konflikte", "Islamistische Opposition", "USA", "Israel", "Arabische Staaten", "11. September", "Legitimation", "Instrumentalisierung", "Feinddefinition", "Irak", "PLO", "Hamas", "Hisbollah", "Al Jihad", "Islah-Partei", "Iran", "Staatsterror".
Häufig gestellte Fragen
Warum ist die Definition von „Terrorismus“ so schwierig?
Der Begriff ist ambivalent und unklar, was dazu führt, dass verschiedene Akteure ihn unterschiedlich interpretieren, um eigene politische Interessen zu legitimieren.
Wie nutzten die USA den 11. September für ihre Außenpolitik?
Durch die Ausrufung des „Krieges gegen den Terror“ schufen die USA eine internationale Legitimationsgrundlage für militärische Interventionen, etwa im Irak.
Welche Konfliktlinien prägen den Nahen Osten nach 2001?
Zentrale Konflikte sind der zwischen den USA und dem Irak, der Israel-Palästina-Konflikt sowie der Kampf arabischer Regime gegen die islamistische Opposition.
Wie instrumentalisiert Israel das Terrorismus-Argument?
Israel nutzt das Argument vor allem im Kampf gegen nationalistische Bewegungen wie die Hamas oder die Hisbollah.
Was ist die Hauptthese dieser Arbeit zum Anti-Terrorkampf?
Die These besagt, dass der 11. September oft als Vorwand genutzt wurde, um bereits vorher bestehende politische Ziele und Interessen militärisch durchzusetzen.
- Quote paper
- Götz Kolle (Author), 2003, Das Terrorismus Argument - Folgen und regionale Nachwirkungen des 11. Septembers im Nahen und Mittleren Osten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/15610