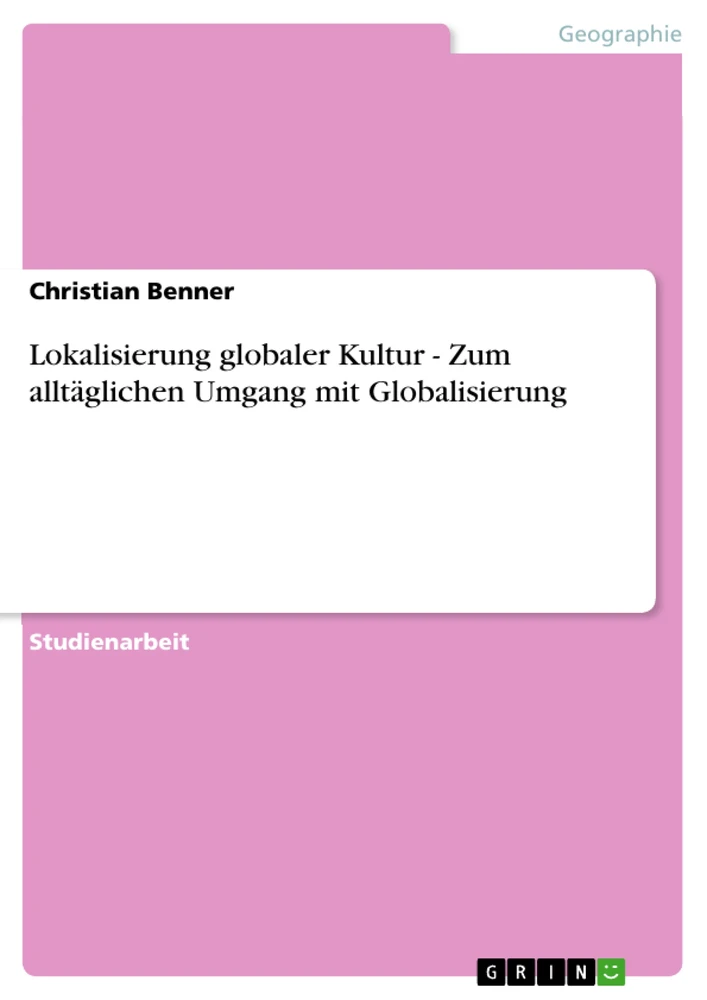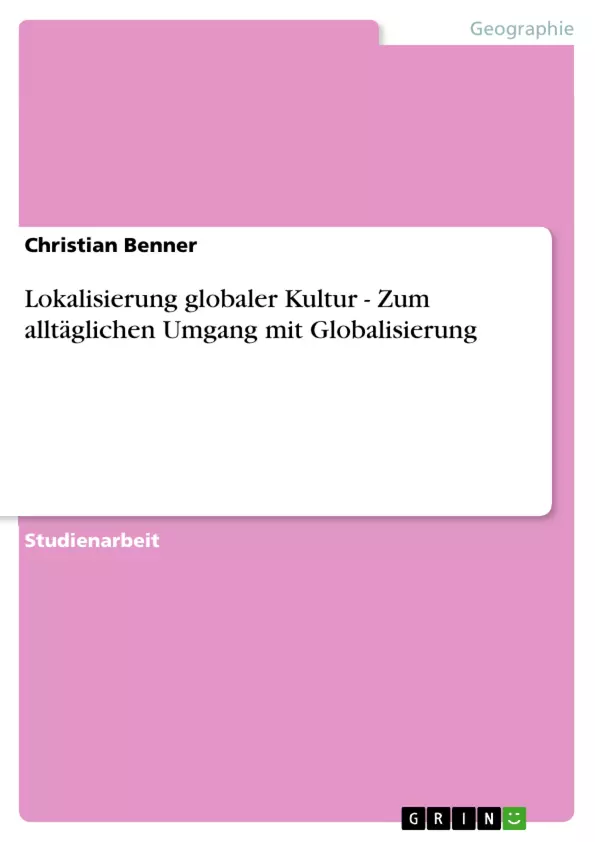»Die Herausbildung einer Weltliteratur, einer Weltmusik und einer Weltkunst im 19. und 20. Jahrhundert
sind Vorläufer der kulturellen Globalisierung, die heute unser Leben prägt. Es handelt sich dabei um
Internationalisierungsprozesse, die einen kulturellen Teilbereich, die Künste, betrafen - und auch hier nur
einen Teil. Der zentrale Unterschied früherer und heutiger Formen kultureller Globalisierung besteht
darin, dass sie heute weit über die Künste hinaus reichen und die Alltagskulturen sowie teilweise auch die
mit Kultur und Kunst verbundenen Werthaltungen und Bedeutungen umfassen. Zudem zeichnet sich der
gegenwärtige durch die Globalisierung bewirkte kulturelle Wandel durch eine bis in die letzten Zipfel der
Erde reichende Ausbreitung aus sowie eine ungeheure Geschwindigkeit und eine gesteigerte Intensität,
mit der die Kulturen in Kontakt stehen, sich austauschen, vermischen und neue Kulturen hervorbringen.
Diese neue Qualität kultureller Globalisierung geht vor allem auf drei zentrale gesellschaftliche Veränderungen
zurück, die alle Länder, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß prägen: die Herausbildung
einer Weltgesellschaft durch die ökonomische Globalisierung, die weltweiten Migrationsprozesse und die
Medienentwicklung (APuZ 12/2002).«
Inhaltsverzeichnis (1. Teil)
- Einleitung oder »Was die kulturelle Globalisierung mit Graffiti zu tun hat...«
- Globalisierung als Synonym für globale Vernetzungsprozesse
- Technisierung & Medialisierung als die Wegbereiter der Globalisierung
- Globalisierte & regionalisierte Kultur und Identitätsbildung
- Fremdheit & Differenz als wesentliche Elemente der Identitätsbildung
- Des Sprayers Herz schlägt höher
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit der Lokalisierung globaler Ideen und Gedanken im lokalen bis regionalen Bereich durch das Medium Graffiti. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der kulturellen Globalisierung, ihrer Entwicklungsgeschichte und den globalen Prozessen, die zu Globalität, kultureller Identitätsbildung und der Verbreitung von global existierenden Ideen, Gedanken und Wertvorstellungen führen.
- Die Bedeutung der kulturellen Globalisierung und ihrer Auswirkungen auf die heutige Gesellschaft.
- Die Rolle der Kommunikationsmedien als Verbreitungs- und Diffusionsmedien von Ideen und Gedanken in der Globalisierung.
- Die Verbindung zwischen globalen und lokalen Prozessen in der kulturellen Identitätsbildung.
- Die Bedeutung von Fremdheit und Differenz als wesentliche Elemente der Identitätsbildung.
- Die Bedeutung von Graffiti als Medium der Meinungsäußerung und der lokalen Verbreitung globaler Gedanken.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung oder »Was die kulturelle Globalisierung mit Graffiti zu tun hat...«: Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und stellt die zentrale Fragestellung der Lokalisierung globaler Kultur durch Graffiti vor. Dabei wird die Bedeutung der kulturellen Globalisierung und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft beleuchtet.
- Globalisierung als Synonym für globale Vernetzungsprozesse: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Begriff der Globalisierung und dessen Bedeutung in der heutigen Gesellschaft. Es werden verschiedene Definitionen und Perspektiven auf Globalisierung vorgestellt, sowie deren Auswirkungen auf verschiedene gesellschaftliche Bereiche.
- Technisierung & Medialisierung als die Wegbereiter der Globalisierung: Hier wird die entscheidende Rolle der Kommunikationsmedien in der Globalisierung hervorgehoben. Die Entwicklung der Kommunikationstechnologie wird im historischen Kontext beleuchtet und deren Einfluss auf die Verbreitung von Ideen und Gedanken weltweit untersucht.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit sind Globalisierung, Kultur, Identitätsbildung, Graffiti, Kommunikation, Medien, Fremdheit, Differenz, Lokalisierung und Vernetzungsprozesse. Sie repräsentieren die Kernthemen der Untersuchung und bilden den Rahmen für die Analyse der Lokalisierung globaler Kultur durch Graffiti.
Häufig gestellte Fragen
Was hat Graffiti mit kultureller Globalisierung zu tun?
Graffiti dient als Medium, um globale Ideen und ästhetische Gedanken im lokalen Raum zu verankern und auszudrücken.
Was ist der Unterschied zwischen früherer und heutiger Globalisierung?
Heutige Globalisierung reicht weit über die Künste hinaus und umfasst Alltagskulturen, Werthaltungen und eine extreme Geschwindigkeit des Austauschs.
Welche Rolle spielen Medien in diesem Prozess?
Kommunikationsmedien fungieren als Wegbereiter, die globale Vernetzungsprozesse erst ermöglichen und Ideen weltweit diffundieren lassen.
Wie beeinflusst Globalisierung die Identitätsbildung?
Identität bildet sich heute im Spannungsfeld zwischen globalen Einflüssen und regionaler Kultur, wobei Fremdheit und Differenz wesentliche Elemente sind.
Was bedeutet "Lokalisierung" in diesem Kontext?
Es beschreibt den Vorgang, bei dem globale Trends oder Gedanken aufgegriffen und an die spezifischen Bedingungen und Ausdrucksformen vor Ort angepasst werden.
- Arbeit zitieren
- Christian Benner (Autor:in), 2010, Lokalisierung globaler Kultur - Zum alltäglichen Umgang mit Globalisierung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/156497