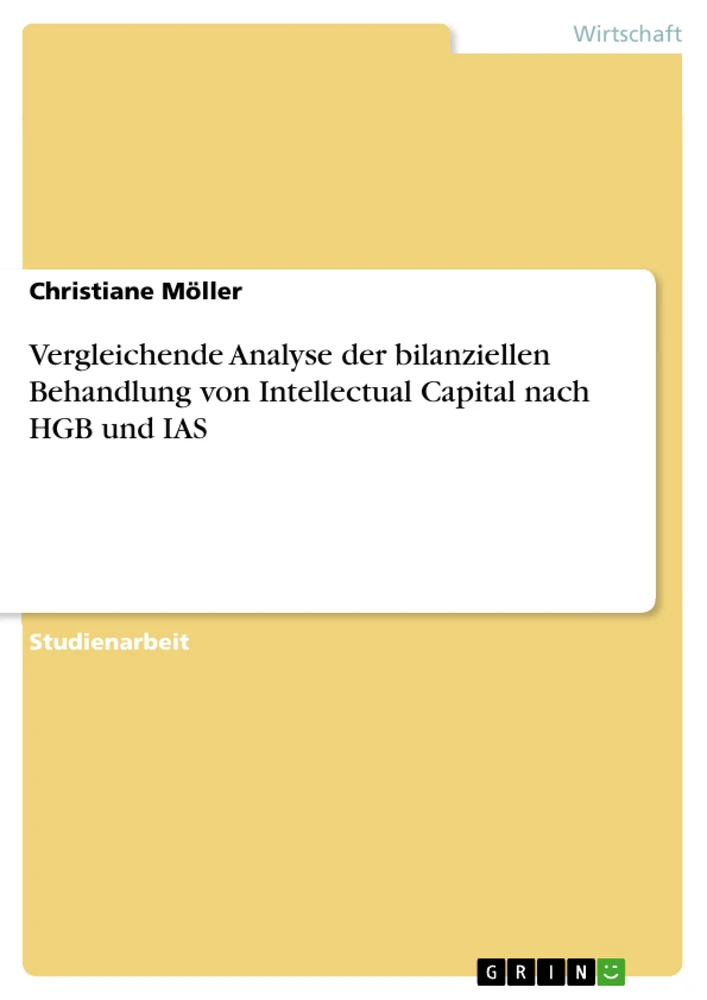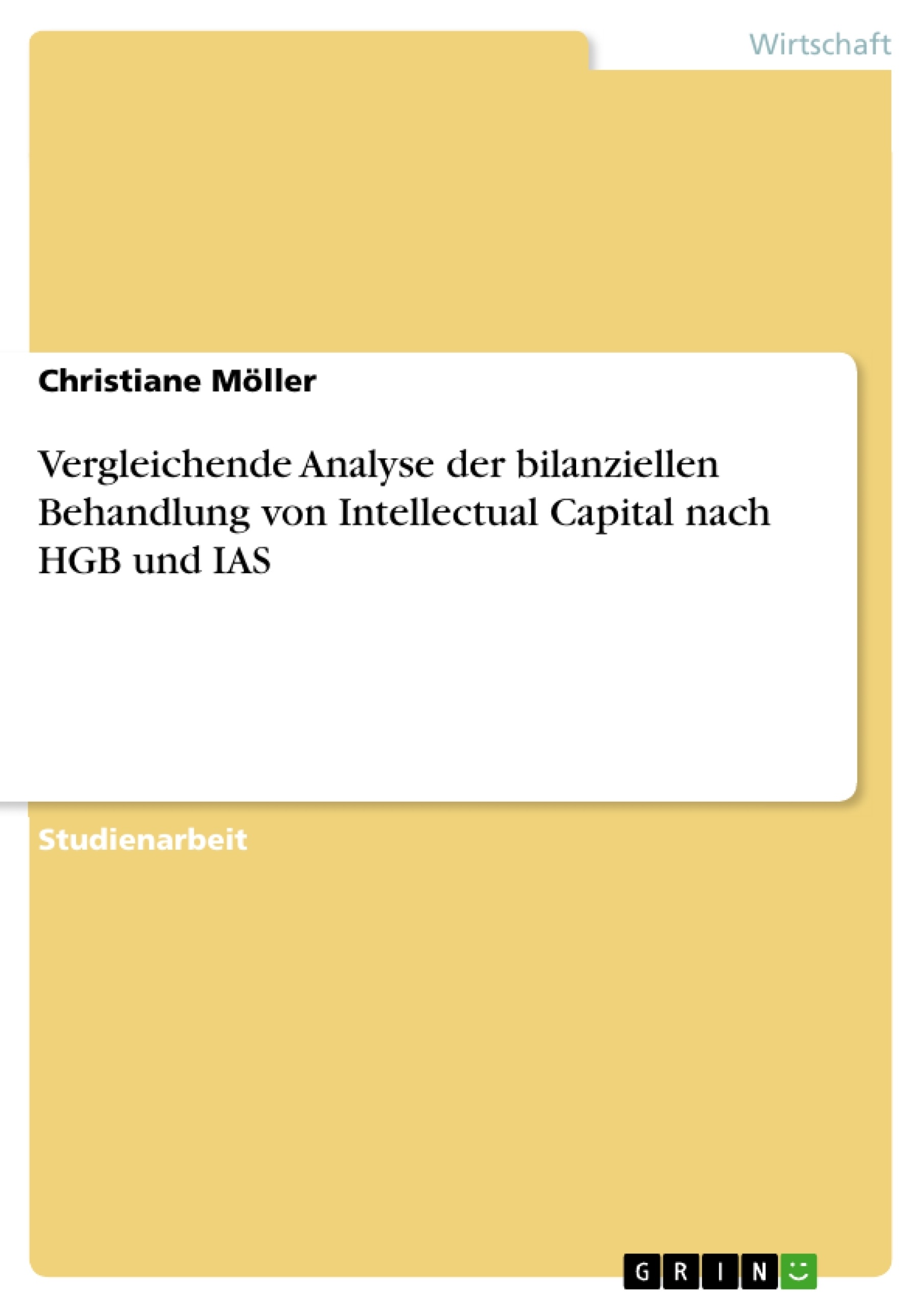Der Marktwert eines Unternehmens übersteigt in manchen Fällen den Buchwert um ein Vielfaches. Als Beispiel seien hier die Aktien von Microsoft erwähnt, die 1995 im Durchschnitt einen Börsenkurs von 70 US-Dollar hatten, obwohl ihr Nettobuchwert bzw. ihr Eigenkapitalwert nur 7 US-Dollar betrug. Doch wie entsteht diese Differenz?
Warum sind Anleger bereit, Aktien für einen höheren Preis zu kaufen, obwohl der ausgewiesene Eigenkapitalwert viel niedriger ist?
Im Jahresabschluss finden sich entweder keine oder nur unzureichende Informationen warum der Marktwert höher als der Buchwert eines Unternehmens ist. Der Grund hierfür, kann der Wandel von einer Industriegesellschaft hin zu einer Informations- und Dienstleistungsgesellschaft sein. Dieser Wandel macht den ökonomischen Unternehmenserfolg nicht mehr allein von materiellen Vermögenswerten, sondern zunehmend von immateriellen Vermögens-werten, sowie von Intellectual Capital abhängig. Die traditionellen Rechnungslegungsvorschriften bieten aber nicht den Raum um diese Entwicklung abzubilden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsabgrenzung und Definition Intellectual Capital
- Problemstellung und Zielsetzung
- Gang der Untersuchung
- Intellectual Capital
- Wirtschaftliche und Rechtliche Rahmenbedingungen
- Anspruchsgruppen und Ziele
- Vergleichende Analyse von Intellectual Capital nach HGB und IAS
- Ansatzkriterien nach HGB und IAS
- Bilanzielle Behandlung von Intellectual Capital nach HGB und IAS
- Kritische Würdigung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der vergleichenden Analyse der bilanziellen Behandlung von Intellectual Capital nach HGB und IAS. Ziel ist es, die Möglichkeiten und Grenzen der Bilanzierung von Intellectual Capital aufzuzeigen.
- Begriffsdefinition und Abgrenzung von Intellectual Capital
- Wirtschaftliche und rechtliche Rahmenbedingungen von Intellectual Capital
- Anspruchsgruppen und deren Interessen im Zusammenhang mit Intellectual Capital
- Ansatzkriterien von immateriellen Vermögenswerten und Intellectual Capital nach HGB und IAS
- Bilanzielle Behandlung von Intellectual Capital nach HGB und IAS
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit befasst sich mit der Definition und Abgrenzung des Begriffs Intellectual Capital. Es werden verschiedene Ansätze von Autoren wie Edvinsson und Sveiby vorgestellt, die die Differenz zwischen Marktwert und Buchwert eines Unternehmens als Indikator für Intellectual Capital heranziehen.
Kapitel 2 untersucht die wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen von Intellectual Capital. Es werden verschiedene Strukturansätze von Edvinsson und Sveiby betrachtet, die verschiedene immaterielle Vermögenswerte wie Wissen, Image und Beziehungen als Bestandteile von Intellectual Capital identifizieren.
Kapitel 3 analysiert die Ansatzkriterien und die bilanziellen Behandlungsmöglichkeiten von Intellectual Capital nach HGB und IAS. Es wird deutlich, dass die traditionellen Rechnungslegungsvorschriften die Berücksichtigung von immateriellen Vermögenswerten und Intellectual Capital nur unzureichend abbilden können.
Schlüsselwörter
Intellectual Capital, Immaterielle Vermögenswerte, Marktwert, Buchwert, HGB, IAS, Bilanzierung, Rechnungslegung, Unternehmensbewertung, Anspruchsgruppen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Intellectual Capital?
Es bezeichnet die immateriellen Vermögenswerte eines Unternehmens, wie Wissen, Kundenbeziehungen, Markenwert und Innovationskraft, die oft nicht in der Bilanz erscheinen.
Warum weicht der Marktwert oft stark vom Buchwert ab?
Anleger bewerten das Potenzial des Intellectual Capital (z.B. bei Softwarefirmen) höher als die physischen Maschinen oder Gebäude, die im Buchwert nach HGB/IAS abgebildet sind.
Wie unterscheidet sich die Bilanzierung nach HGB und IAS?
Die Arbeit analysiert die strengen Ansatzkriterien beider Systeme und zeigt auf, dass traditionelle Regeln kaum Raum für die Aktivierung von selbst geschaffenem Intellectual Capital bieten.
Was sind die Strukturansätze nach Edvinsson und Sveiby?
Diese Modelle teilen Intellectual Capital in Humankapital, Strukturkapital und Beziehungskapital auf, um es messbar und steuerbar zu machen.
Können immaterielle Werte im Jahresabschluss ausreichend dargestellt werden?
Das Fazit der Arbeit ist kritisch: Die aktuellen Rechnungslegungsvorschriften hinken dem Wandel zur Informationsgesellschaft hinterher und bieten Anlegern oft unzureichende Informationen.
- Arbeit zitieren
- Christiane Möller (Autor:in), 2007, Vergleichende Analyse der bilanziellen Behandlung von Intellectual Capital nach HGB und IAS, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/156719