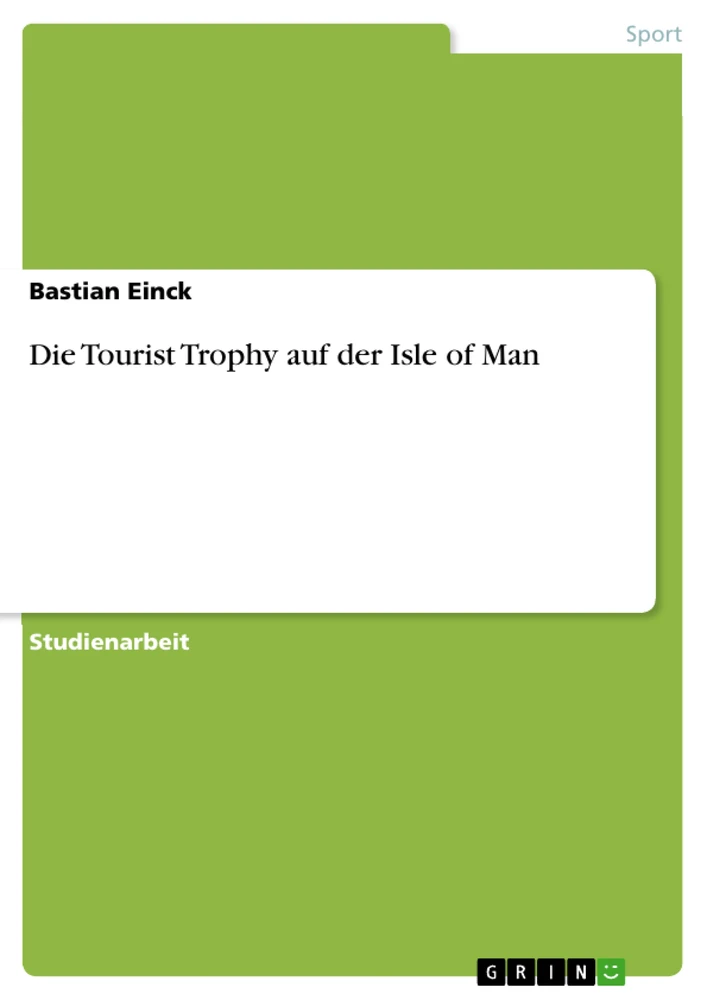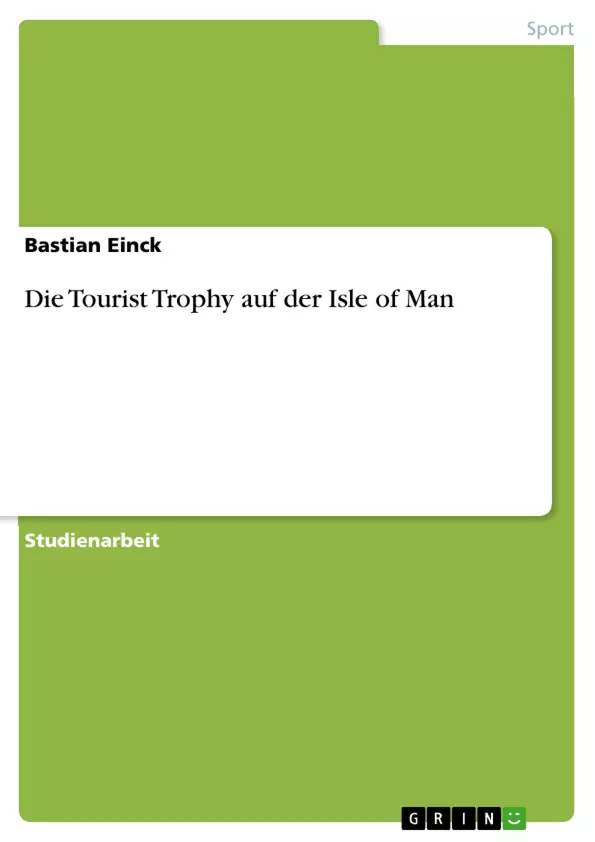1. Einleitung
Im Sommersemester 2008 haben wir im Rahmen des Seminars „Tourismus und
regionale Sportkulturen in Europa“ verschiedene eigenständige Sportarten und
Ausdifferenzierungen von bekannten Sportarten kennengelernt, die in einem engen
Bezug zu der Region stehen, in der sie praktiziert und als Kultur gepflegt werden.
Der Begriff Kultur bezeichnet in Wissenschaft und Alltagssprache sehr
unterschiedliche Phänomene und ist stets in Zusammenhang mit Zivilisation zu
erörtern. Tylor beschrieb Kultur bereits 1870 „als das komplette Ganze, das Wissen,
Überzeugungen, Kunst, Gesetzte, Moral, Tradition und jede andere Fertigkeit und
Gewohnheit einschließt, die Menschen einer Gesellschaft erwerben“ (Nünning,
2005: 106f). In einer weit gefassten Definition kann unter Kultur somit alles
verstanden werden, was vom Menschen gemacht ist (Nünning, 2005: 107f).
Unter den einschränkenden Begriff ‚Sportkultur‘ fallen also alle kulturellen
Phänomene und Praktiken, die mit Bewegung, Spiel und Sport zu tun haben. Wir
haben uns in diesem Zusammenhang mit der Tourist Trophy auf der Isle of Man
beschäftigt, einem in dieser Form einzigartigen Motorradrennen mit langer Tradition.
In der vorliegenden Hausarbeit möchten wir die Besonderheiten der Tourist Trophy
darstellen. Dazu befassen wir uns zunächst mit der Insel Man und ihren Besonderheiten,
um danach besonders die Geschichte der Tourist Trophy darzustellen.
Im zweiten Teil befassen wir uns mit der Mythologie, die sich um das „gefährlichste
Rennen der Welt“ (Limmert, 1985: 158) entwickelt hat. Außerdem stellen wir den
Zusammenhang des Tourismus und der Tourist Trophy auf der Isle of Man dar, um
abschließend eine Einordnung der Tourist Trophy in das Schema der regionalen
Sportkulturen vorzunehmen, welches wir im Seminar kennengelernt haben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Insel Man
- Geographie, Topographie und Klima
- Geschichte, Einwohner und Besonderheiten
- Die Geschichte der Tourist Trophy
- Die ersten Jahre der Tourist Trophy
- Die Jahre 1920 bis 1939
- Die Tourist Trophy in den Jahren von 1947 bis heute
- Der Mythos Isle of Man TT
- Das gefährlichste Rennen der Welt
- Interview mit Rolf Steinhausen
- Der Tourismus auf der Insel Man
- Angebote und Möglichkeiten auf der Insel Man
- Entwicklung der touristischen Nutzung
- Die Tourist Trophy als regionale Sportkultur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die Tourist Trophy auf der Isle of Man, ein einzigartiges Motorradrennen mit langer Tradition, als regionale Sportkultur. Das Ziel ist, die Besonderheiten des Rennens, die Geschichte, den Mythos und den Einfluss auf den Tourismus der Insel darzustellen.
- Geographie, Topographie und Klima der Insel Man
- Geschichte der Insel Man und der Tourist Trophy
- Mythos des "gefährlichsten Rennens der Welt"
- Zusammenhang zwischen Tourismus und Tourist Trophy
- Einordnung der Tourist Trophy in das Konzept der regionalen Sportkulturen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Hausarbeit führt in das Thema der Tourist Trophy als regionale Sportkultur ein und beleuchtet den Begriff „Sportkultur“ im Kontext der Arbeit.
- Die Insel Man: Dieses Kapitel beschreibt die Geographie, Topographie und das Klima der Isle of Man, sowie die Geschichte der Insel, die Einwohner und besondere Merkmale.
- Die Geschichte der Tourist Trophy: Dieser Abschnitt erläutert die Entwicklung des Motorradrennens von seinen Anfängen bis heute, unterteilt in drei Abschnitte: die ersten Jahre, die Zeit von 1920 bis 1939 und die Zeit von 1947 bis heute.
- Der Mythos Isle of Man TT: Dieses Kapitel beleuchtet den Mythos, der sich um die Tourist Trophy als „gefährlichstes Rennen der Welt“ entwickelt hat, und enthält ein Interview mit Rolf Steinhausen.
- Der Tourismus auf der Insel Man: Dieser Abschnitt befasst sich mit dem Einfluss der Tourist Trophy auf den Tourismus der Isle of Man, indem er Angebote, Möglichkeiten und die Entwicklung der touristischen Nutzung beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Hauptideen und zentralen Begriffe der Arbeit umfassen die Tourist Trophy, Isle of Man, Motorradrennen, regionale Sportkultur, Geschichte, Mythos, Tourismus und Entwicklung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Tourist Trophy (TT) auf der Isle of Man?
Die TT ist eines der ältesten und gefährlichsten Motorradrennen der Welt, das auf öffentlichen Straßen der Isle of Man ausgetragen wird.
Warum wird die TT als "regionale Sportkultur" bezeichnet?
Weil das Rennen tief in der Geschichte, den Traditionen und der Identität der Inselbewohner verwurzelt ist und weit über ein reines Sportereignis hinausgeht.
Seit wann gibt es die Tourist Trophy?
Das Rennen hat eine lange Tradition, die bis in die frühen Jahre des 20. Jahrhunderts zurückreicht (erste Rennen ab 1907).
Welchen Einfluss hat das Rennen auf den Tourismus der Insel?
Die TT ist der wichtigste touristische Faktor der Insel, zieht jährlich zehntausende Besucher an und prägt das Image der Isle of Man weltweit.
Wer ist Rolf Steinhausen?
Steinhausen ist ein bekannter Motorradrennfahrer, der in einem Interview in der Arbeit Einblicke in den Mythos und die Gefahren des Rennens gibt.
- Quote paper
- Bastian Einck (Author), 2008, Die Tourist Trophy auf der Isle of Man, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/157121