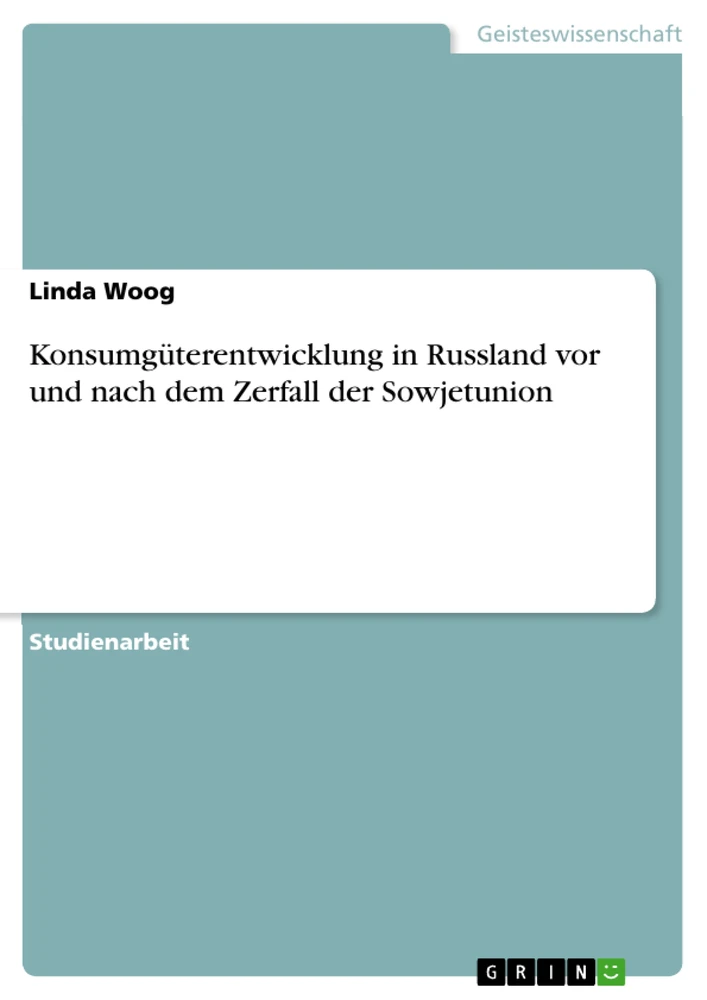Während in der Sowjetunion eine Güterknappheit herrschte, hat der russische Konsument heute eine große Auswahl an Produkten. Während in der sowjetischen Gesellschaft kein Platz für Markenprodukte war, da die Gesellschaft auf die Gleichheit aller angelegt war, wird im heutigen Russland gerne zur Schau gestellt was man hat und was man sich leisten kann.
Diese Hausarbeit stellt den Konsum in den letzten Jahren der Sowjetunion bis heute dar. Außerdem wird auf das Konsumverhalten und die Markenwahrnehmung eingegangen.
Das Ziel ist es darzustellen, wie sich der Konsum und das Konsumverhalten bis heute entwickelt haben. Diese Arbeit soll daher die Frage beantworten: Wie hat sich die Konsumlandschaft von der Ära Gorbačёv bis heute entwickelt und was können FMCG Hersteller daraus lernen?
Da der Rahmen dieser Hausarbeit begrenzt ist, bezieht sich die folgende Darstellung auf die schnelldrehenden Konsumgüter, die Fast Moving Consumer Goods (FMCG) und auf die Region Moskau.
Der erste Teil stellt den Konsum und die Markenwelt der Sowjetunion dar. Der zweite Teil konzentriert sich auf die ersten Jahre nach dem Zusammenbruch.
Der letzte Teil bezieht sich auf die Markenwahrnehmung im heutigen Russland, auf die Werbung, den Handel und das Konsumverhalten.
Die Schlussfolgerung gibt schließlich Aufschluss darüber, was westliche FMCG Hersteller im russischen Markt beachten müssen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Konsum in den letzten Jahren der Sowjetunion
- 2.1 Marken in der Sowjetunion
- 3. Konsum nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion
- 3.1 Markenwahrnehmung nach 1991
- 3.2 Markenwahrnehmung im heutigen Russland
- 3.3 Werbung in Russland
- 3.4 Handel in Russland
- 3.5 Konsumverhalten
- 4. Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung des Konsumgütermarktes in Russland nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion im Jahr 1991. Sie analysiert den Wandel des Konsumverhaltens, die Rolle von Marken und Werbung sowie die Entwicklung des Handels in diesem Zeitraum. Die Arbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Bild der Transformation des russischen Konsumgütermarktes zu liefern.
- Wandel des Konsumverhaltens in Russland nach 1985
- Entwicklung der Markenwahrnehmung und des Markenbewusstseins
- Rolle der Werbung und des Handels im Aufbau des Marktes
- Einfluss des politischen und wirtschaftlichen Umfelds
- Vergleich von Konsumverhalten vor und nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel dient als Einführung in die Thematik der Entwicklung des russischen Konsumgütermarktes nach 1985. Es beschreibt den Untersuchungsgegenstand und die Forschungsfrage, die im weiteren Verlauf der Arbeit beantwortet werden soll. Die Einleitung skizziert den methodischen Ansatz und gibt einen Überblick über die Struktur der Arbeit. Es werden die wichtigsten Aspekte der Transformation des russischen Marktes nach dem Ende der Sowjetunion hervorgehoben.
2. Konsum in den letzten Jahren der Sowjetunion: Dieses Kapitel analysiert den Konsum in der späten Sowjetunion, beleuchtet die eingeschränkten Möglichkeiten und das begrenzte Angebot an Konsumgütern. Es wird die Rolle von Marken in einem System untersucht, das durch Planwirtschaft und Knappheit geprägt war. Der Fokus liegt auf den Besonderheiten des sowjetischen Konsums und den Herausforderungen, die sich aus der Mangelwirtschaft ergaben. Der Übergang zu einem Marktmodell und dessen Herausforderungen werden vorbereitet.
3. Konsum nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion: Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit und untersucht umfassend den Konsumgütermarkt nach dem Fall der Sowjetunion. Es analysiert die Entwicklung der Markenwahrnehmung, von der anfänglichen Begeisterung für westliche Marken bis hin zur Herausbildung eines komplexeren Marktes. Das Kapitel betrachtet die Rolle der Werbung im Aufbau des neuen Marktes, die Entwicklung des Handels mit unterschiedlichen Vertriebsformen und den Wandel im Konsumverhalten der russischen Bevölkerung. Die einzelnen Unterkapitel betrachten die Aspekte Markenwahrnehmung, Werbung, Handel und Konsumverhalten im Detail und zeigen die Interdependenzen zwischen diesen Bereichen.
Schlüsselwörter
Konsumgütermarkt, Russland, Sowjetunion, Markenwahrnehmung, Werbung, Handel, Konsumverhalten, Markttransformation, Wirtschaftsgeographie, Post-Sowjetische Entwicklung.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zur Entwicklung des russischen Konsumgütermarktes
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung des russischen Konsumgütermarktes nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion im Jahr 1991. Sie analysiert den Wandel des Konsumverhaltens, die Rolle von Marken und Werbung sowie die Entwicklung des Handels in diesem Zeitraum. Ziel ist ein umfassendes Bild der Transformation des russischen Konsumgütermarktes.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt unter anderem den Wandel des Konsumverhaltens in Russland nach 1985, die Entwicklung der Markenwahrnehmung und des Markenbewusstseins, die Rolle der Werbung und des Handels im Aufbau des Marktes, den Einfluss des politischen und wirtschaftlichen Umfelds und einen Vergleich des Konsumverhaltens vor und nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über den Konsum in den letzten Jahren der Sowjetunion, ein Kapitel über den Konsum nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und eine Schlussfolgerung. Das Kapitel zum Konsum in der späten Sowjetunion beleuchtet die eingeschränkten Möglichkeiten und das begrenzte Angebot an Konsumgütern. Das Kernstück der Arbeit, das Kapitel zum Konsum nach 1991, analysiert die Entwicklung der Markenwahrnehmung, die Rolle der Werbung, die Entwicklung des Handels und den Wandel im Konsumverhalten der russischen Bevölkerung.
Was sind die zentralen Ergebnisse der Analyse des Konsums in der späten Sowjetunion?
Das Kapitel analysiert den Konsum in der späten Sowjetunion, beleuchtet die eingeschränkten Möglichkeiten und das begrenzte Angebot an Konsumgütern und untersucht die Rolle von Marken in einem System, das durch Planwirtschaft und Knappheit geprägt war. Der Fokus liegt auf den Besonderheiten des sowjetischen Konsums und den Herausforderungen, die sich aus der Mangelwirtschaft ergaben.
Welche Aspekte werden im Kapitel zum Konsum nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion behandelt?
Dieses Kapitel untersucht umfassend den Konsumgütermarkt nach dem Fall der Sowjetunion. Es analysiert die Entwicklung der Markenwahrnehmung (von anfänglicher Begeisterung für westliche Marken bis hin zu einem komplexeren Markt), die Rolle der Werbung im Aufbau des neuen Marktes, die Entwicklung des Handels mit unterschiedlichen Vertriebsformen und den Wandel im Konsumverhalten der russischen Bevölkerung. Die einzelnen Unterkapitel betrachten die Aspekte Markenwahrnehmung, Werbung, Handel und Konsumverhalten im Detail und zeigen die Interdependenzen zwischen diesen Bereichen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Konsumgütermarkt, Russland, Sowjetunion, Markenwahrnehmung, Werbung, Handel, Konsumverhalten, Markttransformation, Wirtschaftsgeographie, Post-Sowjetische Entwicklung.
Welche Forschungsfrage wird in der Arbeit beantwortet?
Die Arbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Bild der Transformation des russischen Konsumgütermarktes zu liefern und die Entwicklung des Marktes nach dem Fall der Sowjetunion zu analysieren.
- Quote paper
- Linda Woog (Author), 2010, Konsumgüterentwicklung in Russland vor und nach dem Zerfall der Sowjetunion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/157513