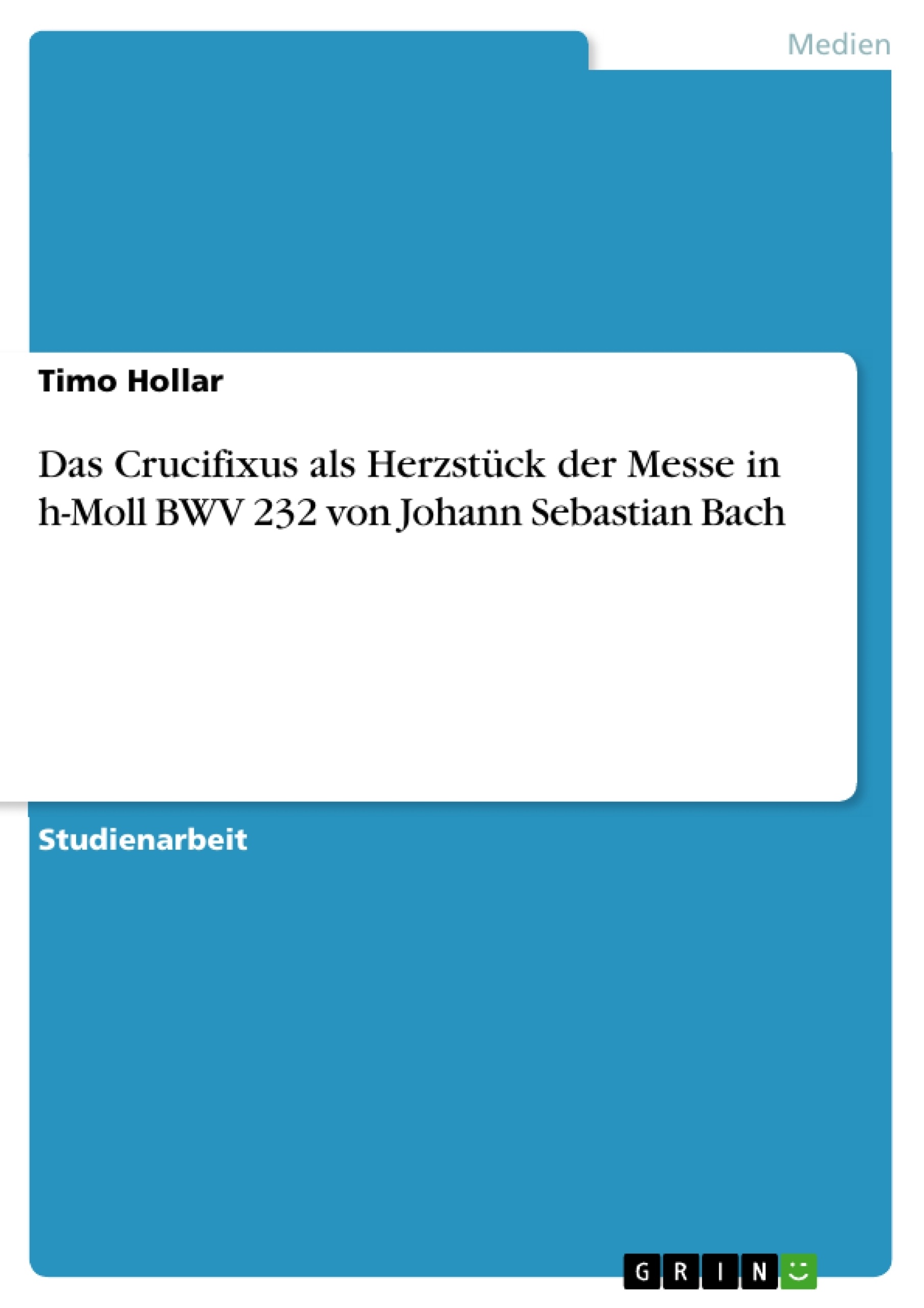In dieser Arbeit steht der zentrale Abschnitt der Kreuzaussage im Fokus, insbesondere das Crucifixus innerhalb der h-Moll-Messe. Zunächst wird die zentrale Stellung des Crucifixus innerhalb der Messearchitektur näher beleuchtet. Daran schließt sich eine analytische Auseinandersetzung mit der kompositorischen Arbeitsweise Bachs an sowie ein vergleichender Blick auf die musikalische Idee, die diesem Satz zugrunde liegt: die Kantate „Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen“ (BWV 12/2), die Bach bereits im Jahre 1714 komponierte.
Johann Sebastian Bach, seine Person für viele ein Sinnbild von musikalischer Ästhetik, er selbst wohl prägendster Komponist des Barockzeitalters und einer der bedeutendsten Schöpfer geistlicher und kirchlicher Musik bis zur Gegenwart. Bachs Messe in h-Moll BWV 232, die im bachschen Kreis auch als „große catholische Messe“ bezeichnet wird, steht repräsentativ für die barocke, geistliche Großmusik. Eine historisch weiter gefasste Formulierung stammt von dem Schweizer Verleger Hans Georg Nägeli, der die Messe im Jahre 1818 in einer Zeitschrift sogar als "grösstes musikalisches Kunstwerk aller Zeiten und Völker" anpreist. Sie zählt zu Bachs Spätwerk und wurde kurz vor seinem Ableben fertiggestellt.
Inhaltsverzeichnis
- I. Zu Johann Sebastian Bachs Messe in h-Moll BWV 232
- II. Das Crucifixus und sein Platz innerhalb der Architektur der Messe
- III. Analytische Betrachtung von Text und Musik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit konzentriert sich auf das Crucifixus innerhalb von Johann Sebastian Bachs h-Moll-Messe (BWV 232). Das Ziel ist es, die zentrale Stellung des Crucifixus innerhalb der Messearchitektur zu beleuchten und die kompositorische Arbeitsweise Bachs analytisch zu untersuchen. Ein Vergleich mit der Kantate „Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen“ (BWV 12/2) soll weitere Einblicke in die musikalische Idee des Satzes liefern.
- Die Bedeutung des Crucifixus in Bachs h-Moll-Messe
- Analyse der kompositorischen Technik Bachs im Crucifixus
- Vergleich des Crucifixus mit anderen Werken Bachs
- Die Entwicklung der h-Moll-Messe und die verschiedenen Fassungen
- Der Einfluss italienischer und römisch-katholischer Vorbilder auf Bachs Komposition
Zusammenfassung der Kapitel
I. Zu Johann Sebastian Bachs Messe in h-Moll BWV 232: Dieses Kapitel liefert einen umfassenden Überblick über Bachs h-Moll-Messe. Es beleuchtet die Entstehungsgeschichte der Messe, verweist auf die Einbindung von Teilen früherer Kompositionen Bachs und analysiert den Einfluss italienischer Vorbilder wie Giovanni Battista Bassani. Die Diskussion der konfessionellen Hintergründe (lutherisch und katholisch) unterstreicht die Komplexität des Werkes und dessen Einbettung in den Kontext des Leipziger und Dresdner Hofgottesdienstes. Die zentrale Rolle des Kreuzes und somit des Crucifixus als Herzstück der Messe wird bereits hier hervorgehoben, um die Fokussierung der weiteren Arbeit zu begründen.
II. Das Crucifixus und sein Platz innerhalb der Architektur der Messe: Dieses Kapitel untersucht die Position des Crucifixus innerhalb der Struktur der h-Moll-Messe. Es analysiert den Platz des Crucifixus im Credo und dessen Bedeutung im Kontext des Glaubensbekenntnisses. Der Vergleich zwischen der ersten und der zweiten Fassung der Messe verdeutlicht die Entwicklung und die zunehmende Bedeutung des Crucifixus. Die Diskussion über die Abfolge der Sätze und die unterschiedlichen Besetzungen unterstreicht Bachs kompositorisches Können und die theologische Aussagekraft des Werkes. Die Betonung des Crucifixus als Zenit des zweiten Teils der Messe wird als Ausdruck einer spezifisch westkirchlichen theologischen Sichtweise interpretiert.
Schlüsselwörter
Johann Sebastian Bach, h-Moll-Messe (BWV 232), Crucifixus, Credo, Messearchitektur, Kompositionstechnik, Italienische Musik, Katholische und Lutherische Liturgie, Kantate BWV 12/2, Theologische Aspekte, Fassungen der Messe.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Analyse von Johann Sebastian Bachs h-Moll-Messe BWV 232?
Die Analyse konzentriert sich auf das Crucifixus innerhalb von Johann Sebastian Bachs h-Moll-Messe (BWV 232). Ziel ist es, die zentrale Stellung des Crucifixus innerhalb der Messearchitektur zu beleuchten und die kompositorische Arbeitsweise Bachs analytisch zu untersuchen. Ein Vergleich mit der Kantate „Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen“ (BWV 12/2) soll weitere Einblicke in die musikalische Idee des Satzes liefern.
Welche Themenschwerpunkte werden in der Analyse behandelt?
Die Themenschwerpunkte sind: die Bedeutung des Crucifixus in Bachs h-Moll-Messe, die Analyse der kompositorischen Technik Bachs im Crucifixus, der Vergleich des Crucifixus mit anderen Werken Bachs, die Entwicklung der h-Moll-Messe und die verschiedenen Fassungen, sowie der Einfluss italienischer und römisch-katholischer Vorbilder auf Bachs Komposition.
Was wird im ersten Kapitel ("Zu Johann Sebastian Bachs Messe in h-Moll BWV 232") behandelt?
Das erste Kapitel liefert einen umfassenden Überblick über Bachs h-Moll-Messe. Es beleuchtet die Entstehungsgeschichte der Messe, verweist auf die Einbindung von Teilen früherer Kompositionen Bachs und analysiert den Einfluss italienischer Vorbilder wie Giovanni Battista Bassani. Die Diskussion der konfessionellen Hintergründe (lutherisch und katholisch) unterstreicht die Komplexität des Werkes und dessen Einbettung in den Kontext des Leipziger und Dresdner Hofgottesdienstes. Die zentrale Rolle des Kreuzes und somit des Crucifixus als Herzstück der Messe wird bereits hier hervorgehoben.
Was ist der Inhalt des zweiten Kapitels ("Das Crucifixus und sein Platz innerhalb der Architektur der Messe")?
Das zweite Kapitel untersucht die Position des Crucifixus innerhalb der Struktur der h-Moll-Messe. Es analysiert den Platz des Crucifixus im Credo und dessen Bedeutung im Kontext des Glaubensbekenntnisses. Der Vergleich zwischen der ersten und der zweiten Fassung der Messe verdeutlicht die Entwicklung und die zunehmende Bedeutung des Crucifixus. Die Diskussion über die Abfolge der Sätze und die unterschiedlichen Besetzungen unterstreicht Bachs kompositorisches Können und die theologische Aussagekraft des Werkes. Die Betonung des Crucifixus als Zenit des zweiten Teils der Messe wird als Ausdruck einer spezifisch westkirchlichen theologischen Sichtweise interpretiert.
Welche Schlüsselwörter sind für diese Analyse relevant?
Relevante Schlüsselwörter sind: Johann Sebastian Bach, h-Moll-Messe (BWV 232), Crucifixus, Credo, Messearchitektur, Kompositionstechnik, Italienische Musik, Katholische und Lutherische Liturgie, Kantate BWV 12/2, Theologische Aspekte, Fassungen der Messe.
- Quote paper
- Timo Hollar (Author), 2022, Das Crucifixus als Herzstück der Messe in h-Moll BWV 232 von Johann Sebastian Bach, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1577785