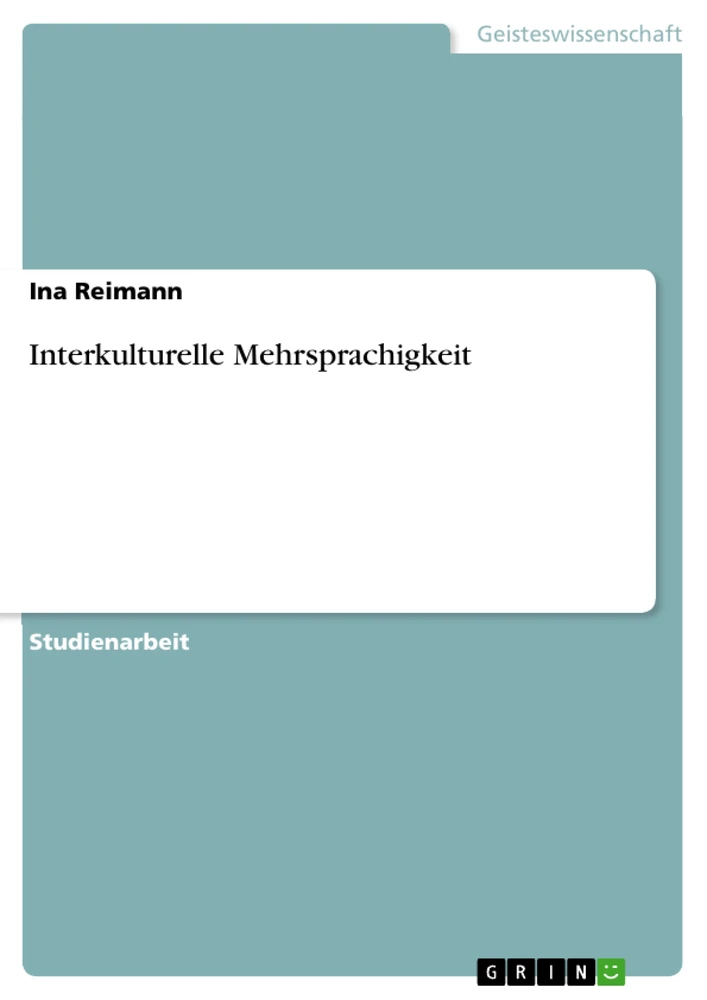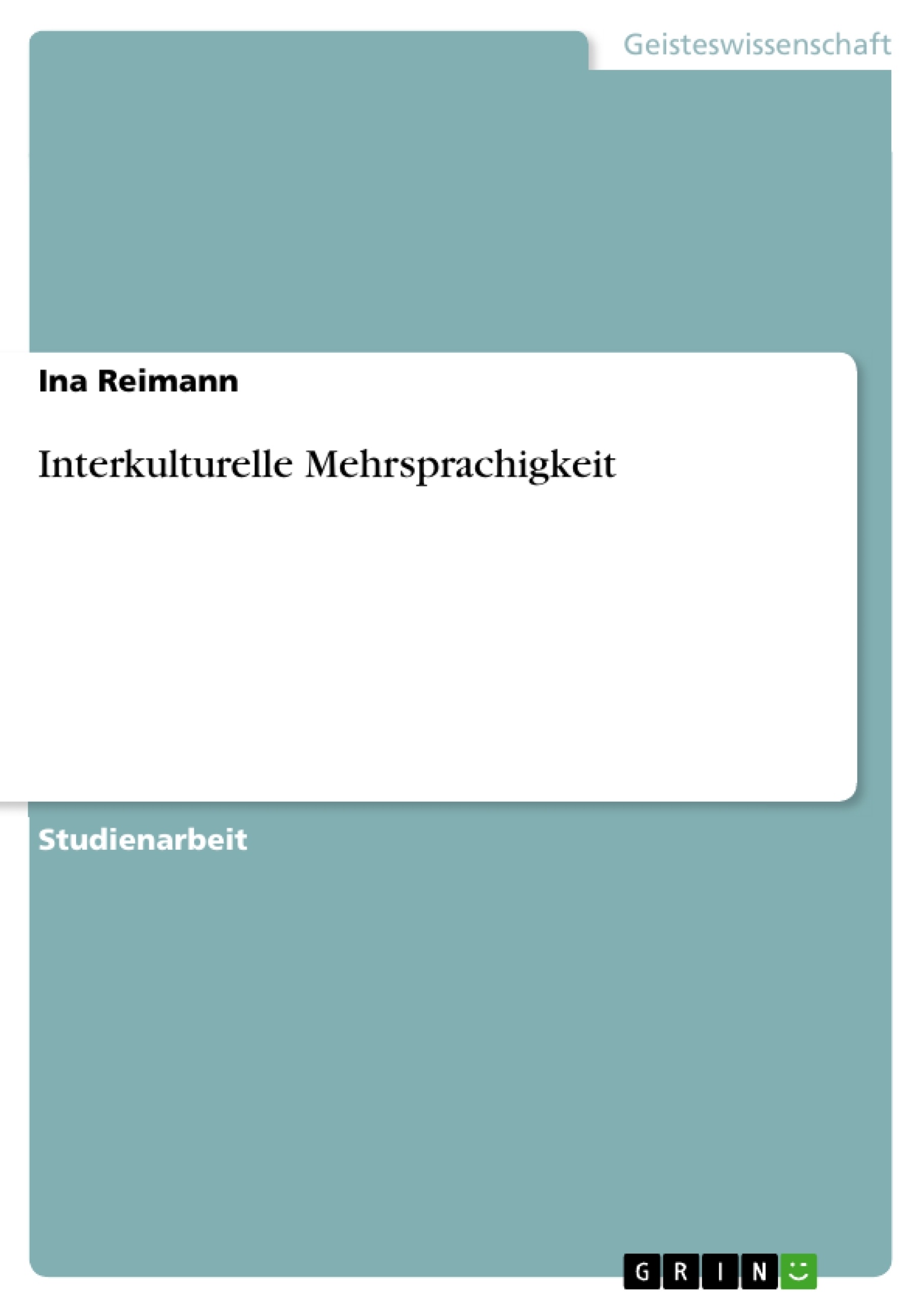Zwei verschiedene Themen finden im Bereich der Mehrsprachigkeit bei Kindern zu-einander: Sprachen und Kinder. Beide sind jeweils Teil unseres Lebens, von Gesell-schaft und Welt. Genau diesem Themenkomplex möchten wir uns in der vorliegen-den Arbeit widmen. Wir haben dieses Thema für unsere Arbeit gewählt, da es in Zei-ten wie diesen immer mehr an Aktualität zu gewinnen scheint, es demnach bereits latent über unseren Köpfen schwebt und zunehmend in Erscheinung zu treten „droht“. Schlagwörter wie Globalisierung, Migration, Wirtschaftszusammenschlüsse, Internationalisierung und damit auch Mehrsprachigkeit prägen unser derzeitiges Weltbild. Unsere Welt zeichnet sich durch eine kulturelle und sprachliche Vielgestal-tigkeit aus. Überall sind wir von Sprache(n) umgeben. Wir beherrschen, lernen, hö-ren, kommunizieren, erkennen und teilen uns über Sprache mit. Ein jeder von uns wächst mit einer Sprache auf und lernt diese auf ganz natürlichem Wege. Warum soll dies also nicht auch im Kontext mehrerer Sprachen geschehen? Kinder bergen ein großes Potential in sich und vermögen so viel. Was spricht also dagegen dies auch für die Mehrsprachigkeit zu nutzen?
Diese Arbeit steht im Wesentlichen auf 2 Pfeilern: zum einen der Mehrsprachigkeit allgemein und zum anderem der mehrsprachigen Entwicklung. Beide sollen jeweils nach einer umfassenden Darstellung schließlich zu einer Zusammenfügung im The-ma der Zweisprachigen Erziehung kommen. Ziel dieser Arbeit ist es somit herauszu-finden, wie Mehrsprachigkeit zustande kommt und welche Wirkung und Chancen sie bei Kindern hat.
Inhaltsverzeichnis
- Mehrsprachigkeit
- Allgemeines zur Mehrsprachigkeit
- Frühkindliche Mehrsprachigkeit
- Mehrsprachigkeit als Chance
- Mehrsprachige Entwicklung
- Herausforderungen mehrsprachiger Entwicklung
- Gefährdung mehrsprachiger Entwicklung
- Störungen der Sprachentwicklung
- Zweisprachige Erziehung
- Definition von Zweisprachigkeit
- Die Anfänge des Bilingualen Wortschatzes
- Prinzipien und Rahmenbedingungen der zweisprachigen Erziehung
- Vor- und Nachteile der Zweisprachigkeitserziehung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema der Mehrsprachigkeit bei Kindern. Sie untersucht, wie Mehrsprachigkeit zustande kommt, welche Auswirkungen sie auf Kinder hat und welche Chancen sie bietet. Dabei werden insbesondere die Aspekte der frühkindlichen Mehrsprachigkeit und der zweisprachigen Erziehung beleuchtet.
- Mehrsprachigkeit als allgegenwärtiges Phänomen in einer globalisierten Welt
- Entwicklung mehrsprachiger Kinder, insbesondere im Kontext von Migration
- Herausforderungen und Chancen der mehrsprachigen Entwicklung
- Zweisprachige Erziehung: Prinzipien, Rahmenbedingungen und Auswirkungen
- Der Beitrag der Mehrsprachigkeit zur Sprachentwicklung von Kindern
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine umfassende Einführung in das Thema Mehrsprachigkeit. Es betrachtet die Mehrsprachigkeit aus einem historischen, allgemeinen und zukünftigen Blickwinkel und beleuchtet die Bedeutung von frühkindlicher Mehrsprachigkeit.
Im zweiten Kapitel geht es um die mehrsprachige Entwicklung von Kindern. Es werden die Herausforderungen und Gefährdungen der mehrsprachigen Entwicklung sowie mögliche Störungen der Sprachentwicklung im Zuge der kindlichen Mehrsprachigkeit beleuchtet.
Das dritte Kapitel widmet sich der zweisprachigen Kindererziehung. Neben einer Definition von Zweisprachigkeit werden die Anfänge des bilingualen Wortschatzes sowie die Prinzipien und Rahmenbedingungen der zweisprachigen Erziehung erläutert. Der Vergleich von Vor- und Nachteilen der Zweisprachigkeitserziehung rundet dieses Kapitel ab.
Schlüsselwörter
Mehrsprachigkeit, Mehrsprachige Entwicklung, Zweisprachige Erziehung, Frühkindliche Mehrsprachigkeit, Bilingualismus, Sprachentwicklung, Migration, Globalisierung, Interkulturelle Kommunikation, Chancen, Herausforderungen, Störungen.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Vorteile von frühkindlicher Mehrsprachigkeit?
Mehrsprachigkeit wird in dieser Arbeit als große Chance begriffen, die das Potenzial von Kindern nutzt und ihnen in einer globalisierten Welt wichtige kommunikative Kompetenzen verleiht.
Welche Herausforderungen gibt es bei der mehrsprachigen Entwicklung?
Die Arbeit beleuchtet mögliche Gefährdungen und Störungen der Sprachentwicklung, die im Prozess des Aufwachsens mit mehreren Sprachen auftreten können.
Was versteht man unter zweisprachiger Erziehung?
Zweisprachige Erziehung umfasst die bewusste Förderung zweier Sprachen. Die Arbeit erläutert Prinzipien, Rahmenbedingungen sowie den Aufbau eines bilingualen Wortschatzes.
Welchen Einfluss hat die Globalisierung auf die Mehrsprachigkeit?
Globalisierung und Migration führen dazu, dass kulturelle und sprachliche Vielgestaltigkeit zunehmend zum Normalzustand werden, was die Relevanz interkultureller Mehrsprachigkeit erhöht.
Gibt es Nachteile bei der Zweisprachigkeitserziehung?
Die Arbeit wägt Vor- und Nachteile ab, um Eltern und Erziehern eine fundierte Entscheidungsgrundlage zu bieten, wobei die Chancen meist überwiegen.
- Quote paper
- Ina Reimann (Author), 2009, Interkulturelle Mehrsprachigkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/157799