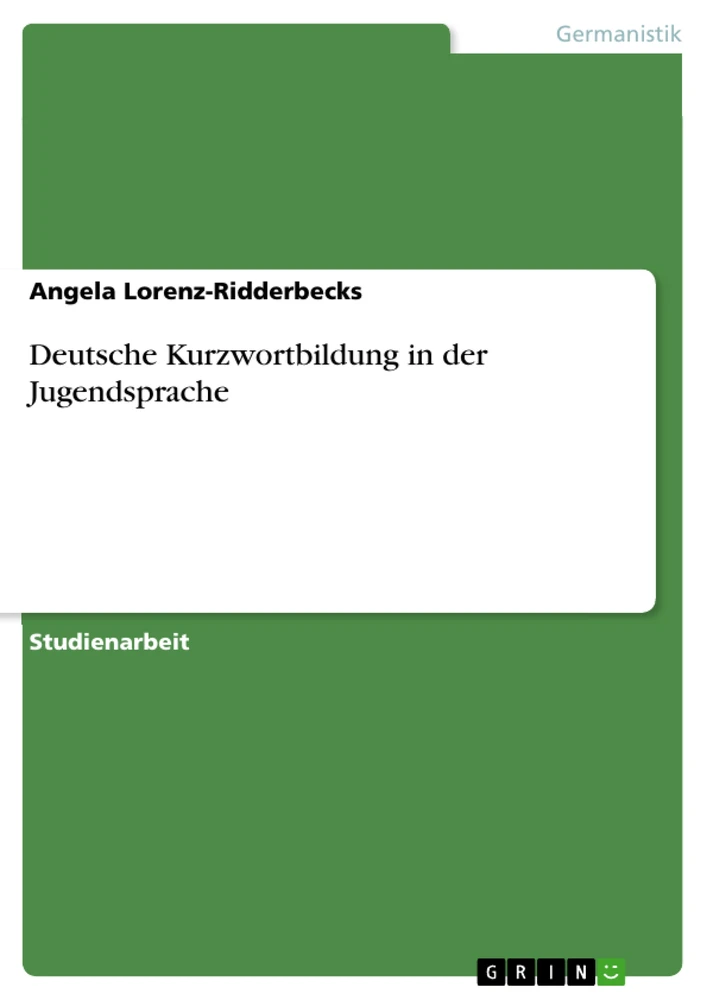In dieser Hausarbeit möchte ich mich mit der deutschen Kurzwortbildung in der Jugendsprache beschäftigen. Die Klagen über die Wortbildungen der Jugendsprache, speziell der Verdacht der grammatikalischen Unreinheit bzw. Verunglimpfung der Regeln der deutschen Sprache, des „Sprachverfalls“, auch der „Anglizismen“, bringt mich dazu herauszuarbeiten, inwiefern die in den ausgewählten „Jugendsprachelexika“ genannten Kurzwörter nach den „Regeln“ der deutschen Kurzwortbildung gebildet wurden.
Inhaltsverzeichnis
- Auf ein Wort...
- Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Das Problem: Was ist Kurzwortbildung (KW-Bildung)?
- 2.1 Definition der deutschen KW-Bildung nach Kobler-Trill (1992/93)
- 2.2 Abgrenzung zu Erben, Fleischer/Barz u.a. Autoren
- 2.3 Fazit
- 3 Was gehört zur KW-Bildung?
- 3.1 Typologie der KW-formen nach Kobler-Trill und Donalies
- 3.1.1 Unisegmentale Kurzwörter (KWus)
- 3.1.2 Partielle Kurzwörter (KWpart)
- 3.1.3 Multisegmentale Kurzwörter (KWms)
- 3.1.4 Abgrenzung zu anderen Reduktionsarten
- 3.1 Typologie der KW-formen nach Kobler-Trill und Donalies
- 4 KW in der Jugendsprache
- 4.1 Ausgewählte Beispiele aus dem „Pons. Wörterbuch der Jugendsprache. Das Original“
- 4.2 Ausgewählte Beispiele aus „Endgeil. Das voll korrekte Lexikon der Jugendsprache“
- 5 Gemeinsamkeiten oder Unterschiede zwischen deutscher Jugend- und Standardsprache in der KW-Bildung?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Kurzwortbildung in der deutschen Jugendsprache und untersucht, inwieweit Kurzwörter in Jugendsprachelexika den Regeln der deutschen Kurzwortbildung entsprechen. Die Arbeit beleuchtet den aktuellen Stand der Forschung zur Kurzwortbildung und analysiert die Verwendung von Kurzwörtern in der Jugendsprache im Vergleich zur Standardsprache.
- Definition und Abgrenzung der Kurzwortbildung
- Typologie und Formen der Kurzwortbildung
- Kurzwortbildung in der Jugendsprache
- Vergleich von Kurzwortbildung in Jugend- und Standardsprache
- Analyse ausgewählter Beispiele aus Jugendsprachelexika
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel widmet sich der Einführung in das Thema und stellt den Forschungsstand zur Kurzwortbildung dar.
- Kapitel 2 beleuchtet die Problematik der Definition und Abgrenzung der Kurzwortbildung und diskutiert verschiedene Definitionen und Ansätze.
- Kapitel 3 stellt die Typologie und Formen der Kurzwortbildung vor, einschließlich der Unterscheidung in Unisegmentale, Partielle und Multisegmentale Kurzwörter.
- Kapitel 4 analysiert ausgewählte Beispiele von Kurzwortbildungen aus Jugendsprachelexika.
- Das fünfte Kapitel untersucht Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen der Kurzwortbildung in der deutschen Jugendsprache und der Standardsprache.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Kurzwortbildung, insbesondere in der deutschen Jugendsprache. Zentrale Themen sind die Definition und Typologie der Kurzwortbildung, die Analyse von Kurzwörtern in Jugendsprachelexika, der Vergleich mit der Standardsprache und die Diskussion um den vermeintlichen „Sprachverfall“ durch Kurzwortbildungen.
- Quote paper
- Angela Lorenz-Ridderbecks (Author), 2010, Deutsche Kurzwortbildung in der Jugendsprache, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/157901