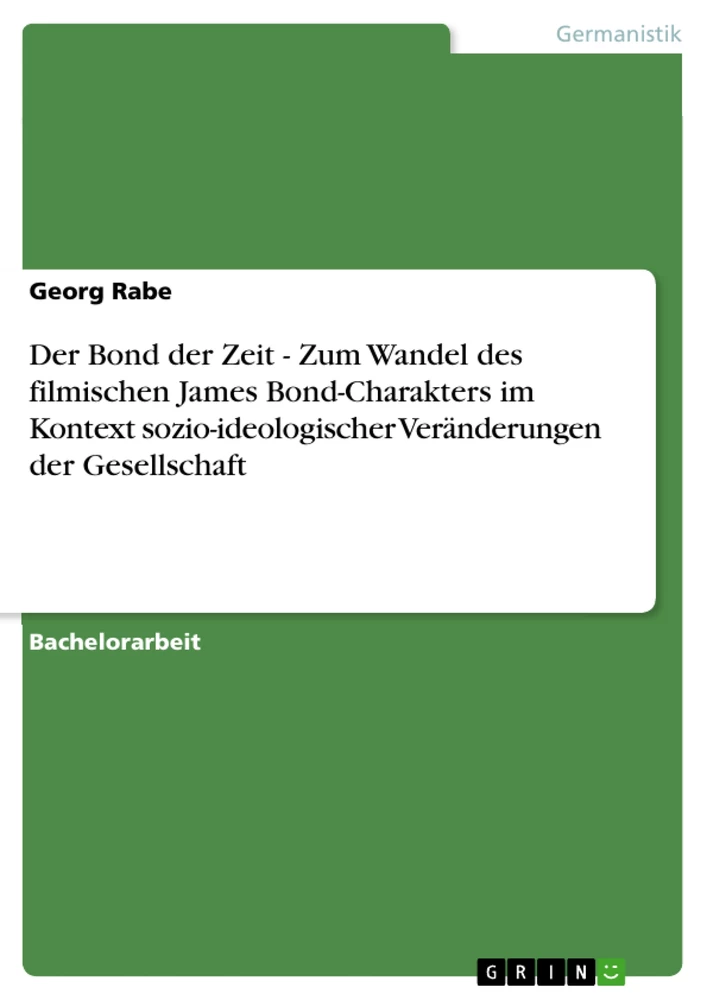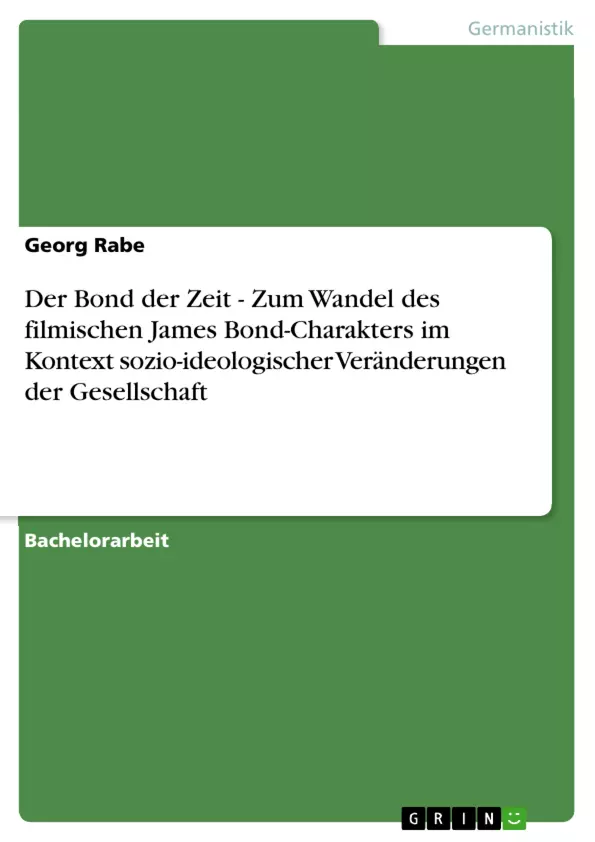In dieser Bachelorarbeit wird medienanalytisch gearbeitet, indem der These nachgegangen wird, dass der filmische Bond-Charakter einem ständigen Wandel unterliegt, der eben auch auf sozio-ideologische Bedingungen in der Gesellschaft zurückzuführen ist. So sind gerade im vorletzten Film Casino Royale Neuerungen zu finden, die in Wechselwirkung zu gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklungen stehen.
Einleitung
Im November 2006 war es soweit. Nach der zweitlängsten Pause der erfolgreichsten und langlebigsten Filmreihe der Welt lief mit 'Casino Royale' der 21. James Bond-Film in den Kinos an. Bereits nach wenigen Minuten war für das nicht ganz unkundige Publikum klar, dass bei diesem Film einiges anders werden sollte. So ist die Anfangssequenz des Films in schwarz-weiß gehalten und die Titelfigur Bond erledigt darin einen Tötungsauftrag wider jeden Gentlemen-Betragens auf ebenso physische wie brutale Art und Weise. Die 'Gunbarrel'-Sequenz, mit der jeder offizielle Bond-Film startet, ist hierbei zum ersten Mal in die Handlung integriert (...) und zeigt abschließend durch eine Großaufnahme Bonds überdeutlich, dass der Charakter nun einen neuen Mimen hat, der blond und blauäugig ist - Daniel Craig. Die weltweite Forschung hat das Phänomen 'James Bond' von seinem literarischen Beginn an facetten- und umfangreich erfasst. Die Einbeziehung des Films 'Casino Royale' ist bisher jedoch nicht erfolgt. So findet sich diese Thematik weder bei dem
promovierten Filmwissenschaftler Siegfried Tesche, der als einer der James Bond-Experten gilt, noch im Rahmen der derzeit verfügbaren medienanalytischen Arbeiten der Cultural Studies. Mit der vorliegenden Arbeit soll diese Forschungslücke geschlossen
werden. Zu diesem Zweck stelle ich folgende zwei Thesen auf:
1. In dem aktuellen Bond-Film 'Casino Royale' hat ein Wandel des James Bond-Charakters stattgefunden.
2. Dieser Wandel der filmischen Bond-Inszenierung ist mit sozio-ideologischen Veränderungen in der deutschen Gesellschaft verbunden.
Um meine Arbeit auf eine feste theoretische Grundlage zu stellen, werde ich mich auf das Projekt der Cultural Studies stützen und mich zum Zweck der Analyse des filmischen James Bond-Charakters an der Diskursanalyse John Fiskes orientieren (Kapitel 2). In Kapitel 3 werde ich den Analysegegenstand vorstellen, die Analyse von Film
und zeitgenössischen Äußerungen durchführen und schließlich versuchen, die beiden Thesen anhand der Ergebnisse zu verifizieren.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Medienanalyse mittels Cultural Studies
- 2.1 Das Projekt der Cultural Studies
- 2.2 Zur Entstehung und Weiterentwicklung der Cultural Studies
- 2.3 Cultural Studies im deutschsprachigen Raum
- 2.4 Von der Einimpfungstheorie zum komplexen Rezeptionsmodell
- 3 Analyse
- 3.1 Zum Referenzrahmen der Analyse – die filmische James Bond-Figur
- 3.2 Zum Analysegegenstand - der Film Casino Royale
- 3.3 Beschreibung des Analyserasters
- 3.4 Analyse des Films Casino Royale
- 3.5 Auswertung der Analyseergebnisse
- 3.6 Interpretation der Analyseergebnisse
- 4 Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht den Wandel des filmischen James Bond-Charakters im Film "Casino Royale" (2006) im Kontext sozio-ideologischer Veränderungen der deutschen Gesellschaft. Dabei wird analysiert, wie sich die Inszenierung des Charakters und die dargestellten Inhalte an die veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen angepasst haben.
- Analyse des Wandels der filmischen James Bond-Figur in "Casino Royale"
- Zusammenhang zwischen dem Wandel der Bond-Inszenierung und sozio-ideologischen Veränderungen in der deutschen Gesellschaft
- Anwendung des theoretischen Konzepts der Cultural Studies auf die Analyse des James Bond-Phänomens
- Diskursanalyse anhand des Films "Casino Royale" und zeitgenössischer Äußerungen
- Verifizierung der These, dass der Wandel der Bond-Inszenierung mit gesellschaftlichen Veränderungen verbunden ist
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einleitung
Das Kapitel stellt den aktuellen James Bond-Film "Casino Royale" (2006) vor und erläutert die Besonderheiten des Films im Vergleich zu seinen Vorgängern. Es werden zwei Thesen aufgestellt, die die Arbeit leiten: Erstens hat sich der James Bond-Charakter in "Casino Royale" gewandelt, und zweitens ist dieser Wandel mit sozio-ideologischen Veränderungen in der deutschen Gesellschaft verbunden. Außerdem wird das theoretische Konzept der Cultural Studies als Grundlage der Analyse vorgestellt.
Kapitel 2: Medienanalyse mittels Cultural Studies
Das Kapitel erläutert das Projekt der Cultural Studies und seine verschiedenen Ausprägungen. Es wird der Kulturbegriff der CS erläutert, der Machtverhältnisse und kulturelle Praktiken in den Mittelpunkt stellt. Außerdem wird die Bedeutung der Diskursanalyse für die Analyse von kulturellen Repräsentationen hervorgehoben.
Kapitel 3: Analyse
Dieses Kapitel stellt den Film "Casino Royale" als Analysegegenstand vor. Es beschreibt das Analyseraster, das zur Analyse des Films eingesetzt wird. Die Analyse des Films "Casino Royale" wird mit den Ergebnissen der Diskursanalyse verknüpft, um den Wandel der Bond-Figur und dessen Zusammenhang mit sozio-ideologischen Veränderungen zu belegen.
Schlüsselwörter
James Bond, Casino Royale, Cultural Studies, Diskursanalyse, sozio-ideologische Veränderungen, Filmfigur, Medienanalyse, Kultur, Repräsentation, Machtverhältnisse, Gesellschaft, Wandel, Transformation.
Häufig gestellte Fragen
Welche zentrale These verfolgt die Arbeit über James Bond?
Die Arbeit geht der These nach, dass der filmische Bond-Charakter einem ständigen Wandel unterliegt, der auf sozio-ideologische Bedingungen in der Gesellschaft zurückzuführen ist.
Warum wird speziell der Film "Casino Royale" analysiert?
Casino Royale (2006) markiert einen signifikanten Bruch in der Reihe, da er Neuerungen in der Charakterzeichnung zeigt, die in enger Wechselwirkung zu kulturellen Entwicklungen stehen.
Welche Rolle spielt Daniel Craig in dieser Analyse?
Daniel Craig verkörpert den "neuen" Bond, der physischer und brutaler agiert und sich optisch sowie charakterlich von seinen Vorgängern abhebt.
Welche Forschungslücke soll geschlossen werden?
Die Arbeit schließt die Lücke in der medienanalytischen Forschung der Cultural Studies, in der der Film "Casino Royale" bisher kaum berücksichtigt wurde.
Welche theoretische Grundlage wird für die Analyse genutzt?
Die Analyse stützt sich auf das Projekt der Cultural Studies und orientiert sich an der Diskursanalyse nach John Fiske.
Was wird in Kapitel 3 der Arbeit untersucht?
Kapitel 3 umfasst die eigentliche Analyse des Films "Casino Royale" sowie zeitgenössischer Äußerungen zur Verifizierung der aufgestellten Thesen.
- Citar trabajo
- Georg Rabe (Autor), 2008, Der Bond der Zeit - Zum Wandel des filmischen James Bond-Charakters im Kontext sozio-ideologischer Veränderungen der Gesellschaft, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/158318