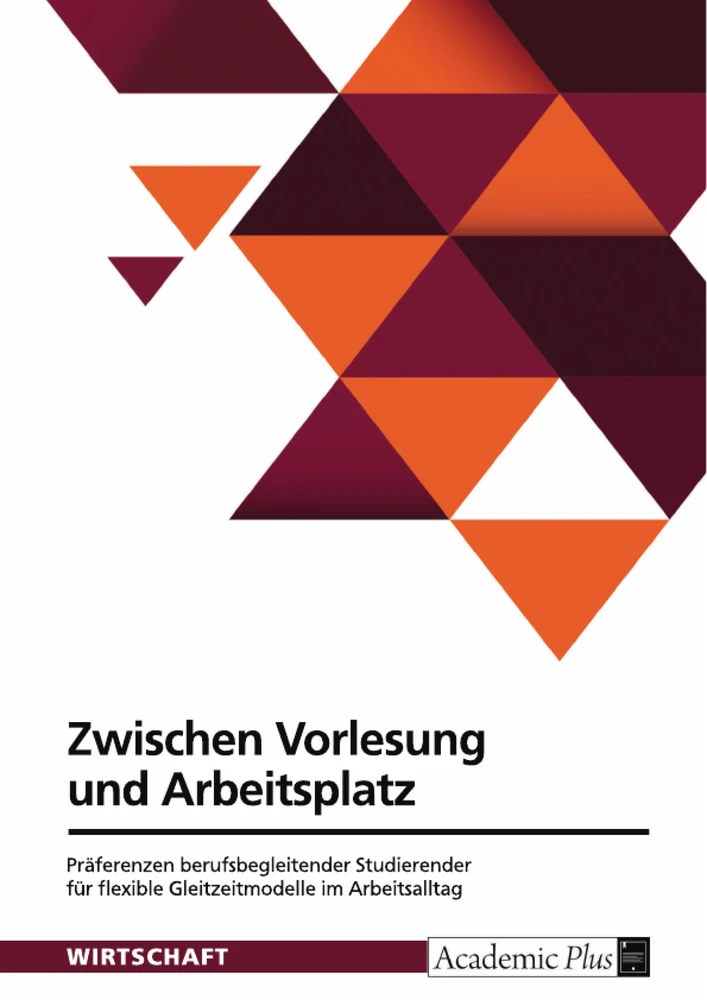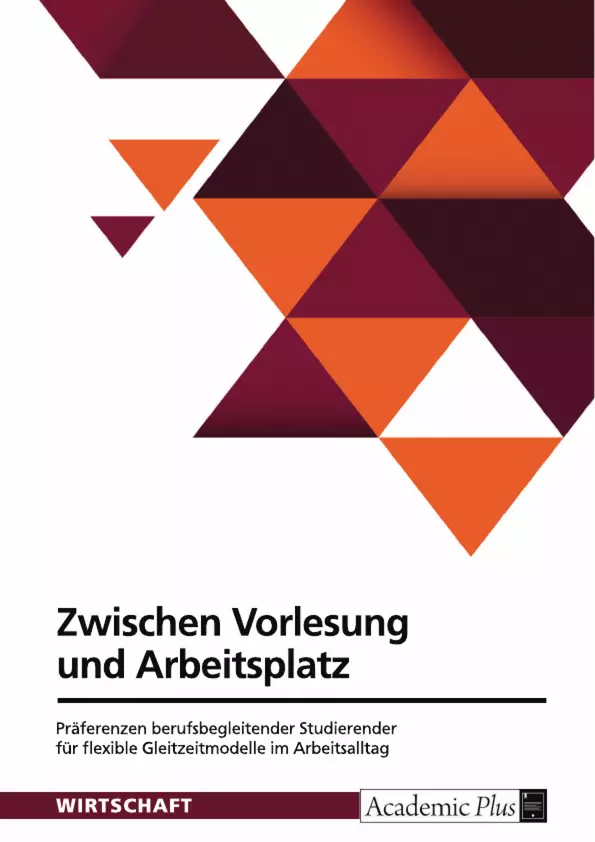In der vorliegenden Arbeit wird die zeitliche Vereinbarkeit von berufsbegleitenden Studierenden näher betrachtet. Diese Bachelorarbeit untersucht die Präferenzen berufsbegleitender Studierender für Gleitzeitmodelle im Arbeitsalltag und deren Auswirkungen auf die zeitliche Vereinbarkeit von Beruf und Studium. Durch eine quantitative Untersuchung mittels einer Umfrage unter berufsbegleitenden Studierenden wurde herausgefunden, dass die Mehrheit der Teilnehmer sich eine erhöhte Flexibilität bei der Arbeitszeitgestaltung wünscht. Dies soll helfen, ihre beruflichen Verpflichtungen besser mit den Anforderungen ihres Studiums zu vereinbaren.
Hierbei zeigt sich, dass Sie sich insbesondere mehr Flexibilität bezüglich des täglichen Arbeitsbeginnes und -endes, sowie der Verteilung der jährlichen Arbeitszeit wünschen. Die Untersuchung zeigt, dass verschiedene Gleitzeitmodelle wie Gleitzeit ohne Kernarbeitszeit oder Jahresarbeitszeitkonten potenzielle Lösungen dafür bieten, um den Bedürfnissen der Studierenden gerecht zu werden. Insbesondere bieten Jahresarbeitszeitkonten den Vorteil einer flexiblen Gestaltung der Verteilung der Arbeitszeit über einen Zeitraum von einem Jahr, während die monatliche Entlohnung stabil bleibt. Diese Flexibilität ermöglicht es den Studierenden, ihre Arbeitsbelastung je nach ihren akademischen und persönlichen Verpflichtungen anzupassen. Durch die Möglichkeit, ihre Arbeitsstunden flexible zu verteilen und anzupassen, können sie beispielsweise während Prüfungszeiten oder anderen wichtigen Ereignissen mehr Zeit für ihr Studium aufbringen, ohne dabei finanzielle Einbußen hinnehmen zu müssen. Interessanterweise offenbart die Umfrage auch eine begrenzte Kenntnis vieler Studierender über bestimmte Gleitzeitmodelle wie Gleitzeit mit Funktionszeit oder Jahresarbeitszeitkonten. Dies deutet darauf hin, dass eine bessere Aufklärung und Information über die verschiedenen Gleitzeitoptionen notwendig ist, um den Studierenden eine fundierte Entscheidung zu ermöglichen. Zudem werden diese Modelle auch häufig nicht von Arbeitgebern angeboten, was möglicherweise darauf zurückzuführen ist, dass sie noch nicht weit verbreitet sind und auch unter den Arbeitgebern noch nicht bekannt sind. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- 1. Einleitung
- 1.1. Problemstellung der Arbeit
- 1.2. Zielsetzung der Arbeit
- 1.3. Abgrenzung
- 1.4. Aufbau der Arbeit
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1. Hintergründe des berufsbegleitenden Studiums
- 2.2. Arten des berufsbegleitenden Studiums
- 2.2.1. Berufsbegleitendes Fernstudium
- 2.2.2. Berufsbegleitendes Präsenzstudium
- 2.2.3. Blended Learning
- 2.3. Zeitliche Vereinbarkeit von Beruf und Studium
- 2.4. Modelle flexibler Arbeitszeitgestaltung
- 2.5. Definition und Merkmale von Gleitzeit
- 2.6. Gleitzeitmodelle
- 2.6.1. Gleitzeit ohne Kernarbeitszeit
- 2.6.2. Gleitzeit mit Kernarbeitszeit
- 2.6.3. Qualifizierte Gleitzeit
- 2.7. Gesetzliche Regelungen für Gleitzeitmodelle in Deutschland
- 2.8. Vorteile und Nachteile von Gleitzeitmodellen für Mitarbeiter
- 2.9. Vorteile und Nachteile von Gleitzeitmodellen für Arbeitgeber
- 2.10. Zusammenfassung der wesentlichen Erkenntnisse und sich daraus ergebende Forschungsfragen
- 3. Methodik
- 3.1. Auswahl der angewandten Methode
- 3.2. Personenauswahl und Stichprobe
- 3.3. Dimensionale Analyse und Strukturbaum
- 3.4. Der Fragebogenaufbau
- 3.5. Fragebogenformulierung und Antwortskalierung
- 3.6. Pretest
- 3.7. Durchführung
- 4. Forschungsergebnisse
- 4.1. Darstellung der demografischen Daten
- 4.2. Erfassung der Auskünfte über die zeitliche Vereinbarkeit von Beruf und Studium
- 4.3. Erfassung der Auskünfte über Gleitzeitmodelle
- 4.4. Ergebnisinterpretation in Anbetracht der Forschungsfrage
- 5. Kritische Diskussion
- 5.1.1. Reflexion der eigenen Vorgehensweise
- 5.1.2. Objektivität
- 5.1.3. Validität
- 5.2. Zusammenfassung der Ergebnisse in Form von Handlungsempfehlungen
- 6. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Präferenzen berufsbegleitender Studierender für Gleitzeitmodelle und deren Auswirkungen auf die Vereinbarkeit von Beruf und Studium. Ziel ist es, ein besseres Verständnis für die Bedürfnisse dieser Studierenden zu schaffen und potenzielle Lösungen zur Verbesserung der zeitlichen Vereinbarkeit aufzuzeigen.
- Präferenzen berufsbegleitender Studierender bezüglich flexibler Arbeitszeitmodelle
- Auswirkungen von Gleitzeitmodellen auf die Vereinbarkeit von Beruf und Studium
- Kenntnisstand der Studierenden über verschiedene Gleitzeitmodelle
- Angebot von Gleitzeitmodellen durch Arbeitgeber
- Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der zeitlichen Vereinbarkeit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der zeitlichen Vereinbarkeit von Beruf und Studium bei berufsbegleitenden Studierenden ein. Es beschreibt die Problemstellung, die Zielsetzung der Arbeit und grenzt den Untersuchungsgegenstand ab. Der Aufbau der Arbeit wird skizziert, um dem Leser einen Überblick über die Struktur und den Inhalt zu geben. Die Einleitung legt den Fokus auf die Bedeutung flexibler Arbeitszeitmodelle für diese Zielgruppe und die Notwendigkeit einer detaillierten Untersuchung.
2. Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel liefert die theoretischen Grundlagen für die empirische Untersuchung. Es beleuchtet die Hintergründe des berufsbegleitenden Studiums, unterscheidet verschiedene Studienmodelle (Fernstudium, Präsenzstudium, Blended Learning) und analysiert die Herausforderungen der zeitlichen Vereinbarkeit von Beruf und Studium. Ein Schwerpunkt liegt auf der Darstellung verschiedener Modelle flexibler Arbeitszeitgestaltung, insbesondere Gleitzeitmodelle (mit und ohne Kernarbeitszeit, qualifizierte Gleitzeit), ihren Merkmalen, gesetzlichen Regelungen in Deutschland, sowie deren Vor- und Nachteile für Mitarbeiter und Arbeitgeber. Das Kapitel mündet in die Formulierung von Forschungsfragen, die im weiteren Verlauf der Arbeit untersucht werden.
3. Methodik: Dieses Kapitel beschreibt die methodische Vorgehensweise der Arbeit. Es erläutert die Auswahl der angewandten Methode (quantitative Untersuchung mittels einer Online-Umfrage), die Personenauswahl und die Zusammensetzung der Stichprobe. Die dimensionale Analyse und der Strukturbaum, die Entwicklung des Fragebogens inklusive Formulierung und Skalierung der Fragen, sowie die Durchführung eines Pretests werden detailliert dargestellt und begründet. Der methodische Abschnitt gewährleistet die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der empirischen Untersuchung.
4. Forschungsergebnisse: In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der durchgeführten Online-Umfrage präsentiert. Es beginnt mit der Darstellung der demografischen Daten der befragten berufsbegleitenden Studierenden. Anschließend werden die Ergebnisse zur zeitlichen Vereinbarkeit von Beruf und Studium sowie zu den Präferenzen bezüglich verschiedener Gleitzeitmodelle detailliert ausgewertet und in Tabellen und Grafiken visualisiert. Die Ergebnisse liefern wichtige Erkenntnisse über die Bedürfnisse und Erfahrungen der befragten Studierenden.
5. Kritische Diskussion: Dieses Kapitel diskutiert die Ergebnisse der Studie kritisch und reflektiert die eigene Vorgehensweise hinsichtlich Objektivität, Reliabilität und Validität. Die gewonnenen Erkenntnisse werden im Kontext bestehender Literatur eingeordnet und mögliche Limitationen der Studie werden aufgezeigt. Das Kapitel schließt mit Handlungsempfehlungen, die auf Basis der Forschungsergebnisse entwickelt wurden und Arbeitgebern und Hochschulen bei der Gestaltung von Arbeits- und Studienbedingungen helfen sollen.
Schlüsselwörter
Berufsbegleitende Studierende, Zeitliche Vereinbarkeit, Beruf und Studium, Flexible Arbeitszeitgestaltung, Gleitzeitmodelle, Jahresarbeitszeitkonto, Quantitative Forschung, Online-Umfrage.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt dieser Inhaltsangabe?
Diese Inhaltsangabe bietet eine Vorschau einer wissenschaftlichen Arbeit, die sich mit der Vereinbarkeit von Beruf und Studium unter besonderer Berücksichtigung von Gleitzeitmodellen befasst. Sie enthält ein Inhaltsverzeichnis, Zielsetzungen, Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste von Schlüsselwörtern.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Präferenzen berufsbegleitender Studierender bezüglich flexibler Arbeitszeitmodelle, Auswirkungen von Gleitzeitmodellen auf die Vereinbarkeit von Beruf und Studium, Kenntnisstand über verschiedene Gleitzeitmodelle, Angebot von Gleitzeitmodellen durch Arbeitgeber und Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der zeitlichen Vereinbarkeit.
Welche Studienmodelle werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet zwischen berufsbegleitendem Fernstudium, berufsbegleitendem Präsenzstudium und Blended Learning.
Welche Gleitzeitmodelle werden näher betrachtet?
Die Arbeit betrachtet Gleitzeitmodelle mit und ohne Kernarbeitszeit sowie qualifizierte Gleitzeit.
Welche methodische Vorgehensweise wird angewendet?
Es wird eine quantitative Untersuchung mittels einer Online-Umfrage durchgeführt. Die Erstellung des Fragebogens, inklusive Formulierung und Skalierung der Fragen, sowie die Durchführung eines Pretests werden detailliert dargestellt.
Was sind die Schlüsselwörter der Arbeit?
Die Schlüsselwörter sind: Berufsbegleitende Studierende, Zeitliche Vereinbarkeit, Beruf und Studium, Flexible Arbeitszeitgestaltung, Gleitzeitmodelle, Jahresarbeitszeitkonto, Quantitative Forschung, Online-Umfrage.
Welche Aspekte der zeitlichen Vereinbarkeit werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die Herausforderungen und Möglichkeiten der zeitlichen Vereinbarkeit von Beruf und Studium, insbesondere im Hinblick auf die Nutzung von Gleitzeitmodellen.
Was sind die Ziele der Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, ein besseres Verständnis für die Bedürfnisse berufsbegleitender Studierender in Bezug auf flexible Arbeitszeitmodelle zu schaffen und potenzielle Lösungen zur Verbesserung der zeitlichen Vereinbarkeit aufzuzeigen.
Welche Inhalte werden in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung führt in die Thematik ein, beschreibt die Problemstellung, die Zielsetzung der Arbeit, grenzt den Untersuchungsgegenstand ab und skizziert den Aufbau der Arbeit.
Welche Themen werden in den theoretischen Grundlagen behandelt?
Die theoretischen Grundlagen beleuchten die Hintergründe des berufsbegleitenden Studiums, unterscheiden verschiedene Studienmodelle, analysieren die Herausforderungen der zeitlichen Vereinbarkeit und stellen verschiedene Modelle flexibler Arbeitszeitgestaltung dar.
Wie wird die Methodik detailliert beschrieben?
Die Methodik beschreibt die Auswahl der angewandten Methode, die Personenauswahl und die Zusammensetzung der Stichprobe, die dimensionale Analyse und den Strukturbaum, die Entwicklung des Fragebogens sowie die Durchführung eines Pretests.
Was wird in den Forschungsergebnissen präsentiert?
In den Forschungsergebnissen werden die Ergebnisse der durchgeführten Online-Umfrage präsentiert, einschließlich der demografischen Daten der befragten Studierenden und der Ergebnisse zur zeitlichen Vereinbarkeit sowie zu den Präferenzen bezüglich verschiedener Gleitzeitmodelle.
Was wird in der kritischen Diskussion behandelt?
Die kritische Diskussion behandelt die Reflexion der eigenen Vorgehensweise hinsichtlich Objektivität, Reliabilität und Validität, die Einordnung der gewonnenen Erkenntnisse im Kontext bestehender Literatur und die Entwicklung von Handlungsempfehlungen.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2024, Zwischen Vorlesung und Arbeitsplatz. Präferenzen berufsbegleitender Studierender für flexible Gleitzeitmodelle im Arbeitsalltag, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1587081