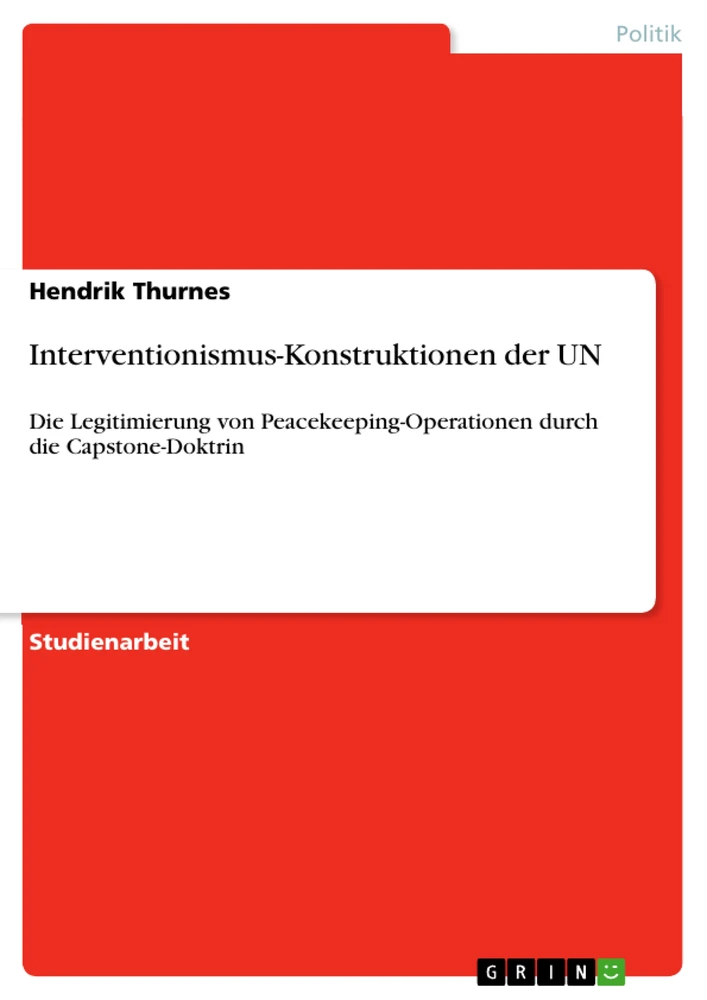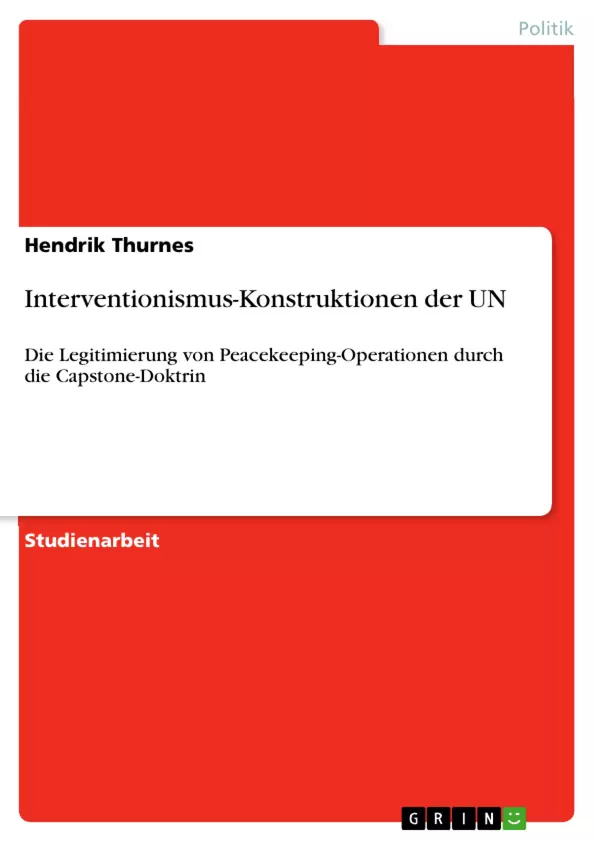Mit zum bedeutsamsten Typ von UN-Missionen gehören die Peacekeeping-Operationen, welche zeitnah nach Beilegung des Konflikts und im Einvernehmen mit den Konfliktparteien zur Aufrechterhaltung des Waffenstillstandes sowie der Schaffung langfristigen Friedens beitragen sollen und sich dabei militärischen, polizeilichen und zivilen Instrumenten bedienen. Maßgebliches Dokument für diesen Bereich ist die so genannte Capstone-Doktrin, welche 2008 durch das Department of Peacekeeping Operations der UN veröffentlicht wurde und den Anspruch hat, die Peacekeeping-Erfahrungen der letzten sechs Jahrzehnte in einer übergeordneten Leitlinie für alle bestehenden und folgenden Peacekeeping-Operationen zu bündeln.
Aus konstruktivistischer Perspektive kann die Capstone-Doktrin jedoch kaum die soziale Realität, sondern lediglich ein selbstgeschaffenes Abbild derselben wiedergeben, welches durch die spezifische Art und Weise der eigenen Beobachtung determiniert ist. Wirklichkeit ist in diesem Sinne das konstruierte Resultat von Wahrnehmungen und verhält sich so, wie sie beobachtet wird. Die durch Beobachtungen vorgenommenen Unterscheidungen und deren kollektive Anerkennung implizieren regelmäßig Unterschiede in den Machtverhältnissen und setzen Regeln, welche sich dann in der Sprache abbilden. Folglich ist anzunehmen, dass sich aus der Capstone-Doktrin nicht nur eine Legitimierung von Peacekeeping-Operationen ergibt, sondern dass sich übergeordnet eine UN-eigene Konstruktion der Wirklichkeit aufzeigen lässt, welche erst die maßgeblichen Prämissen bereitstellt, um die Legitimität der Interventionen logisch zu schlussfolgern.
Vor diesem Hintergrund lautet die zentrale Fragestellung dieser Arbeit, wie die UN in der Capstone-Doktrin in Bezug auf die Legitimierung von Peacekeeping-Operationen und insbesondere in Bezug auf den Einsatz von Gewalt Wirklichkeit konstruiert. Maßgeblich sind
hier unter anderem wertende Unterscheidungen zwischen verschiedenen Akteuren, sowie der Maßstab anhand dessen diese Unterscheidungen getroffen werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretisch-methodische Vorbemerkungen
- 2.1 Konstruktivismus
- 2.2 Inhaltsanalytische Kategorien
- 3. Capstone-Konstruktionen
- 3.1 Die Konstruktion von Akteurspositionen
- 3.1.1 Die Anderen
- 3.1.2 Die UN in der Selbstdarstellung
- 3.2 Die Legitimierung von Gewalt
- 3.3 Das Staatsideal der UN
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, wie die Vereinten Nationen (UN) in der Capstone-Doktrin von 2008 Wirklichkeit konstruieren, um Peacekeeping-Operationen und den damit verbundenen Gewalteinsatz zu legitimieren. Der Fokus liegt auf der konstruktivistischen Analyse der Doktrin und der Identifizierung der darin enthaltenen wertende Unterscheidungen zwischen verschiedenen Akteuren.
- Konstruktivistische Analyse der Capstone-Doktrin
- Legitimierung von Peacekeeping-Operationen durch die UN
- Konstruktion von Akteurspositionen in der Capstone-Doktrin
- UN-Selbstverständnis und die Legitimierung von Gewalt
- Das Staatsideal der UN im Kontext von Peacekeeping
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Legitimation von UN-Peacekeeping-Operationen ein und hebt die Notwendigkeit einer über die konsensfähigen Ziele von internationaler Sicherheit hinausgehenden Rechtfertigung hervor, insbesondere im Hinblick auf den oft implizierten Gewalteinsatz. Die Arbeit fokussiert auf die Capstone-Doktrin als zentrales Dokument und untersucht deren konstruktivistische Implikationen für das Selbstverständnis der UN und die Legitimation ihrer Interventionen.
2. Theoretisch-methodische Vorbemerkungen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es erläutert die konstruktivistische Perspektive auf die Konstruktion von Wirklichkeit, betont die Rolle von Wahrnehmung, Beobachtung und Sprache bei der Schaffung sozialer Realität und definiert die Bedeutung von Regeln und kollektiver Anerkennung für die Stabilität von sozialen Ordnungen. Es wird der regelorientierte Konstruktivismus als methodischer Rahmen vorgestellt, der die Wechselwirkung zwischen Regeln und Akteuren berücksichtigt. Die Kapitel beschreibt die für die folgende Inhaltsanalyse relevanten methodischen Aspekte.
3. Capstone-Konstruktionen: Dieses Kapitel stellt den Kern der Analyse dar. Es untersucht die Capstone-Doktrin unter konstruktivistischen Gesichtspunkten. Es analysiert, wie die UN in der Doktrin Akteurspositionen konstruiert, die Legitimierung von Gewalt darstellt, und welches Staatsideal die UN in diesem Kontext verfolgt. Die Analyse beleuchtet die sprachlichen Mittel und die konstruierten Unterscheidungen, die zur Legitimation von Peacekeeping-Operationen eingesetzt werden. Die Analyse untersucht, wie die UN ihr eigenes Bild und die Position der beteiligten Akteure darstellt, um die Legitimität der Interventionen zu begründen.
Schlüsselwörter
Peacekeeping-Operationen, Capstone-Doktrin, Konstruktivismus, Legitimation, Gewalt, Vereinte Nationen (UN), Akteurspositionen, Staatsideal, Wirklichkeitskonstruktion, Inhaltsanalyse.
Häufig gestellte Fragen zur Capstone-Doktrin der Vereinten Nationen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht, wie die Vereinten Nationen (UN) in der Capstone-Doktrin von 2008 Wirklichkeit konstruieren, um Peacekeeping-Operationen und den damit verbundenen Gewalteinsatz zu legitimieren. Der Fokus liegt auf der konstruktivistischen Analyse der Doktrin und der Identifizierung der darin enthaltenen wertenden Unterscheidungen zwischen verschiedenen Akteuren.
Welche Methoden werden verwendet?
Die Arbeit verwendet eine konstruktivistische Perspektive, um die Wirklichkeitskonstruktion in der Capstone-Doktrin zu analysieren. Der regelorientierte Konstruktivismus dient als methodischer Rahmen. Die Analyse beinhaltet eine inhaltsanalytische Untersuchung der Doktrin, um die sprachlichen Mittel und konstruierten Unterscheidungen zu identifizieren, die zur Legitimation von Peacekeeping-Operationen eingesetzt werden.
Welche zentralen Themen werden behandelt?
Zentrale Themen sind die konstruktivistische Analyse der Capstone-Doktrin, die Legitimierung von Peacekeeping-Operationen durch die UN, die Konstruktion von Akteurspositionen in der Doktrin, das UN-Selbstverständnis und die Legitimierung von Gewalt sowie das Staatsideal der UN im Kontext von Peacekeeping.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen theoretisch-methodischen Teil, den Hauptteil mit der Analyse der Capstone-Doktrin und ein Fazit. Der Hauptteil untersucht die Konstruktion von Akteurspositionen (inkl. der Darstellung der UN und anderer Akteure), die Legitimierung von Gewalt und das Staatsideal der UN, wie sie in der Doktrin zum Ausdruck kommen.
Welche Kapitel gibt es und worum geht es in ihnen?
Kapitel 1 (Einleitung): Einführung in die Thematik der Legitimation von UN-Peacekeeping und Fokussierung auf die Capstone-Doktrin. Kapitel 2 (Theoretisch-methodische Vorbemerkungen): Erläuterung des Konstruktivismus und der methodischen Vorgehensweise (Inhaltsanalyse). Kapitel 3 (Capstone-Konstruktionen): Kern der Analyse; Untersuchung der Akteurspositionen, der Legitimierung von Gewalt und des Staatsideals in der Capstone-Doktrin. Kapitel 4 (Fazit): Zusammenfassung der Ergebnisse.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Peacekeeping-Operationen, Capstone-Doktrin, Konstruktivismus, Legitimation, Gewalt, Vereinte Nationen (UN), Akteurspositionen, Staatsideal, Wirklichkeitskonstruktion, Inhaltsanalyse.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für ein akademisches Publikum gedacht, das sich mit den Themen Peacekeeping, internationale Beziehungen, Konstruktivismus und der Legitimation von Gewalt auseinandersetzt. Die Ergebnisse sind insbesondere für die Analyse von UN-Doktrinen und deren Auswirkungen relevant.
- Arbeit zitieren
- Dipl. Verwaltungswirt (FH) Hendrik Thurnes (Autor:in), 2010, Interventionismus-Konstruktionen der UN, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/159019