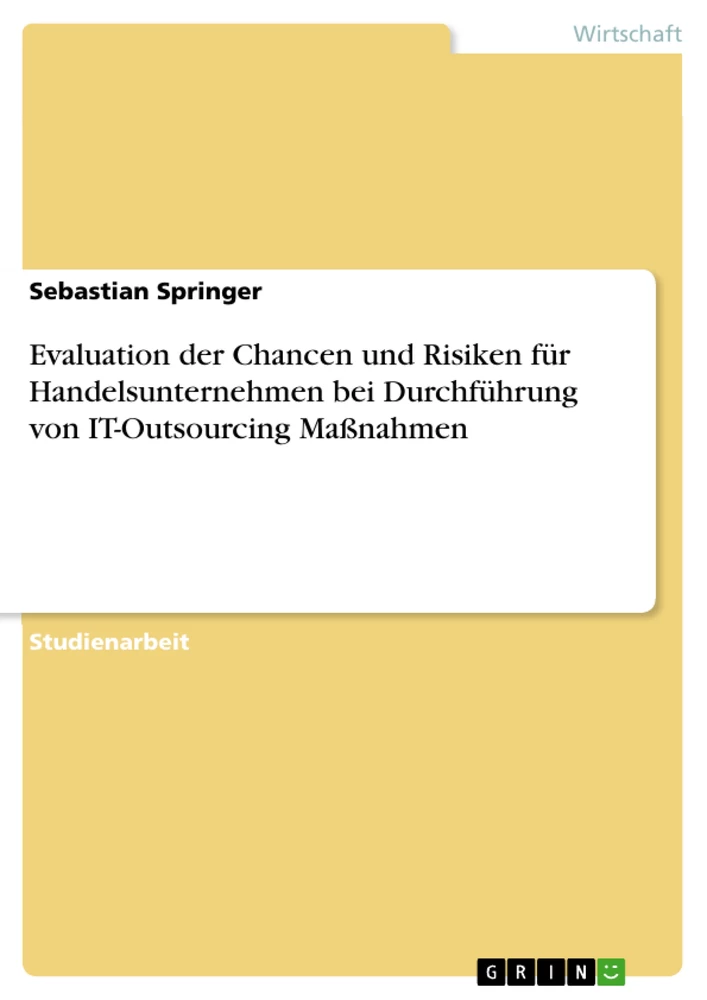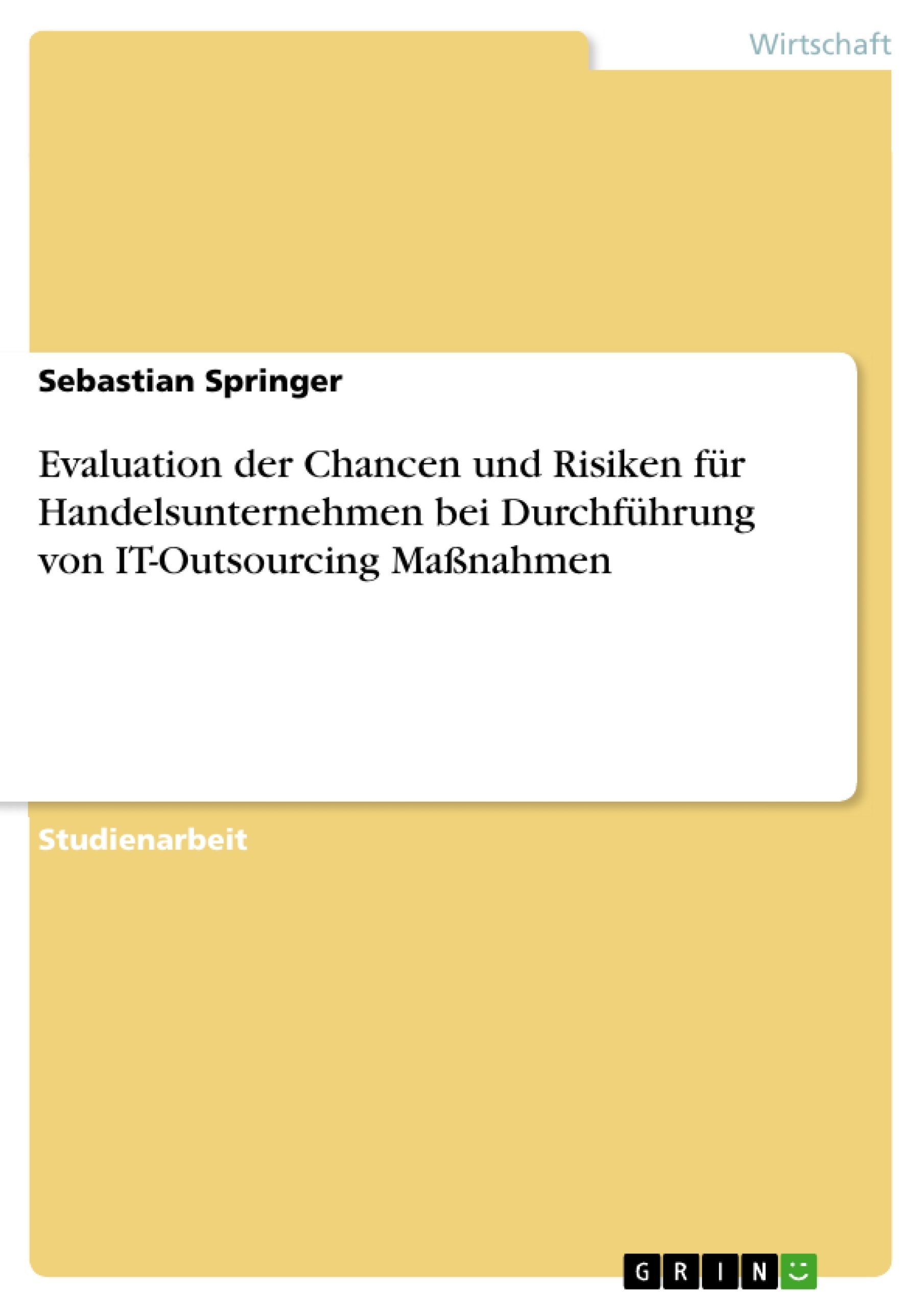Seit einigen Jahren befinden sich Handelsunternehmen in einem Wettlauf um
Prozessoptimierung und Kosteneinsparung. Dieser Wettlauf ist den immer stärker
auftretenden Preiskämpfen auf den Märkten geschuldet. Bereits zwischen 1991 und
2001 sank der Anteil des Einzelhandelsumsatzes am privaten Konsum um 10
Prozentpunkte. Besonders der Lebensmitteleinzelhandel hat mit einem massiven
Preisverfall zu kämpfen. Das deutsche Preisniveau liegt seit vielen Jahren unter dem
europäischen Durchschnitt. Diese Tendenzen führen in nahezu allen Bereichen des
Handels dazu, dass vor allem die Ausgabenseite über den Erfolg oder Misserfolg von
Unternehmen entscheidet. Bereits in den 1990er Jahren haben Unternehmen versucht,
unter Nutzung moderner Managementkonzepte ihre Prozesse zu glätten und an
externe Dienstleister auszugliedern, um somit Kosten zu sparen.
In der vorliegenden Arbeit sollen die Chancen und Risiken durch IT-
Outsourcing, speziell für deutsche Handelsunternehmen evaluiert werden. Das zweite
Kapitel enthält zunächst grundlegende Definitionen. Im dritten Kapitel werden
Vorgehensweisen der Unternehmen in der Praxis dargestellt und potenzielle Chancen
und Risiken evaluiert. Dies stellt den Schwerpunkt der Arbeit dar. Abschließend wird
ein Ausschnitt aktueller Entscheidungsinstrumente betrachtet und bewertet.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Begriffliche Grundlagen und Ausprägungen
- 2.1 Handel
- 2.1.1 Definition
- 2.1.2 Bedeutung von Informationstechnologie im Handel
- 2.2 Outsourcing
- 2.2.1 Definition
- 2.2.2 Historie
- 2.2.3 Begriffsvielfalt
- 2.2.4 Outsourcing
- 2.2.5 Insourcing
- 2.1 Handel
- 3 Die Outsourcing Praxis im Handel
- 3.1 Entwicklungen vor dem Outsourcing
- 3.2 Vorgehensweise im Outsourcing Projekt
- 3.2.1 Grundlagen
- 3.2.2 Pre-Plan
- 3.2.3 Plan
- 3.2.4 Build
- 3.2.5 Run
- 3.3 Chancen von Outsourcing
- 3.3.1 Zielstruktur
- 3.3.2 Operative Ziele
- 3.3.2.1 Kosten
- 3.3.2.2 Qualität
- 3.3.3 Strategische Ziele
- 3.4 Risiken von Outsourcing
- 3.4.1 Risikostruktur
- 3.4.2 Operative Risiken
- 3.4.2.1 Kosten
- 3.4.2.2 Qualität
- 3.4.3 Strategische Risiken
- 3.5 Entscheidungshilfen für die Anbieterwahl
- 4 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert die Chancen und Risiken, die sich für Handelsunternehmen aus der Durchführung von IT-Outsourcing-Maßnahmen ergeben. Im Fokus stehen dabei die Auswirkungen auf die Geschäftsprozesse und die strategische Positionierung der Unternehmen. Die Arbeit soll einen umfassenden Überblick über die relevanten Aspekte des IT-Outsourcing im Handel bieten und gleichzeitig praktikable Entscheidungsinstrumente für die Praxis liefern.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs "Handel"
- Entwicklung und Bedeutung von Informationstechnologie im Handel
- Vorgehensweisen und Herausforderungen beim IT-Outsourcing im Handel
- Chancen und Risiken von IT-Outsourcing für Handelsunternehmen
- Entscheidungshilfen und Kriterien für die Auswahl geeigneter Outsourcing-Partner
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die Einleitung stellt den aktuellen Wettbewerb im Handel und die Bedeutung von IT-Outsourcing als Instrument zur Prozessoptimierung und Kosteneinsparung dar.
- Kapitel 2: In diesem Kapitel werden die begrifflichen Grundlagen von Handel und Outsourcing erläutert und verschiedene Ausprägungen des Outsourcing-Konzepts vorgestellt.
- Kapitel 3: Dieses Kapitel analysiert die praktische Umsetzung von IT-Outsourcing-Maßnahmen im Handel. Es werden die verschiedenen Phasen des Outsourcing-Projekts beschrieben und die Chancen und Risiken aus der Perspektive der Handelsunternehmen bewertet.
Schlüsselwörter
IT-Outsourcing, Handel, Informationstechnologie, Prozessoptimierung, Kosteneinsparung, Chancen, Risiken, Entscheidungsinstrumente, Anbieterwahl, Geschäftsprozesse, Strategische Positionierung.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist IT-Outsourcing für Handelsunternehmen aktuell so relevant?
Handelsunternehmen stehen unter massivem Kostendruck und Preiskämpfen. IT-Outsourcing dient als Instrument zur Prozessoptimierung und Kosteneinsparung, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Welche operativen Ziele werden mit IT-Outsourcing verfolgt?
Die primären operativen Ziele sind die Reduzierung der IT-Kosten und die Steigerung der Qualität der IT-Dienstleistungen durch externe Experten.
Welche Risiken birgt das Outsourcing von IT-Leistungen?
Zu den Risiken zählen versteckte Kosten, Qualitätsverluste, Abhängigkeiten von Dienstleistern sowie strategische Risiken durch den Verlust von internem Know-how.
In welche Phasen unterteilt sich ein typisches Outsourcing-Projekt?
Ein Outsourcing-Projekt gliedert sich klassischerweise in die Phasen Pre-Plan, Plan, Build und Run.
Was ist der Unterschied zwischen Outsourcing und Insourcing?
Outsourcing bezeichnet die Auslagerung von Aufgaben an externe Partner, während Insourcing die Wiedereingliederung zuvor ausgelagerter Prozesse in das eigene Unternehmen beschreibt.
Welche Rolle spielt die Informationstechnologie im modernen Handel?
Die IT ist heute das Rückgrat des Handels, da sie effiziente Warenwirtschaftssysteme, Logistiksteuerung und E-Commerce ermöglicht.
- Citation du texte
- Sebastian Springer (Auteur), 2010, Evaluation der Chancen und Risiken für Handelsunternehmen bei Durchführung von IT-Outsourcing Maßnahmen , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/159126