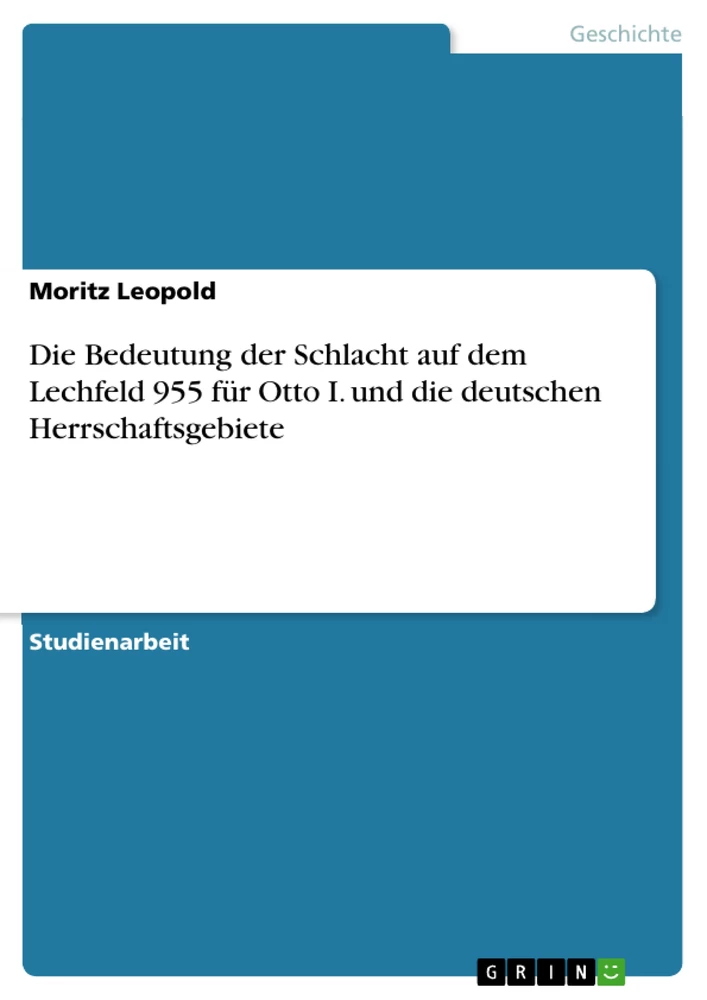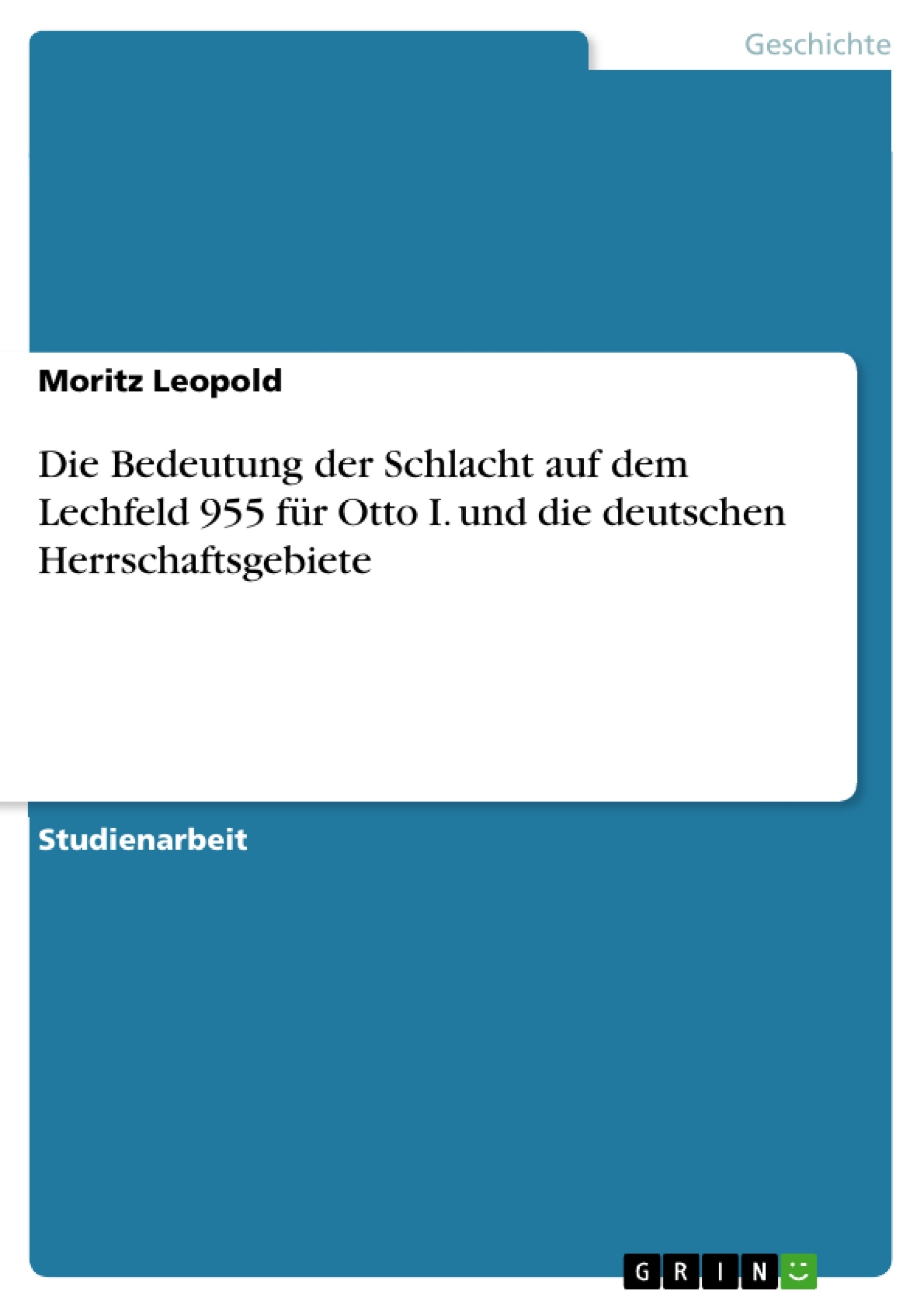Die Schlacht auf den Lechfeld 955 zählt bis heute nicht nur zu den populärsten Schlachten der mittelalterlichen deutschen Geschichte, sondern gilt auch als eine der bedeutendsten für die Gebiete des späteren deutschen Reiches. Die Gründe dafür sind sehr verschieden und sollen in den folgenden Gliederungspunkten erläutert werden.
In der vorliegen Arbeit wird untersucht, welche Auswirkungen die Schlacht auf dem Lechfeld für die weitere Herrschaft Ottos des Großen und für die gesamten Herrschaftsgebiete unter deutschem Einflussbereich hatte. Wichtige Punkte meiner Arbeit werden dabei die politische Ausgangslage am historischen Vorabend der Schlacht sein und der Einfluss dieser Situation auf den Einfall der Ungarn und das Zustandekommen der Schlacht überhaupt. Des Weiteren wird erläutert werden, welche Folgen das Aufeinandertreffen von Deutschen und Ungarn auf dem Lechfeld hatte. Der genaue Verlauf der Schlacht wird nur in einem kurzen Abschnitt behandelt, da er für den Inhalt dieser Arbeit keine direkte Rolle spielt.
Zeitlich bezieht sich die Darstellung der Ereignisse nicht nur auf das Jahr 955, sondern auch auf die Monate und Jahre vor der eigentlichen Schlacht. Um die Folgen und Bedeutung der militärischen Konfrontation auszuarbeiten, ist es unerlässlich, die politische Entwicklung innerhalb des Herrschaftsbereiches Ottos bis zum Zeitpunkt der finalen Auseinandersetzung mit den Ungarn in Ausschnitten darzustellen. Räumliche bezieht sich diese Arbeit sowohl auf das Lechfeld , als auch auf die verschiedenen deutschen Gebiete.
Die umfassendste und damit auch wichtigste Quelle aus dieser Zeit bildet Widukind von Corveys „Res gestae Saxonica“, eine Geschichte des Sachsenreiches, die er in den Jahren 967/968 schrieb und 973 ergänzte . Die drei Bücher dieses Werkes sind Mathilde, der späteren Äbtissin des Stifts Quedlinburg und Tochter Ottos I., gewidmet. Dementsprechend wird eine beschönigende Darstellung der sächsischen Geschichte vorgenommen, sodass eine Objektivität in Widukinds Berichten nur bedingt anzunehmen ist.
Ergänzend werde ich die „älteste Lebensbeschreibung des Heiligen Ulrich“ hinzuziehen, der die Belagerung Augsburgs durch die Ungarn 955 miterlebte. Ich möchte dabei so vorgehen, dass ich zunächst überblicksweise die politischen Verhältnisse im deutschsprachigen Raum schildere, anschließend kurz den Ablauf der Schlacht skizziere und abschließend eine zusammenfassende Darstellung in einem Fazit vornehme.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Politische Ausgangslage
- 2.1. Was ist „Deutschland“ im Frühmittelalter?
- 2.2. Die Magyaren - Gefahr aus dem Osten
- 2.3. Otto I. und der Kampf um politische Stabilität
- 3. Die Schlacht auf dem Lechfeld
- 3.1. Zur Lage des Lechfelds
- 3.2. Kurzer Abriss der Schlachtdarstellung
- 4. Folgen der Schlacht
- 4.1. Folgen der Schlacht für die Herrschaft Ottos I.
- 4.2. Folgen der Schlacht für die Herrschaftsgebiete auf deutschem Territorium
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung der Schlacht auf dem Lechfeld im Jahr 955 für die Herrschaft Ottos I. und die deutschen Herrschaftsgebiete. Die Analyse fokussiert auf die politische Ausgangslage vor der Schlacht, den Einfluss dieser Lage auf den ungarischen Einfall und die Folgen des militärischen Konflikts. Der genaue Schlachtverlauf wird nur kurz skizziert, da der Fokus auf den langfristigen Auswirkungen liegt.
- Politische Lage im 10. Jahrhundert und die Definition „Deutschlands“
- Die Bedrohung durch die Magyaren und Ottos Kampf um politische Stabilität
- Der Verlauf und die unmittelbaren Folgen der Schlacht auf dem Lechfeld
- Die langfristigen Auswirkungen der Schlacht auf Ottos Herrschaft
- Die Auswirkungen der Schlacht auf die verschiedenen deutschen Herrschaftsgebiete
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Schlacht auf dem Lechfeld (955) ein und beschreibt deren Bedeutung für die mittelalterliche deutsche Geschichte und das spätere deutsche Reich. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit, der sich auf die politische Ausgangslage, die Folgen der Schlacht für Ottos Herrschaft und die deutschen Gebiete konzentriert. Der Schlachtverlauf selbst wird nur kurz behandelt. Die Arbeit verwendet Widukinds „Res gestae Saxonicae“ und die „Vita Sancti Uodalrici“ als Hauptquellen, wobei die potenziellen Verzerrungen dieser Quellen angesprochen werden.
2. Politische Ausgangslage: Dieses Kapitel beleuchtet die politische Situation vor der Schlacht auf dem Lechfeld. Es beginnt mit der Klärung des Begriffs „Deutschland“ im 10. Jahrhundert, der zu dieser Zeit noch keine einheitliche politische Einheit bezeichnete, sondern verschiedene Herrschaftsgebiete umfasste. Es wird die Schwierigkeit karolingischer und nachkarolingischer Könige herausgestellt, die Kräfte ihrer Untertanen zu vereinen. Der Abschnitt behandelt die Bedrohung durch die Magyaren und Ottos Kampf um die politische Stabilität in diesem fragmentierten Machtgefüge. Die translatio imperii und die Vorstellung eines gemeinsamen Reiches der Deutschen werden als wichtiger Hintergrund erörtert.
3. Die Schlacht auf dem Lechfeld: Dieses Kapitel liefert einen kurzen Abriss der Schlacht auf dem Lechfeld, wobei der Fokus nicht auf dem detaillierten Verlauf, sondern auf der Bedeutung des Ereignisses für die weitere Entwicklung liegt. Die geographische Lage des Lechfelds wird kurz erläutert. Die Darstellung konzentriert sich auf die wesentlichen Aspekte, die für das Verständnis der späteren Folgen relevant sind, ohne in eine detaillierte militärhistorische Analyse einzutauchen.
4. Folgen der Schlacht: Dieses Kapitel analysiert die langfristigen Auswirkungen der Schlacht auf dem Lechfeld. Es wird sowohl der Einfluss auf Ottos Herrschaft als auch auf die verschiedenen deutschen Gebiete untersucht. Der Abschnitt beleuchtet, wie der Sieg Ottos I. seine Machtposition festigte und zur weiteren Konsolidierung seines Herrschaftsbereichs beitrug. Die Auswirkungen auf die verschiedenen Regionen des deutschen Territoriums werden im Detail betrachtet, unter Berücksichtigung der regionalen Unterschiede und der spezifischen Folgen des ungarischen Drucks.
Schlüsselwörter
Schlacht auf dem Lechfeld, Otto I., Magyaren, Frühmittelalter, deutsches Reich, politische Stabilität, Herrschaftsgebiete, Widukind von Corvey, Res gestae Saxonicae, Vita Sancti Uodalrici, translatio imperii.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Die Schlacht auf dem Lechfeld (955)
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Schlacht auf dem Lechfeld im Jahr 955 und deren Bedeutung für die Herrschaft Ottos I. und die deutschen Herrschaftsgebiete im Frühmittelalter. Der Fokus liegt auf der politischen Ausgangslage vor der Schlacht, dem Einfluss dieser Lage auf den ungarischen Einfall und den langfristigen Auswirkungen des militärischen Konflikts. Der genaue Schlachtverlauf wird nur kurz skizziert.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die politische Lage im 10. Jahrhundert, die Definition „Deutschlands“ zu dieser Zeit, die Bedrohung durch die Magyaren, Ottos Kampf um politische Stabilität, den Verlauf und die unmittelbaren Folgen der Schlacht auf dem Lechfeld, sowie die langfristigen Auswirkungen der Schlacht auf Ottos Herrschaft und die verschiedenen deutschen Herrschaftsgebiete. Die translatio imperii und die Vorstellung eines gemeinsamen Reiches der Deutschen werden ebenfalls erörtert.
Welche Quellen werden verwendet?
Als Hauptquellen werden Widukinds „Res gestae Saxonicae“ und die „Vita Sancti Uodalrici“ verwendet. Die Arbeit spricht die potenziellen Verzerrungen dieser Quellen an.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Einleitung, Politische Ausgangslage, Die Schlacht auf dem Lechfeld und Folgen der Schlacht. Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt den Aufbau der Arbeit. Kapitel 2 beleuchtet die politische Situation vor der Schlacht, inklusive der Definition von „Deutschland“ im 10. Jahrhundert und der Bedrohung durch die Magyaren. Kapitel 3 gibt einen kurzen Abriss der Schlacht, Kapitel 4 analysiert die langfristigen Auswirkungen auf Ottos Herrschaft und die deutschen Gebiete.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Schlacht auf dem Lechfeld, Otto I., Magyaren, Frühmittelalter, deutsches Reich, politische Stabilität, Herrschaftsgebiete, Widukind von Corvey, Res gestae Saxonicae, Vita Sancti Uodalrici, translatio imperii.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Bedeutung der Schlacht auf dem Lechfeld für die Herrschaft Ottos I. und die deutschen Herrschaftsgebiete. Sie analysiert die politische Ausgangslage, den ungarischen Einfall und die Folgen des Konflikts, wobei der Schwerpunkt auf den langfristigen Auswirkungen liegt.
Wie wird der Begriff „Deutschland“ in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit klärt den Begriff „Deutschland“ im 10. Jahrhundert, der zu dieser Zeit noch keine einheitliche politische Einheit, sondern verschiedene Herrschaftsgebiete umfasste.
Welche Rolle spielen die Magyaren in der Arbeit?
Die Magyaren werden als die Hauptbedrohung für die politische Stabilität im 10. Jahrhundert dargestellt, deren Einfall und die darauf folgende Schlacht auf dem Lechfeld den Fokus der Arbeit bilden.
Wie wird die Schlacht auf dem Lechfeld dargestellt?
Der Schlachtverlauf wird nur kurz skizziert; der Schwerpunkt liegt auf der Bedeutung des Ereignisses und seinen langfristigen Folgen für Ottos Herrschaft und die deutschen Gebiete.
Welche Folgen der Schlacht werden analysiert?
Die Arbeit analysiert die langfristigen Auswirkungen der Schlacht auf Ottos Herrschaft und die verschiedenen deutschen Gebiete, wobei die Festigung von Ottos Machtposition und die weitere Konsolidierung seines Herrschaftsbereichs im Vordergrund stehen.
- Arbeit zitieren
- Moritz Leopold (Autor:in), 2010, Die Bedeutung der Schlacht auf dem Lechfeld 955 für Otto I. und die deutschen Herrschaftsgebiete, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/159472