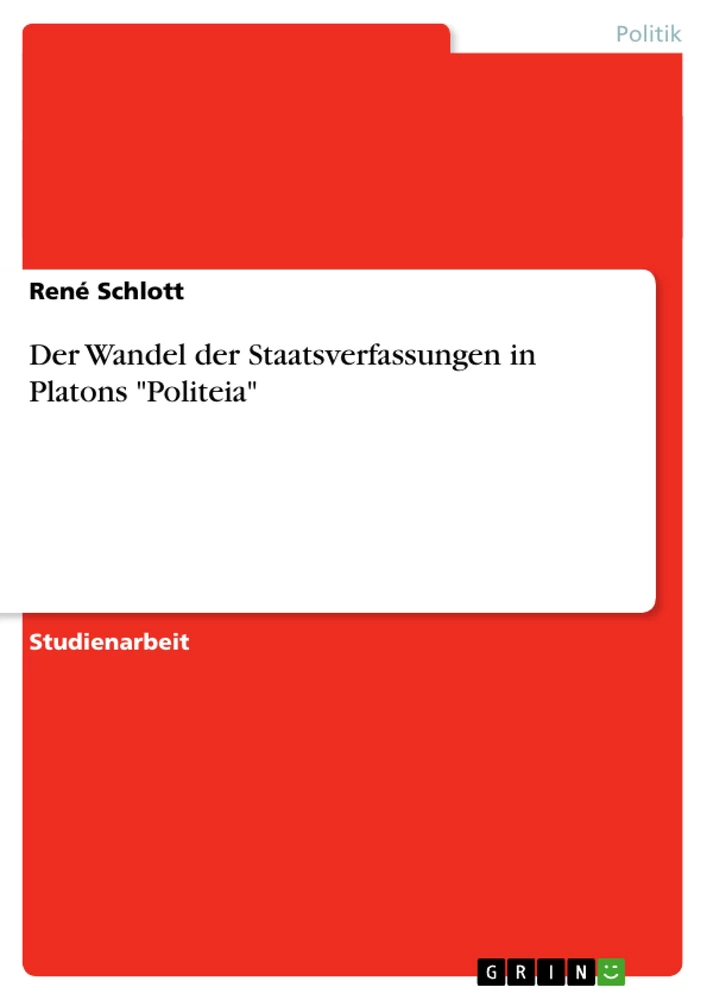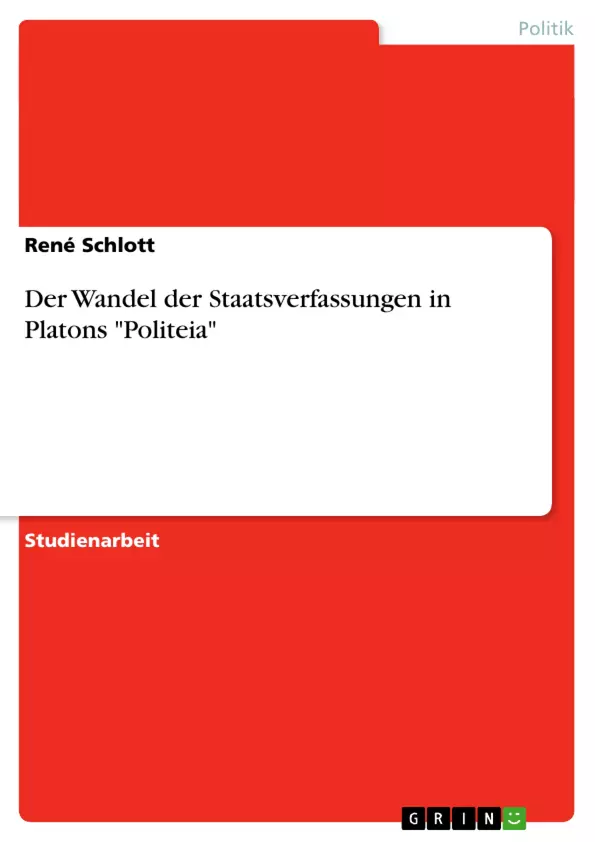Auf die Schilderung des besten Staates, seiner Ordnung, der Erziehung
seiner Philosophenherrscher und nach dem Erreichen des
„kompositorischen Gipfels“1 der Politeia im Höhlengleichnis, folgt im VIII.
und IX. Buch eine Darstellung der ungerechten Staatsverfassungen. Das
VIII. Buch beginnt daher zunächst mit einer Bilanz über die im bisherigen
Dialog erreichten Ergebnisse. (543a-c) Gleichzeitig schließt es an Buch V
an, wo die bereits begonnene Behandlung der schlechten Staatsformen
vom Wunsch der sokratischen Dialogpartner, mehr über die Lebensform
im besten Staat zu hören, unterbrochen worden war. (449a)
Nach dem Höhepunkt, der Beschreibung des idealen Staates, erfolgt nun
die „Vollendung des großen Entwurfs“2, weshalb dem besten Staat die
schlechteren und der schlechteste gegenübergestellt werden. An diesem
Vergleich entscheidet sich letztlich die Ausgangsfrage, zu der die
Thrasymachos – Position den Anstoß gab und zu deren Beantwortung die
ganze Politeia angelegt ist: Ob nicht durch ungerechtes Handeln das
größere Glück erreicht wird, als durch die Gerechtigkeit.? Sokrates nimmt
daher zu Beginn des VIII. Buches noch einmal ausdrücklich auf
Thrasymachos bezug.(545a)
Die nachfolgend dargestellten Verfassungen und ihre Abfolge
verdeutlichen Platons Absicht, den Abstand vom besten Staat/ von der
besten Stadt in Stufen zu verdeutlichen. Er legt dabei wiederum die
Analogie zwischen der Ordnung der Polis und der Ordnung der
Seelenkräfte im einzelnen Menschen zugrunde. Die gerechte
Polisordnung bezeichnet Platon als Monarchie oder Aristokratie. (445d-e)
Dort herrschen die Besten, d.h. die durch lange Erziehung zur höchsten
Vernunft Befähigten. Für Platon sind also die politische Verfasstheit und
der Charakter der Individuen nicht voneinander zu trennen, d.h. dass die
äußere Ordnung immer auch Ausdruck der in ihr zur Herrschaft gelangten
Mentalität ist. Im VIII. Buch entfaltet er daher systematisch eine politische
Typologie, indem er bei jedem Staatstypus Entstehung und Wesen erklärt und dann nach demselben Schema den ihm entsprechenden
Menschentypus charakterisiert.
Die Beschäftigung mit diesem Abschnitt seines Werkes ist noch heute
anregend und fruchtbar, weil er auf die Darstellung der „Verfallsreihe“3 der
Staatsformen nicht nur „höchste künstlerische Meisterschaft, sondern
auch die ganze Tiefe seines kritischen Geistes angewendet“4 hat.
1 Demandt, S.86.
2 Zehnpfennig, S.132.
3 Zehnpfennig, S.132.
4 Vretska, S.595 Anm.1.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die ungerechten Verfassungen und die ihnen entsprechenden Menschen
- Timokratie und timokratischer Mensch (545c-550c)
- Oligarchie und oligarchischer Mensch (550c-555b)
- Demokratie und demokratischer Mensch (555b-562a)
- Tyrannis und tyrannischer Mensch (562a-588a)
- Die Kritik Aristoteles' im Buch V. seiner „Politik“ (1315b-1316b)
- Die Kritikpunkte Aristoteles'
- Einwände gegen die aristotelische Kritik
- Deutung und Fazit
- Quellen- und Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit der Entwicklung der Staatsformen in Platons „Politeia“ und der Degeneration vom idealen Staat hin zu ungerechten Verfassungen. Die Analyse konzentriert sich auf die Darstellung der vier ungerechten Staatsformen im VIII. Buch und die Kritik Aristoteles' im V. Buch seiner „Politik“.
- Degeneration des idealen Staates in Platons „Politeia“
- Kritik der ungerechten Staatsformen: Timokratie, Oligarchie, Demokratie und Tyrannis
- Analyse der Beziehung zwischen politischer Ordnung und Charakter des Einzelnen
- Bedeutung der „vollendeten Zahl“ für die Erhaltung des idealen Staates
- Kritik Aristoteles' an Platons Staatslehre
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext der Analyse dar und beleuchtet die Bedeutung des VIII. und IX. Buches der „Politeia“ im Rahmen von Platons Staatslehre. Kapitel 2 behandelt die vier ungerechten Staatsformen: Timokratie, Oligarchie, Demokratie und Tyrannis. Es werden die entsprechenden Menschentypen und die Gründe für die Degeneration des idealen Staates analysiert. Kapitel 3 diskutiert die Kritik Aristoteles' an Platons Staatslehre im Buch V. seiner „Politik“. Es werden die Kritikpunkte Aristoteles' vorgestellt und kritisch bewertet. Der Text endet mit einer Interpretation und einem Fazit.
Schlüsselwörter
Platon, Politeia, Staatsformen, Degeneration, Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit, Timokratie, Oligarchie, Demokratie, Tyrannis, Aristoteles, Politik, Kritik.
Häufig gestellte Fragen
Welche vier ungerechten Staatsformen beschreibt Platon?
Platon beschreibt die Degenerationsstufen Timokratie, Oligarchie, Demokratie und schließlich die Tyrannis.
Wie hängen politische Ordnung und individueller Charakter zusammen?
Für Platon ist die äußere Ordnung eines Staates immer ein Ausdruck der Mentalität und der Seelenkräfte der Menschen, die in ihm herrschen.
Was ist der ideale Staat laut Platon?
Der ideale Staat ist die Aristokratie oder Monarchie, in der die "Besten" – die Philosophenherrscher – auf Basis von Vernunft und Gerechtigkeit regieren.
Welche Kritik äußerte Aristoteles an Platons Modell?
Aristoteles kritisierte in seinem Werk "Politik" unter anderem die Unausweichlichkeit der von Platon beschriebenen Verfallsreihe der Staatsformen.
Was ist die zentrale Frage der "Politeia"?
Die Untersuchung, ob ein gerechtes Leben glücklicher macht als ein ungerechtes Leben.
- Quote paper
- René Schlott (Author), 2003, Der Wandel der Staatsverfassungen in Platons "Politeia", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/15950