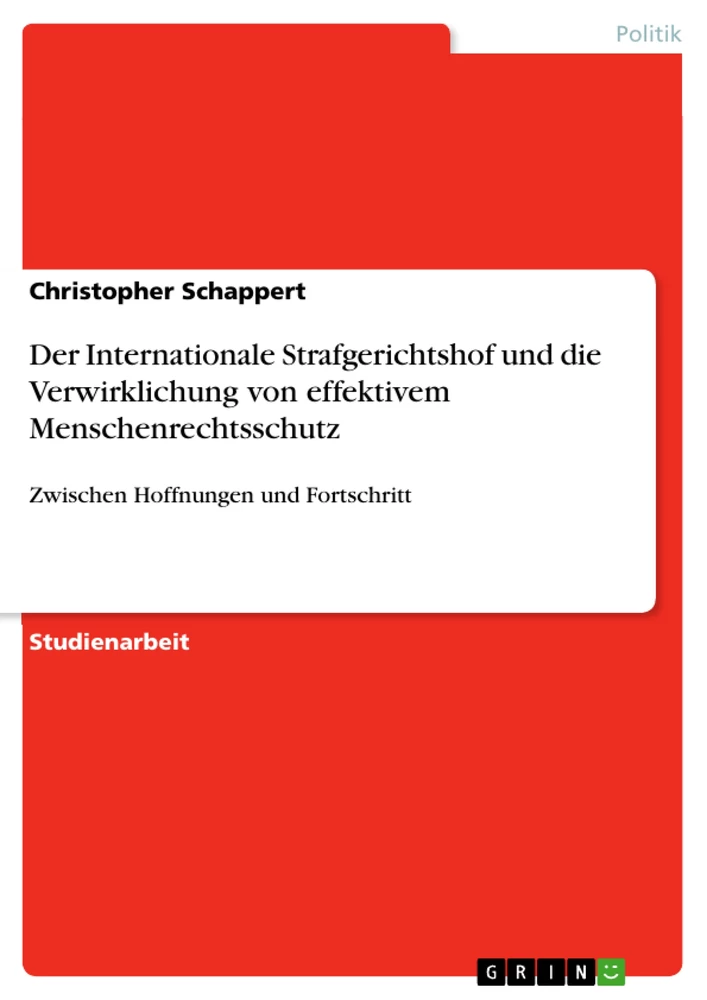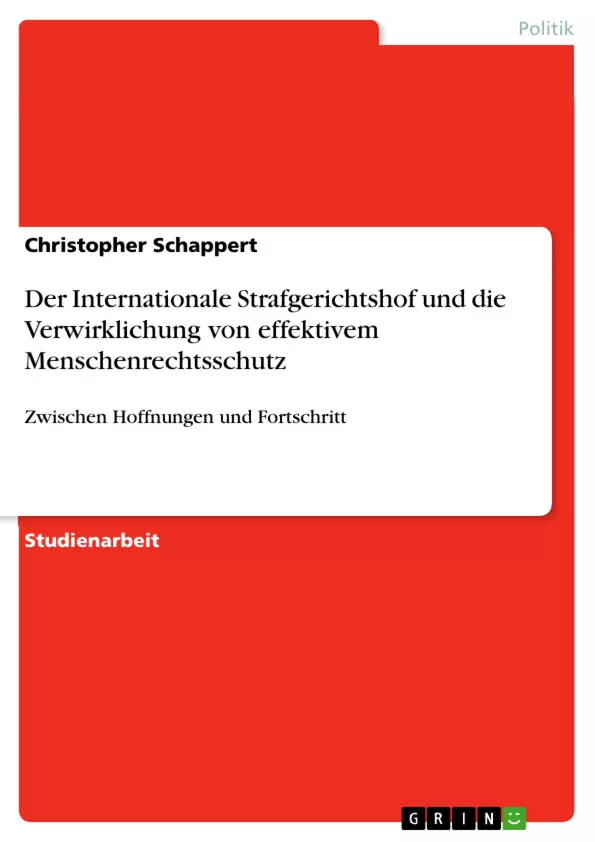„The establishment of the Court is […] a gift of hope to future generations, and a giant step forward in the march towards universal human rights and the rule of law. It is an achievement which, only a few years ago, nobody would have thought possible”.
Mit dieser Aussage brachte der damalige Generalsekretär der Vereinten Nationen (VN), Kofi Annan, die Erwartungen an und Hoffnungen in den neu zu gründenden ständigen Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) zum Ausdruck. Der internationale Menschenrechtsschutz erfolgte bis dato in erster Linie durch den Beitritt zu völkerrechtlichen Verträgen: „Das traditionelle Völkerrecht kennt keine zentrale Rechtsdurchsetzungsinstanz und überlässt die Durchsetzung internationaler Rechtsnormen den Staaten“. Die Erfahrungen des 20. Jahrhunderts, mit einer großen Zahl von Verbrechen gegen die Menschlichkeit und gravierenden Menschenrechtsverletzungen, führten dazu, dass ein Großteil der internationalen Staatengemeinschaft 1998 in Rom die Errichtung einer globalen Rechtsprechungsinstitution mit Sitz in Den Haag beschloss, um Makro-Straftaten verfolgen zu können. Vorrangig war das Ziel, dass von nun an nicht mehr von Straffreiheit bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit ausgegangen werden kann. Mehrheitlich herrschte die Ansicht, dass sich dauerhafter Frieden in einer globalisierten Gesellschaft nur dann verwirklichen lässt, wenn schwere Rechtsverletzungen multilateral anerkannter Rechtsgüter nicht straflos blieben.
Staaten, Nichtregierungsorganisationen und die weltweite Öffentlichkeit äußerten sehr hohe Erwartungen und Hoffnungen an den neuen Gerichtshof und seine weitreichende Verantwortlichkeit für internationale Makro-Verbrechen, welche in unmittelbarem Zusammenhang zu Menschrechtsverletzungen stehen. Betont wurde vor allem die Bedeutung für Gerechtigkeit, den Weltfrieden und das transformative Potential, welches sich für die Mitgliedstaaten ergibt. Auch wenn bis heute das Römische Statut zum IStGH durch die Mehrheit der Staaten ratifiziert worden ist, so ist nicht die Mehrheit der Weltbevölkerung vertreten und somit kann nicht von einer vollständigen Unterstützung durch die internationale Staatengemeinschaft gesprochen werden.
Die hohen Erwartungen und Hoffnungen, die sich von vielen Seiten aufgetan haben, sollen in dieser Arbeit beleuchtet und ca. acht Jahre nach der Einrichtung des IStGH einer ersten Überprüfung unterzogen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Mit großen Schritten und viel Hoffnung zu einer gerechteren Welt?
- Entstehung und theoretischer Anspruch des Internationalen Strafgerichtshof:
Das Ende der Straflosigkeit bei schweren Menschenrechtsverletzungen?
- Von Nürnberg nach Rom: Die Entstehung des IStGH als Ende einer Suche nach internationaler Strafgerichtsbarkeit?
- Der Anlauf zur Institutionalisierung eines effektiven Internationalen Strafgerichtshofes: Das Römische Statut und Möglichkeiten für den Menschenrechtsschutz
- Von hostility zu positive engagement: Wandel oder Kontinuität der US- amerikanischen Einstellung zum IStGH von Clinton bis Obama?
- Grenzen des internationalen Jurisdiktionsanspruchs: Prälimitierende Problemfelder einer globalen Strafgerichtsbarkeit?
- Der IStGH und Frieden: Friedensstiftenden Wirkung zwischen Theorie und Praxis
- Anspruch trifft auf Wirklichkeit: Der IStGH und seine ersten Fälle – Uganda und Sudan
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entstehung und den theoretischen Anspruch des Internationalen Strafgerichtshofes (IStGH) sowie seine Bedeutung für den effektiven Menschenrechtsschutz. Sie beleuchtet die Erwartungen an und Hoffnungen in den IStGH, die nach seiner Gründung im Jahr 2002 entstanden sind. Dabei werden die Herausforderungen und Grenzen des IStGH, insbesondere im Hinblick auf die Beziehung zu den USA, die Problemfelder seiner Jurisdiktion sowie die praktische Umsetzung in den Fällen Uganda und Sudan, untersucht.
- Entstehung und theoretischer Anspruch des IStGH
- Die Rolle der USA im Kontext des IStGH
- Grenzen und Problemfelder des IStGH
- Der IStGH und seine Auswirkungen auf den Frieden
- Praktische Anwendung des IStGH in Uganda und Sudan
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Entstehung des Internationalen Strafgerichtshofes (IStGH) und seine Bedeutung für den Menschenrechtsschutz. Es analysiert die Hoffnungen und Erwartungen, die mit der Gründung des Gerichtshofes verbunden waren, und setzt diese in den Kontext der Geschichte internationaler Strafgerichtsbarkeit. Kapitel zwei befasst sich mit der Beziehung der USA zum IStGH. Dabei werden die US-amerikanische Politik und die Entwicklung der Einstellung gegenüber dem IStGH von der Clinton- bis zur Obama-Administration analysiert. Kapitel drei fokussiert auf die Grenzen des internationalen Jurisdiktionsanspruchs des IStGH und diskutiert die Herausforderungen und Problemfelder einer globalen Strafgerichtsbarkeit.
Schlüsselwörter
Internationaler Strafgerichtshof, Menschenrechtsschutz, Strafgerichtsbarkeit, Völkerrecht, Globalisierung, Frieden, Gerechtigkeit, USA, Uganda, Sudan, Römisches Statut, Jurisdiktion.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Aufgabe des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH)?
Der IStGH ist eine ständige Institution zur Verfolgung schwerster Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Völkermord und Kriegsverbrechen, um Straffreiheit weltweit zu beenden.
Was ist das Römische Statut?
Das Römische Statut ist die völkerrechtliche Grundlage von 1998, die die Errichtung, Zuständigkeit und Arbeitsweise des IStGH regelt.
Wie stehen die USA zum Internationalen Strafgerichtshof?
Die Haltung der USA wandelte sich über die Jahre von Ablehnung unter Clinton/Bush hin zu einem „positiven Engagement“ unter Obama, wobei eine volle Ratifizierung ausblieb.
Welche ersten Fälle hat der IStGH bearbeitet?
Die Arbeit untersucht insbesondere die praktischen Erfahrungen und Verfahren im Zusammenhang mit den Konflikten in Uganda und im Sudan.
Kann der IStGH tatsächlich zum Weltfrieden beitragen?
Die Arbeit diskutiert das friedensstiftende Potential des Gerichts zwischen Theorie (Abschreckung durch Recht) und Praxis (Herausforderungen bei der Durchsetzung).
- Quote paper
- Christopher Schappert (Author), 2010, Der Internationale Strafgerichtshof und die Verwirklichung von effektivem Menschenrechtsschutz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/159702