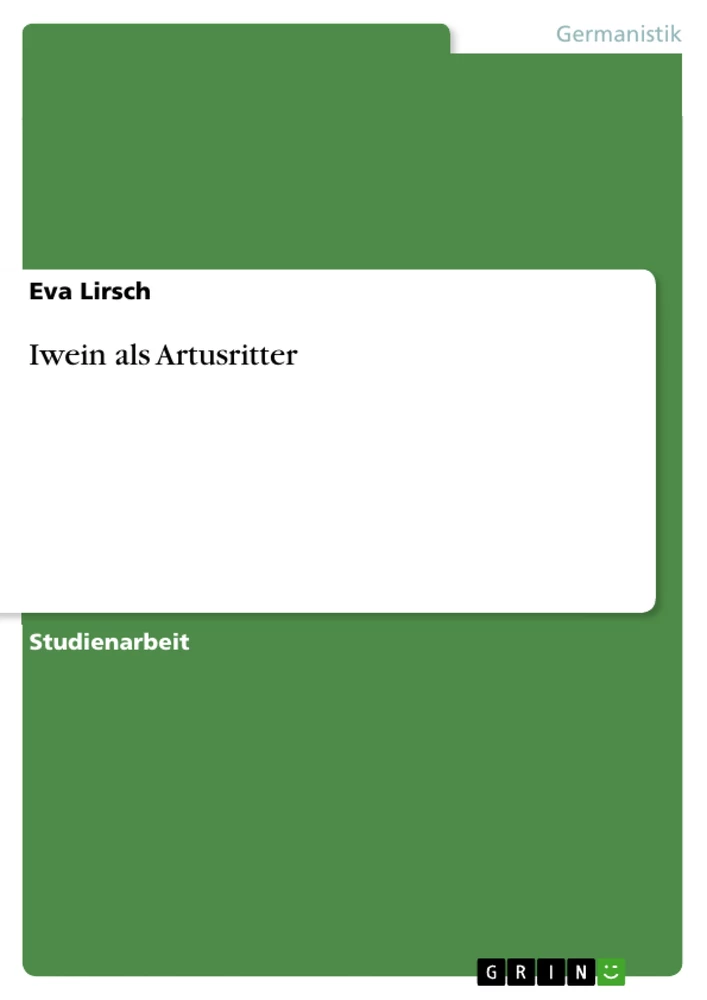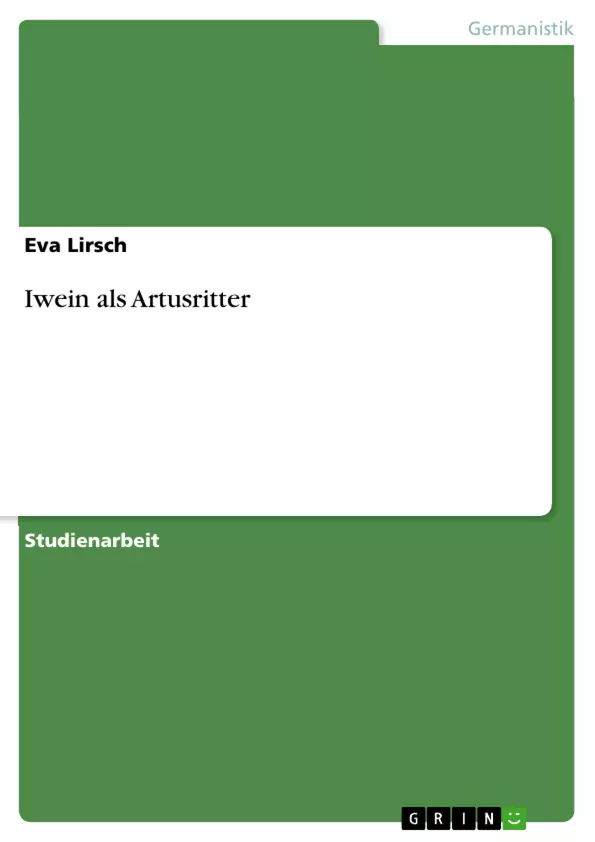Laut Victor Turner, einem amerikanischen Anthropologen, liegen menschlichen Erfahrungen bestimmte Prozesse zugrunde, sogenannte „soziale Dramen“ , bestehend aus vier aufeinanderfolgenden Phasen: „Am Anfang steht der Bruch oder Konflikt zwischen gesellschaftlichen Elementen (1), der eine Krise (2) heraufbeschwört, deren Bewältigung (3) häufig die Reintegration einer Person oder eines gesellschaftlichen Elements in die soziale Struktur zur Folge hat.“ Dieses Grundschema läßt sich unschwer im Artus-Roman wiederfinden: Aus dem Konflikt oder Bruch mit gesellschaftlichen Normen (erster Handlungszyklus) resultiert die Krise des Helden. Die Bewältigung, das Begreifen der gesellschaftlichen Regeln (zweiter Handlungszyklus) mündet in die Reintegration in die Gesellschaft (Schlußeinkehr).
Inhaltsverzeichnis
- Iwein als Artusritter
- Der Zauberbrunnen als Minnesymbol
- Iwein und Laudine
- Iwein und Lunete
- Wahnsinn als Infragestellen der Männlichkeit?
- Iwein, der „,riter, der des lewen pflac“
- Schlußdiskussion: Warum ist Iwein ein Held?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit analysiert die Figur des Iwein im gleichnamigen Artusroman von Hartmann von Aue. Sie beleuchtet Iweins Entwicklung als Ritter und seine Rolle in der höfischen Gesellschaft. Darüber hinaus wird der Zauberbrunnen als zentrales Symbol des Romans untersucht und seine Bedeutung für die Minne und Iweins innere Wandlung dargestellt.
- Iweins Entwicklung vom jugendlichen Ritter zum gereiften Helden
- Das Motiv des Zauberbrunnens als Symbol der Minne und der spirituellen Wandlung
- Die Rolle der Frau in Iweins Leben und ihre Bedeutung für seine Entwicklung
- Die Frage nach der Männlichkeit und der Herausforderung durch Iweins Wahnsinn
- Iweins Beitrag zum Artusroman und seine Relevanz für die mittelalterliche Literatur
Zusammenfassung der Kapitel
- Iwein als Artusritter: Dieses Kapitel stellt den Kontext des Romans und die Figur des Iwein im Rahmen der Artus-Sage vor. Es beleuchtet die Bedeutung des Rittertums und der höfischen Gesellschaft im Mittelalter und zeigt Iweins anfängliche Begeisterung für das Ritterleben.
- Der Zauberbrunnen als Minnesymbol: Hier wird der Zauberbrunnen als zentrales Symbol des Romans vorgestellt. Die Analyse des Brunnenmotivs und seiner verschiedenen Bedeutungen zeigt die Verbindung des Brunnens mit der Minne und der spirituellen Wandlung des Helden.
- Iwein und Laudine: Dieses Kapitel beschreibt die Beziehung zwischen Iwein und Laudine, der Herrin des Zauberbrunnens. Es beleuchtet die Rolle der Minne in Iweins Leben und die Herausforderungen, die diese Beziehung für ihn mit sich bringt.
- Iwein und Lunete: Hier wird die Beziehung zwischen Iwein und Lunete, der treuen Begleiterin Laudines, vorgestellt. Die Analyse der Rolle Lunetes zeigt, wie sie Iwein durch schwierige Zeiten begleitet und ihn auf seinem Weg zur Reife unterstützt.
- Wahnsinn als Infragestellen der Männlichkeit?: Dieses Kapitel behandelt Iweins Wahnsinn und seine Bedeutung für die Männlichkeit im Mittelalter. Es analysiert, wie Iweins Krankheit seine Ritterlichkeit infrage stellt und gleichzeitig die Rolle der Frauen in seiner Genesung betont.
- Iwein, der „,riter, der des lewen pflac“: Das Kapitel beleuchtet Iweins Weg zur Reife und die Wiedererlangung seiner Ritterlichkeit. Es zeigt, wie Iwein seine Erfahrungen verarbeitet und zu einem gereiften und bewährten Ritter wird.
Schlüsselwörter
Die Seminararbeit beschäftigt sich mit zentralen Themen der mittelalterlichen Literatur, wie dem Rittertum, der Minne, der höfischen Gesellschaft und der spirituellen Wandlung. Die Analyse der Figur des Iwein und des Zauberbrunnens ermöglicht einen Einblick in die Wertevorstellungen und die Lebenswelt des Mittelalters. Wesentliche Themen sind die Bedeutung des Ritters als Idealbild, die Rolle der Frau in der Minne und die Bewährungsprobe, die Iwein durch den Wahnsinn erlebt.
Häufig gestellte Fragen
Wer ist die Hauptfigur im Roman "Iwein"?
Die Hauptfigur ist Iwein, ein Ritter der Tafelrunde von König Artus, dessen Entwicklung vom jugendlichen Abenteurer zum gereiften Helden beschrieben wird.
Was symbolisiert der Zauberbrunnen?
Der Zauberbrunnen steht für die Minne (Liebe), dient als Ort der Herausforderung und ist ein Symbol für die spirituelle Wandlung des Helden.
Warum verfällt Iwein dem Wahnsinn?
Iwein vergisst ein Versprechen gegenüber seiner Frau Laudine, was zum Verlust seiner Ehre und seiner Identität führt und ihn in den Wahnsinn treibt.
Welche Rolle spielt Lunete in der Geschichte?
Lunete ist eine kluge Vertraute, die Iwein hilft, die Gunst Laudines zu gewinnen und ihn auf seinem Weg zur Reintegration in die Gesellschaft unterstützt.
Was bedeutet der Beiname „Ritter mit dem Löwen“?
Nachdem Iwein einen Löwen rettet, wird dieser sein treuer Begleiter und symbolisiert Iweins neue, geläuterte Art des Rittertums.
- Arbeit zitieren
- Mag. Eva Lirsch (Autor:in), 2004, Iwein als Artusritter, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/160096