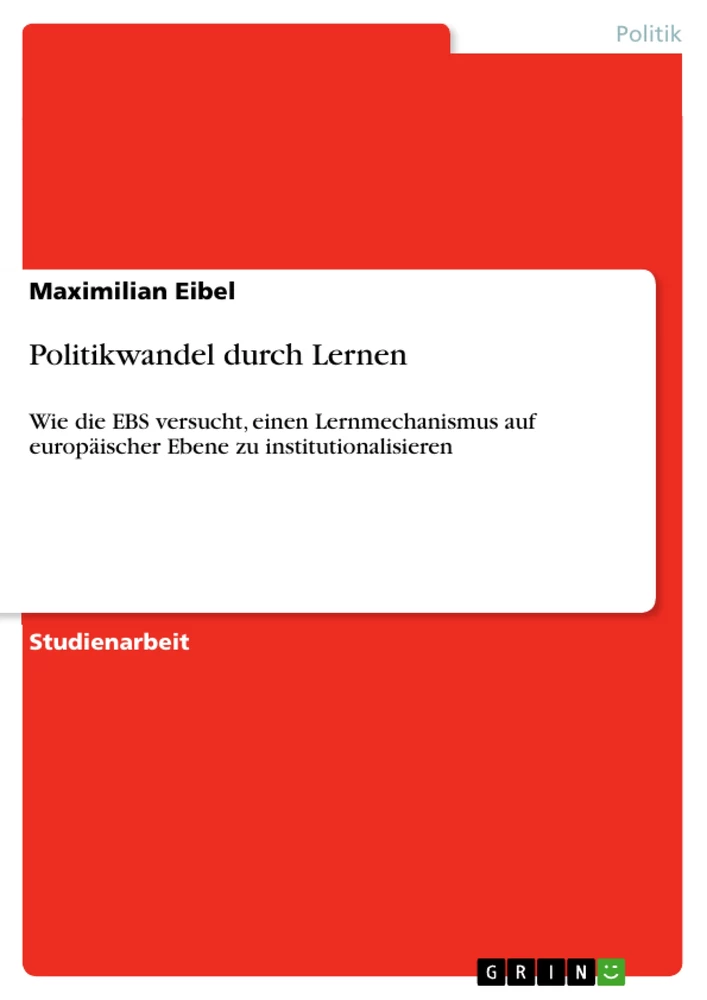Nach dem Anstieg der Arbeitslosenquote in der Europäischen Union (EU) während der neunziger Jahre – der zum Teil auf die Verwirklichung der Maastricht-Kriterien zurückzuführen ist – entschied sich die Kommission zu einem einheitlichen Vorgehen in der Beschäftigungspolitik. Mit der Europäischen Beschäftigungsstrategie (EBS) sollten gemeinsame Mindeststandards und Ziele festgelegt werden, um einen ruinösen Wettbewerb der nationalen Arbeitsmärkte zu verhindern. Man einigte sich 1997 darauf, mit dem Stabilitätspakt ein eigenständiges Beschäftigungskapitel anzuhängen ohne aber Kompetenzen an die EU in diesem Politikfeld abzutreten. Angestrebt war keine Vorrichtung zu verpflichtendem Policy-Transfer, sondern ein Koordinierungsmechanismus (der Luxemburger Prozess und ab 2000 die Offene Methode der Koordinierung), der die Beschäftigungspolitiken der Mitgliedstaaten auf einen Europäischen Kurs bringt ohne dabei bindenden Charakter zu haben. Dieses als soft-law bezeichnetes Mittel besitzt rechtlichen Inhalt und zielt durch einen schrittweisen Prozess der Zielformulierung, Operationalisierung, Berichterstattung, Kritik und Neuformulierung – der zwischen der europäischen Kommission und den MS abläuft – darauf ab, die nationalen Arbeitsmarktpolitiken quasi kognitiv zu „framen“ (vgl. Schmid/Kull). Dieses geschieht durch die Angabe eines übergeordneten Ziels wie die präventive Ausrichtung der Arbeitsmarktpolitik. Die Offene Methode der Koordinierung (OMK) bildet einen sich jährlich wiederholenden Prozess, der nicht nur auf die Konvergenz nationaler Beschäftigungspolitiken zielt, sondern vor allem ein neuartiges Forum für das Lernen zwischen den Mitgliedstaaten schafft.Der Versuch, Policy-Lernen durch die OMK zu institutionalisieren, wird von einigen Autoren „als „dritten Weg“ europäischen Regierens zwischen europäischer Harmonisierung und nationaler Selbständigkeit“ (Buchkremer/ Zirra 2007: 3))bezeichnet. Aufgrund der mangelnden Sanktionsmechanismen, den institutionell gefestigten und unterschiedlichen Pfaden der nationalen Beschäftigungspolitiken sowie den unterschiedlichen Eigeninteressen stellt sich die Frage, inwiefern die OMK dazu geeignet ist, das Lernen innerhalb der Mitgliedstaaten zu stimulieren?
Im Anschluss daran wird zum allgemeinen Verständnis der Ablauf der OMK dargestellt.Der Schwerpunkt liegt hierbei auf der Untersuchung der Instrumente der OMK wie dem Benchmarking,den Empfehlungen oder der Indikatoren,die verschiedene Lernmechanismen begünstigen sollen
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Drei Formen des Lernens
- Einfaches Lernen
- Komplexes Lernen
- Bedingungen des Lernens
- Die Europäische Beschäftigungsstrategie
- Ablauf der Offenen Methode der Koordinierung
- Instrumente der OMK
- Leitlinien und Empfehlungen
- Indikatoren
- Nationale Reformpläne
- Programm zum gegenseitigen Lernen
- Gemeinsamer Fortschrittsbericht
- Policy-Transfer durch Lernen am Beispiel Deutschlands
- Das Problem der Kausalität
- Lernprozesse in Deutschland?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert den Versuch der Europäischen Beschäftigungsstrategie (EBS), einen Lernmechanismus auf europäischer Ebene zu institutionalisieren. Sie befasst sich insbesondere mit der Offenen Methode der Koordinierung (OMK) als Instrument der EBS und untersucht, inwiefern sie in der Lage ist, Lernprozesse innerhalb der Mitgliedstaaten zu stimulieren.
- Die verschiedenen Formen des Lernens und ihre Bedeutung für die Analyse von Politikwandel
- Die Bedingungen, die für den Lernprozess notwendig sind
- Die Instrumente der OMK und ihre Rolle bei der Förderung von Lernprozessen
- Die Herausforderungen bei der Erfassung von Lernprozessen am Beispiel Deutschlands
- Die Frage, ob die OMK tatsächlich einen effektiven Lernmechanismus auf europäischer Ebene darstellt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Ausgangslage der Arbeit dar und beschreibt den Versuch der EU, durch die EBS die Beschäftigungspolitik der Mitgliedstaaten zu koordinieren. Sie erklärt die Ziele der EBS und stellt die OMK als zentrales Instrument zur Erreichung dieser Ziele vor.
Kapitel 2.1 beleuchtet die verschiedenen Formen des Lernens, die in der Politikwissenschaft relevant sind. Es werden drei Formen des Lernens (einfaches Lernen, komplexes Lernen und reflexives Lernen) vorgestellt und die Bedingungen für einen Lernprozess erläutert.
Kapitel 2.2 setzt sich mit den Bedingungen auseinander, die für einen Lernprozess notwendig sind. Es wird argumentiert, dass eine Veränderung des Informationspools, die durch die EBS und insbesondere durch die OMK geschaffen wird, eine wichtige Voraussetzung für einen Lernprozess darstellt.
Kapitel 3.1 erläutert den Ablauf der Offenen Methode der Koordinierung. Es werden die verschiedenen Phasen des OMK-Prozesses beschrieben, der sich durch einen ständigen Austausch zwischen den Mitgliedstaaten und der Europäischen Kommission auszeichnet.
Kapitel 3.2 befasst sich mit den Instrumenten der OMK, die den Lernprozess fördern sollen. Es werden die Leitlinien und Empfehlungen, die Indikatoren, die nationalen Reformpläne, das Programm zum gegenseitigen Lernen und der gemeinsame Fortschrittsbericht vorgestellt.
Kapitel 4.1 und 4.2 widmen sich dem Policy-Transfer durch Lernen am Beispiel Deutschlands. Es werden die Herausforderungen bei der Erfassung von Lernprozessen im Bereich der nationalen Arbeitsmarktpolitik diskutiert und die Frage gestellt, inwiefern die OMK zu einem Lernprozess in Deutschland beigetragen hat.
Schlüsselwörter
Europäische Beschäftigungsstrategie, Offene Methode der Koordinierung, Policy-Transfer, Lernen, Politikwandel, Beschäftigungspolitik, Arbeitsmarktpolitik, Benchmarking, Indikatoren, nationale Reformpläne, Deutschland
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Offene Methode der Koordinierung (OMK)?
Die OMK ist ein Koordinierungsmechanismus der EU (Soft-Law), der durch Zielformulierung, Berichterstattung und Benchmarking die nationalen Politiken der Mitgliedstaaten ohne bindenden Charakter harmonisieren soll.
Welche Formen des Lernens gibt es in der Politikwissenschaft?
Die Arbeit unterscheidet zwischen einfachem Lernen (Anpassung von Mitteln), komplexem Lernen (Hinterfragen von Zielen) und reflexivem Lernen.
Wie stimuliert die OMK das Lernen zwischen Mitgliedstaaten?
Durch Instrumente wie Benchmarking, Indikatoren, nationale Reformpläne und Programme zum gegenseitigen Lernen wird ein Forum für den Austausch von Best-Practice-Beispielen geschaffen.
Kann die OMK tatsächlich Politikwandel in Deutschland bewirken?
Die Arbeit untersucht dies kritisch am Beispiel der deutschen Arbeitsmarktpolitik. Ein Problem ist die Kausalität: Oft ist schwer nachzuweisen, ob Reformen durch EU-Lernen oder nationale Eigeninteressen ausgelöst wurden.
Warum wird die OMK als „dritter Weg“ des Regierens bezeichnet?
Weil sie zwischen einer harten europäischen Harmonisierung (Verordnungen) und vollständiger nationaler Selbstständigkeit liegt und auf kognitives „Framing“ statt auf Sanktionen setzt.
- Quote paper
- Maximilian Eibel (Author), 2011, Politikwandel durch Lernen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/160190