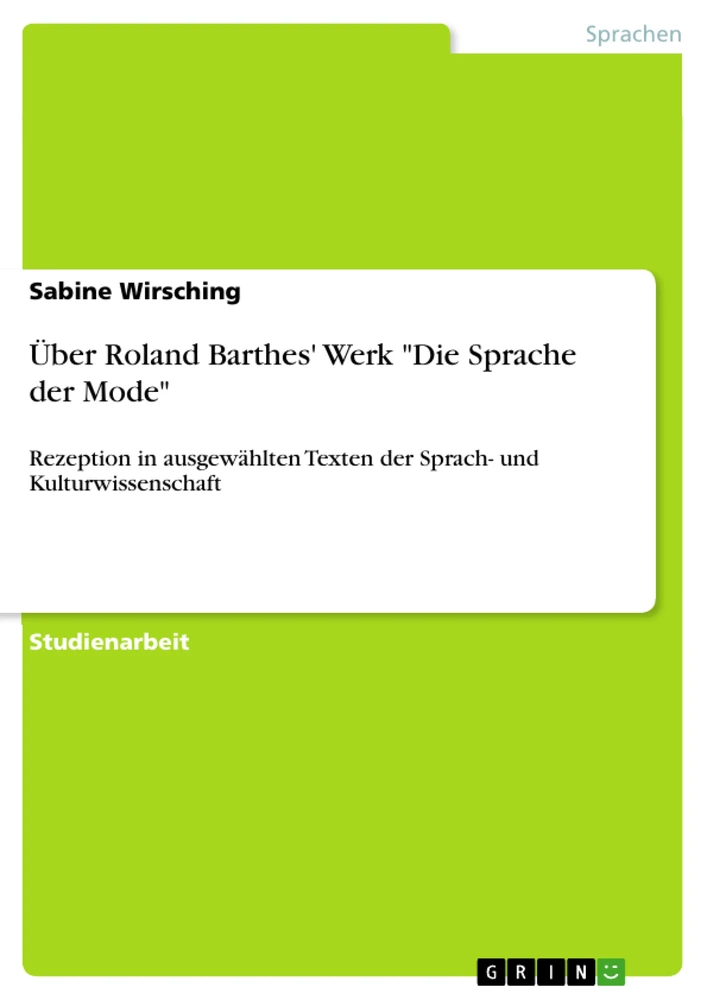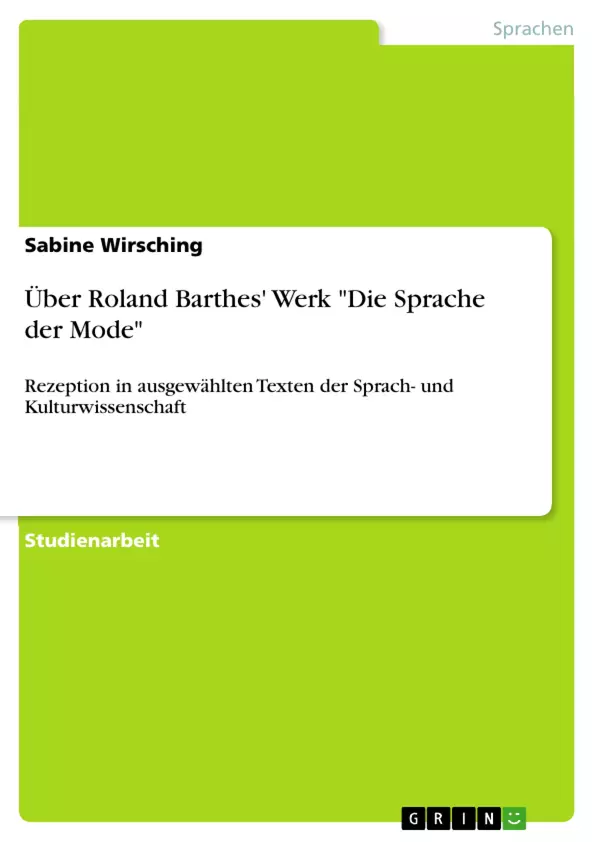Der 1915 geborene und 1980 verstorbene Franzose Roland Barthes gilt als einer der Mitbegründer der Semiologie, also der Wissenschaft, die in Saussure’scher Tradition den Zeichenbegriff im Rahmen eines sozialen Lebens u.a. mit sprachwissenschaftlichen Mitteln untersucht (cf. Bußmann 2002: 595). Barthes widmet sich in der von mir behandelten Arbeit „Die Sprache der Mode“ (Originaltitel: „Système de la Mode“) dem sprachlichen System der Modekommentare in Zeitschriften.
Die Arbeit an „Die Sprache der Mode“ wird 1957 von Roland Barthes begonnen und 1963 abgeschlossen. 1967 wird das Werk erstmals veröffentlicht. In seinem Text schildert Barthes erstmalig für sein Gesamtwerk vollständig ein gesellschaftliches Teilsystem (cf. Röttger-Denker 1989: 24). Seine Analyse von Metasprache am Beispiel der Modekommentare entsteht dabei durch eine Beschreibung der Konnotationssprache und der sich aus dieser Kombination ergebenden, sich aufeinander beziehenden Ebenen.
Seine Analyse der Modesprache ist dabei einzigartig in ihrer Ausführlichkeit – und dies nicht nur in Barthes’ Gesamtwerk. Zudem bedeutet „Die Sprache der Mode“ einen Wendepunkt für Barthes’ Theorien. Nach der abgeschlossenen Analyse steht für Barthes die Erkenntnis fest, dass die Saussure’sche Meinung von der in der Semiologie enthaltenen Linguistik eigentlich umgedreht gehöre (cf. Eco 2002:17 sowie Röttger-Denker 1989: 26), da alle Zeichen sprachlich verfasst seien. Durch diese Erkenntnis verliert die Semiologie ihren Reiz für Barthes und er kehrt mit seinen neuen Einsichten zurück zu den alten Forschungsgegenständen Sprache, Literatur und Kunst. Allerdings wendet er die gewonnenen Gedanken – in der für ihn typischen, kreativen Weise – weiterhin zur Interpretation an (cf. Röttger-Denker 1989: 26).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zu „Die Sprache der Mode“
- Gegenstand der Analyse: Die geschriebene Sprache der Mode
- Untersuchungsmethode in „Die Sprache der Mode“
- Grundlagen zum Verständnis bei Barthes
- Übersetzungsmechanismen zwischen den Codes der Struktur
- Aufteilung der Aussagen in A- und B-Komplex
- Signifikate und Signifikanten
- Aufbau des pseudorealen Mischcodes
- Der vestimentäre Code
- Struktur des Signifikanten - Die Matrix
- Inventar der Arten und Gattungen
- Inventar der Varianten
- Syntagmatischer und systematischer Zwang
- Syntagmatische Leistung
- Struktur des Signifikats
- Struktur des Zeichens
- Struktur des Signifikanten - Die Matrix
- Das rhetorische System
- Die Ökonomie des Systems
- Rezeption des Werkes „Die Sprache der Mode“
- Die Rezeption in sprachwissenschaftlichen Texten
- Umberto Eco: „Einführung in die Semitiotik“
- Gabriella Schubert: „Kopfbedeckungen im Donau-Balkan-Raum“
- Susan B. Kaiser und Angela Flury: „Frauen in Rosa“
- Patrizia Calefato: „Kleidung als Jargon“
- Die Rezeption in kulturwissenschaftlichen Texten
- Gabriele Mentges: „Für eine Kulturanthropologie des Textilen“
- Karin Mann: „Stark und soft“
- Karen Heinze: „Geschmack, Mode und Weiblichkeit“
- Kritik an Barthes' „Die Sprache der Mode“
- Die Rezeption in sprachwissenschaftlichen Texten
- Schlussbemerkung
- Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit Roland Barthes' Werk „Die Sprache der Mode“ und seiner Rezeption in Texten der Sprach- und Kulturwissenschaft. Ziel ist es, Barthes' Analyse der Modekommentare in Zeitschriften zu beleuchten, die Methode zu erläutern und die Relevanz des Werkes für die Semiotik aufzuzeigen.
- Die geschriebene Sprache der Mode als Gegenstand der Analyse
- Die strukturale Reinheit der Modekommentare im Vergleich zur realen Kleidung
- Die Übersetzungsmechanismen zwischen den Codes der Struktur (technologische, ikonische, verbale Form)
- Die Aufteilung der Aussagen in A- und B-Komplex: „Kleidung und Welt“ vs. „Kleidung und Mode“
- Die Rezeption von Barthes' Werk in der Sprach- und Kulturwissenschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt Roland Barthes als Mitbegründer der Semiologie vor und gibt einen Überblick über „Die Sprache der Mode“, die Entstehung des Werkes und die Relevanz von Barthes' Theorien für die Semiotik. Die Hausarbeit soll Barthes' Analyse und deren Rezeption untersuchen.
Zu „Die Sprache der Mode“
In diesem Abschnitt werden die Analysemethode von Barthes erläutert, die geschriebene Sprache der Mode als Untersuchungsgegenstand beschrieben und die Grundlagen des Werkes aus Barthes' semiotischer Perspektive vorgestellt. Darunter fallen die Übersetzungsmechanismen zwischen den Codes der Struktur, die Aufteilung der Aussagen in A- und B-Komplex, sowie die semiotische Analyse des vestimentären Codes.
Rezeption des Werkes „Die Sprache der Mode“
Dieser Abschnitt beleuchtet die Rezeption von Barthes' Werk in Texten der Sprach- und Kulturwissenschaft. Es werden verschiedene Autoren und ihre Interpretationen von Barthes' „Die Sprache der Mode“ vorgestellt, die sowohl in sprachwissenschaftlichen als auch in kulturwissenschaftlichen Texten zu finden sind.
Schlussbemerkung
Dieser Abschnitt fasst die Ergebnisse der Hausarbeit zusammen und bietet eine Schlussfolgerung über die Relevanz von Barthes' „Die Sprache der Mode“ für die Sprach- und Kulturwissenschaft.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe des Werkes sind: Semiotik, Zeichen, Sprache, Mode, Modekommentare, vestimentärer Code, strukturalistische Analyse, Rezeption, Sprachwissenschaft, Kulturwissenschaft.
- Quote paper
- Sabine Wirsching (Author), 2008, Über Roland Barthes' Werk "Die Sprache der Mode", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/160325