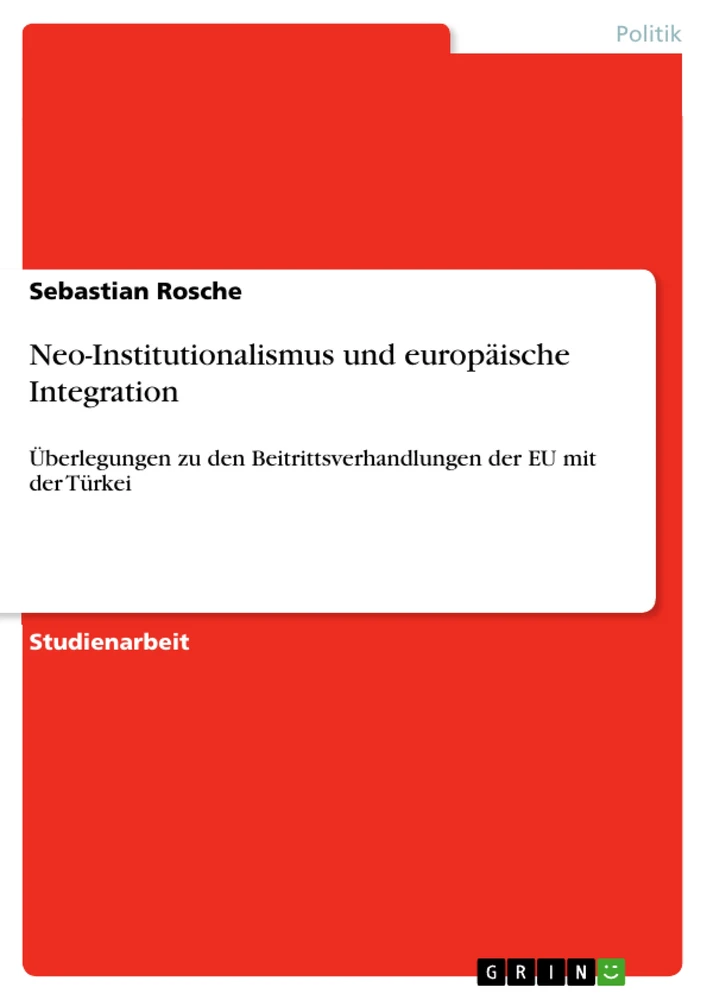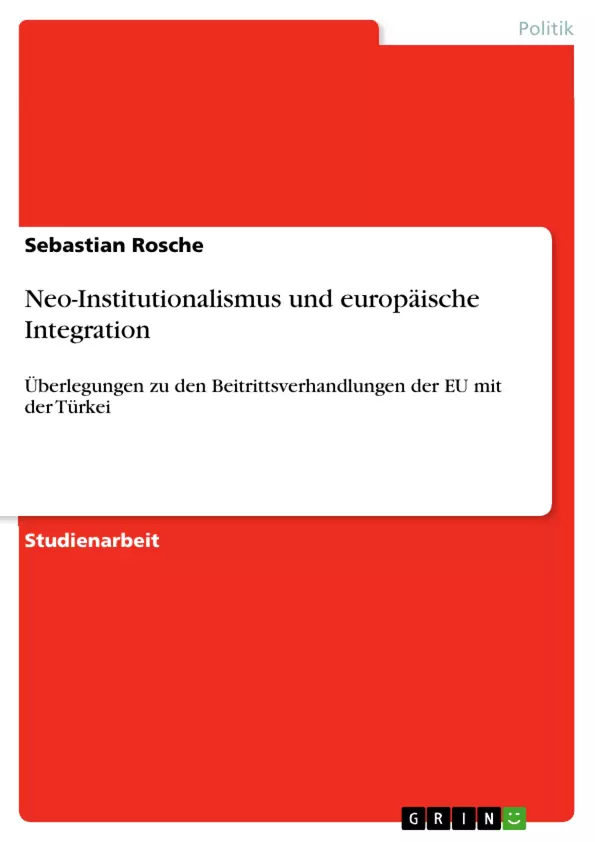Die Arbeit untersucht, welchen Beitrag die theoretischen Ansätze innerhalb des "new institutionalism" zur Erklärung des Erweiterungsprozesses im Verlauf der europäischen Integration leisten können. Im Mittelpunkt steht die von Paul Pierson auf der Grundlage des "historical institutionalism" angefertigte Analyse der europäischen Integration stehen. Pierson formuliert seine Untersuchung in Opposition zu den Annahmen des liberalen Intergouvernementalismus von Andrew Moravcsik. Gleichzeitig setzt sich Pierson jedoch auch mit den Überlegungen des Neo-Funktionalismus auseinander. Beide klassischen Integrationstheorien werden vorgestellt. In einem zweiten Schritt werden dann drei Denkschulen des "new institutionalism" charakterisiert: "rational choice institutionalism", "sociological institutionalism" und "historical institutionalism". Darauf aufbauend werden die Überlegungen der dargestellten Integrationstheorien zu einer Analyse der Beitrittsverhandlungen der EU mit der Türkei herangezogen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Neo-Funktionalismus und Intergouvernementalismus
- III. New Institutionalism
- Rational Choice Institutionalism (RCI)
- Sociological Institutionalism (SI)
- Historical Institutionalism (HI)
- Eine Bewertung der Vor- und Nachteile der Theorie des Historical Institutionalism
- IV. Die Beitrittsverhandlungen der EU mit der Türkei
- V. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Beitrag der Theorien des new institutionalism zur Erklärung des Erweiterungsprozesses der europäischen Integration. Dabei steht die Analyse von Paul Pierson im Mittelpunkt, der sich auf den historical institutionalism (HI) stützt. Die Arbeit setzt sich mit den Annahmen des liberalen Intergouvernementalismus (LI) von Andrew Moravcsik auseinander und betrachtet ebenfalls den Neo-Funktionalismus (NF).
- Die Rolle des historical institutionalism (HI) in der europäischen Integration
- Vergleich der theoretischen Ansätze des new institutionalism mit den klassischen Theorien des Neo-Funktionalismus (NF) und des liberalen Intergouvernementalismus (LI)
- Analyse der Beitrittsverhandlungen der EU mit der Türkei im Kontext der verschiedenen Integrationstheorien
- Bewertung der Stärken und Schwächen der verschiedenen theoretischen Ansätze
- Die Bedeutung von institutionellen Rahmenbedingungen und historischen Entwicklungen für den Integrationsprozess
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext des Beitrittsprozesses der Türkei zur EU dar und beschreibt die Bedeutung der theoretischen Ansätze zur Erklärung dieses Prozesses. Kapitel II beleuchtet die klassischen Integrationstheorien des Neo-Funktionalismus (NF) und des Intergouvernementalismus (LI) und deren jeweiligen Stärken und Schwächen. Kapitel III präsentiert die verschiedenen Denkschulen des new institutionalism, insbesondere den rational choice institutionalism (RCI), den sociological institutionalism (SI) und den historical institutionalism (HI). Es wird zudem eine Bewertung der Vor- und Nachteile der HI-Theorie vorgenommen. Kapitel IV zeigt, wie die verschiedenen Integrationstheorien zur Analyse der Beitrittsverhandlungen der EU mit der Türkei angewendet werden können.
Schlüsselwörter
Europäische Integration, Neo-Funktionalismus, Intergouvernementalismus, New Institutionalism, Rational Choice Institutionalism, Sociological Institutionalism, Historical Institutionalism, Beitrittsverhandlungen, Türkei, EU
Häufig gestellte Fragen
Was ist "New Institutionalism" in der Politikwissenschaft?
Es ist ein theoretischer Rahmen, der untersucht, wie Institutionen (Regeln, Normen, Strukturen) das politische Handeln und die gesellschaftliche Entwicklung beeinflussen.
Wie erklärt der "Historical Institutionalism" die europäische Integration?
Dieser Ansatz (nach Paul Pierson) betont, dass frühere Entscheidungen Pfadabhängigkeiten schaffen, die den zukünftigen Spielraum politischer Akteure einschränken.
Was ist der Unterschied zwischen Rational Choice und Sociological Institutionalism?
Rational Choice fokussiert auf nutzenmaximierende Akteure innerhalb von Regeln; Sociological Institutionalism betont die Bedeutung von kulturellen Normen und Identitäten.
Wie werden die Beitrittsverhandlungen der Türkei zur EU analysiert?
Die Arbeit nutzt die verschiedenen Schulen des New Institutionalism, um die Dynamik und die Hindernisse im Erweiterungsprozess der EU gegenüber der Türkei zu erklären.
Was kritisiert Pierson am liberalen Intergouvernementalismus?
Pierson argumentiert, dass Nationalstaaten oft die Kontrolle über Integrationsprozesse verlieren, die sie selbst in Gang gesetzt haben (unbeabsichtigte Folgen).
- Quote paper
- Sebastian Rosche (Author), 2004, Neo-Institutionalismus und europäische Integration , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/160527