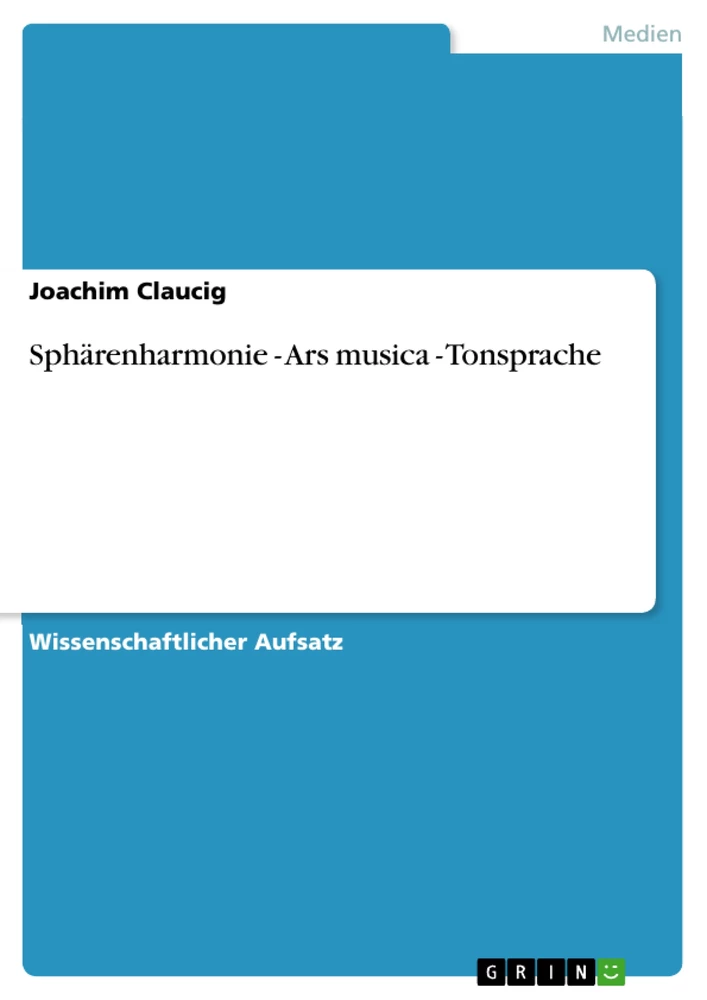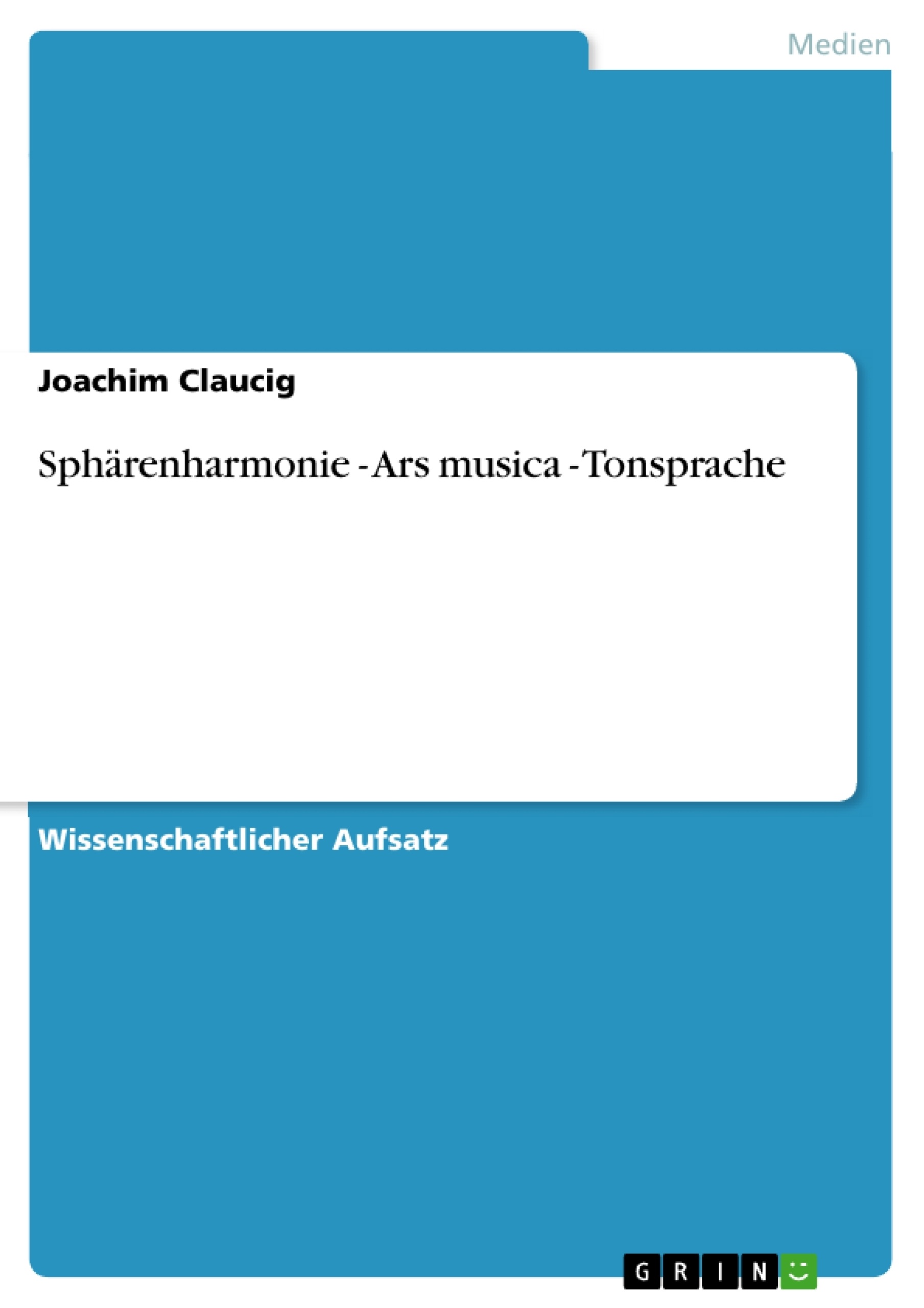Diese Zusammenstellung streift in relativ kleinen, jedoch vielschichtig miteinander verknüpften Einheiten folgende Themengebiete unter zum Teil sehr philosophischen Aspekten - angelehnt unter anderem an die philosophischen Gedanken von Ernst Bloch:
- Sphärenharmonie und Schöne Künste - Musik und Schöpfung
- Antike Musikauffassungen - Was ist Musik - wozu ist sie gut?
- Musik als Abbild der Wirklichkeit und der Gesellschaft
- Tonsprache - Klangspannung - Persönlichkeitsspannung
- Emotion und Kanon/Gesetzeswelt - Widerspruch oder Einheit?
- Mathematik und Musik in der Antike
- Moralität und Menschlichkeit bzw. Mitmenschlichkeit
- Aufgabe und Wert der Musikalischen Erziehung
Inhaltsverzeichnis
- Sphärenharmonie und Schöne Künste – Musik und Schöpfung
- Antike Musikauffassungen – Was ist Musik – wozu ist sie gut?
- Musik als Abbild der Wirklichkeit und der Gesellschaft
- Tonsprache - Klangspannung - Persönlichkeitsspannung
- Emotion und Kanon/Gesetzeswelt - Widerspruch oder Einheit?
- Mathematik und Musik in der Antike
- Moralität und Menschlichkeit bzw. Mitmenschlichkeit
- Aufgabe und Wert der Musikalischen Erziehung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Aufsatz untersucht die Spannung und Einheit zwischen Rationalität und Emotionalität in der Musik, ausgehend vom antiken Konzept der Sphärenharmonie. Er beleuchtet die Entwicklung musikalischer Vorstellungen von der Antike bis zum Barock und analysiert die Rolle von Mathematik und Affektenlehre in der Musikgeschichte.
- Die Sphärenharmonie als philosophisches Konzept und ihre Ausprägung in der Musikgeschichte.
- Die Wechselwirkung von Rationalität (Mathematik, Struktur) und Emotionalität (Affektenlehre, Ausdruck) in der Musik.
- Die Musik als Abbild der Wirklichkeit und der Gesellschaft in verschiedenen Epochen.
- Die Entwicklung von Symbolsprachen in der Musik (Tonsymbolik, Zahlensymbolik).
- Die Bedeutung der musikalischen Erziehung.
Zusammenfassung der Kapitel
Sphärenharmonie und Schöne Künste – Musik und Schöpfung: Dieser Abschnitt erörtert die antike Vorstellung der Sphärenharmonie, die die Bewegung der Himmelskörper mit musikalischen Tönen verbindet. Pythagoras' Theorie wird vorgestellt, ebenso wie die Weiterentwicklung dieses Gedankens im christlichen Mittelalter in Form von Engelschören. Der Aufsatz vergleicht die Ansichten von Aristoteles und Kepler, wobei Keplers mathematische Abstraktion der Musik nicht als Widerspruch zu Pythagoras gesehen wird, sondern als Ausdruck der Harmonie der Schöpfung, die sich in der Musik manifestiert und sie zu einer "schönen" Kunst macht.
Antike Musikauffassungen – Was ist Musik – wozu ist sie gut?: Dieser Teil beschreibt Boethius' Dreiteilung der Musik in musica mundana (Harmonie des Makrokosmos), musica humana (Harmonie des Mikrokosmos) und musica instrumentalis (hörbare Musik). Die ersten beiden werden unter musica theoretica zusammengefasst und an den antiken Universitäten gelehrt. Der Aufsatz betont die Sonderstellung der Musik innerhalb der sieben liberalen Künste und erklärt die Unterscheidung zwischen musica practica (musica plana und musica mensurabilis).
Symbolsprachen: Dieser Abschnitt behandelt das Spannungsfeld zwischen Affektenlehre und Mathematik in der Musikgeschichte, insbesondere im Barock. Es werden verschiedene Symbolsprachen erläutert, darunter Tonsymbolik (Tonbuchstaben für Namen, Zahlensymbolik), die Musica poetica (Verbindung von Musik und Textinhalt), und die Affektenlehre, die die Darstellung von Emotionen durch musikalische Mittel beschreibt.
Musik und Wirklichkeit: Dieser Abschnitt untersucht den Zusammenhang zwischen Musik und gesellschaftlichen Strukturen. Die europäische Musik wird als traditionell gebunden an bestimmte Personen und Gruppen dargestellt. Der Begriff der musicae technae aus der griechischen Antike, der die Einheit von Tanz, Kult, Wort und Musik beschreibt, wird eingeführt. Die Mimesis als Nachahmung des Seins wird erläutert, und der Aufsatz zeigt, wie diese antiken Gedanken in späteren Epochen aufgegriffen und uminterpretiert wurden (z.B. Mahler). Die Musik wird als Spiegel der Gesellschaft betrachtet, der das Verhältnis zwischen Mensch und Wirklichkeit widerspiegelt.
Schlüsselwörter
Sphärenharmonie, Rationalität, Emotionalität, Musikgeschichte, Antike, Barock, Affektenlehre, Mathematik, Symbolsprache, Tonsymbolik, Musica poetica, Musik und Gesellschaft, Mimesis.
Häufig gestellte Fragen zum Aufsatz: Sphärenharmonie und Schöne Künste – Musik und Schöpfung
Was ist der Gegenstand des Aufsatzes?
Der Aufsatz untersucht die Spannung und Einheit zwischen Rationalität und Emotionalität in der Musik, ausgehend vom antiken Konzept der Sphärenharmonie. Er beleuchtet die Entwicklung musikalischer Vorstellungen von der Antike bis zum Barock und analysiert die Rolle von Mathematik und Affektenlehre in der Musikgeschichte.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die zentralen Themen sind die Sphärenharmonie als philosophisches Konzept und ihre Ausprägung in der Musikgeschichte; die Wechselwirkung von Rationalität (Mathematik, Struktur) und Emotionalität (Affektenlehre, Ausdruck) in der Musik; die Musik als Abbild der Wirklichkeit und der Gesellschaft in verschiedenen Epochen; die Entwicklung von Symbolsprachen in der Musik (Tonsymbolik, Zahlensymbolik); und die Bedeutung der musikalischen Erziehung.
Welche Kapitel gibt es und worum geht es in ihnen?
Der Aufsatz gliedert sich in mehrere Kapitel: "Sphärenharmonie und Schöne Künste – Musik und Schöpfung" (antike Vorstellung der Sphärenharmonie, Pythagoras, Aristoteles, Kepler); "Antike Musikauffassungen – Was ist Musik – wozu ist sie gut?" (Boethius' Dreiteilung der Musik, musica mundana, humana, instrumentalis); ein Kapitel über Symbolsprachen (Affektenlehre, Tonsymbolik, Zahlensymbolik, Musica poetica); "Musik und Wirklichkeit" (Zusammenhang zwischen Musik und Gesellschaft, Mimesis, "musicae technae"); und weitere Kapitel zu den im Inhaltsverzeichnis aufgeführten Punkten.
Wie wird die Sphärenharmonie behandelt?
Die Sphärenharmonie wird als Ausgangspunkt des Aufsatzes betrachtet. Es wird die antike Vorstellung der Verbindung zwischen den Bewegungen der Himmelskörper und musikalischen Tönen erörtert, sowie die Weiterentwicklung dieses Gedankens im christlichen Mittelalter und die Ansichten von Pythagoras, Aristoteles und Kepler.
Welche Rolle spielen Rationalität und Emotionalität?
Der Aufsatz untersucht die Wechselwirkung zwischen Rationalität (Mathematik, Struktur der Musik) und Emotionalität (Affektenlehre, Ausdruck von Emotionen durch Musik). Es wird analysiert, wie diese beiden Aspekte in der Musikgeschichte zusammenwirken und sich gegenseitig beeinflussen.
Welche Bedeutung hat die Musik als Abbild der Wirklichkeit?
Der Aufsatz betrachtet die Musik als Spiegel der Gesellschaft und des Verhältnisses zwischen Mensch und Wirklichkeit. Er beleuchtet, wie gesellschaftliche Strukturen und Entwicklungen in der Musik reflektiert werden und wie die Musik ihrerseits die Gesellschaft beeinflusst.
Welche Symbolsprachen werden analysiert?
Der Aufsatz analysiert verschiedene Symbolsprachen in der Musik, darunter Tonsymbolik (Tonbuchstaben für Namen), Zahlensymbolik, die Musica poetica (Verbindung von Musik und Textinhalt) und die Affektenlehre.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Sphärenharmonie, Rationalität, Emotionalität, Musikgeschichte, Antike, Barock, Affektenlehre, Mathematik, Symbolsprache, Tonsymbolik, Musica poetica, Musik und Gesellschaft, Mimesis.
Für wen ist dieser Aufsatz gedacht?
Der Aufsatz ist für ein akademisches Publikum gedacht, das sich mit der Musikgeschichte, Musiktheorie und der philosophischen Betrachtung von Musik auseinandersetzt.
- Quote paper
- Mag. art. Joachim Claucig (Author), 1999, Sphärenharmonie - Ars musica - Tonsprache, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1606