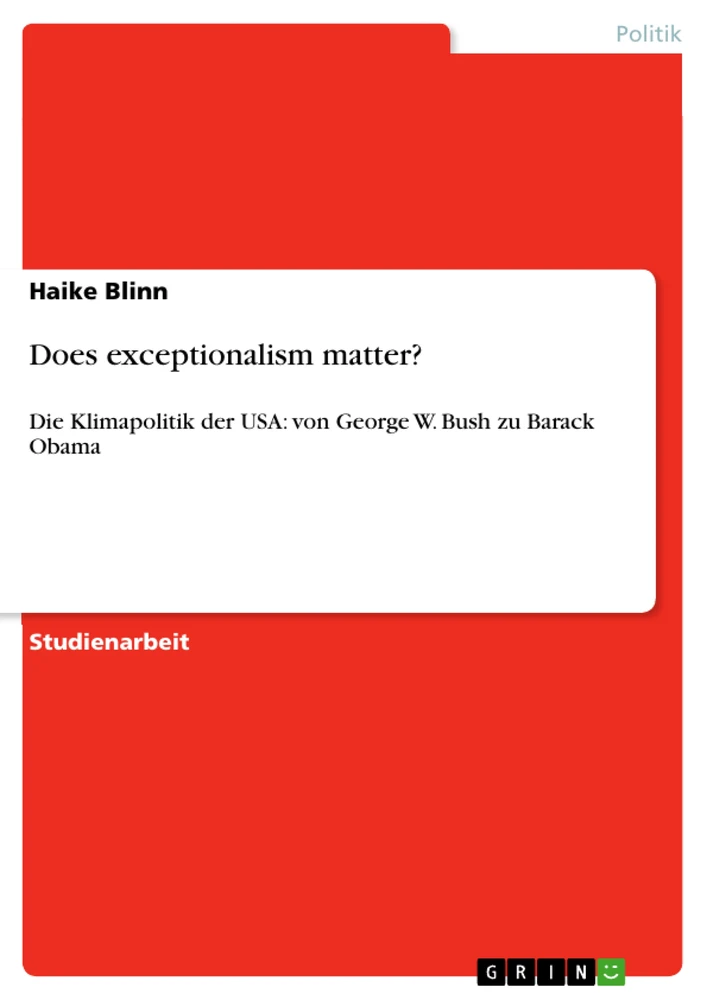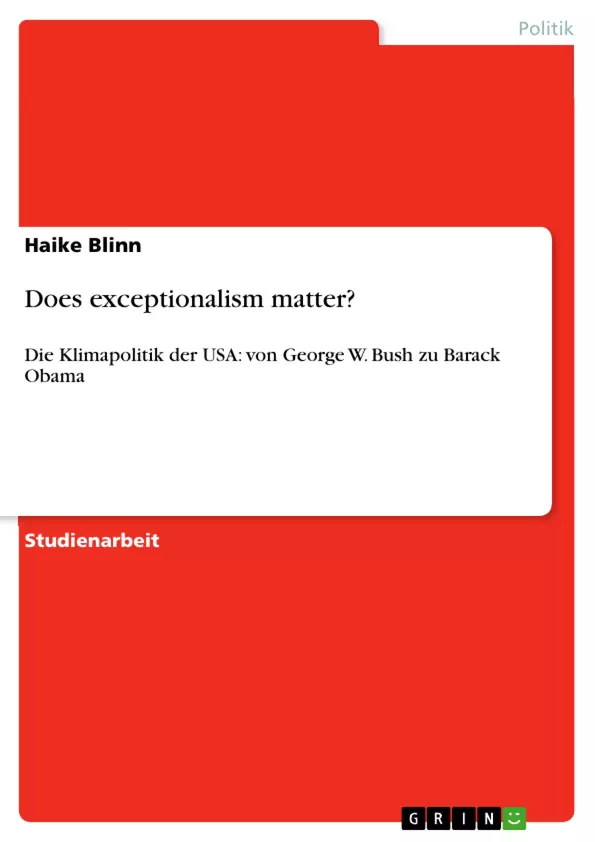1. Yes, We can? Die Bemühungen Barack Obamas um einen neuen klimapolitischen Kurs der USA
Große Erwartungen wurden in Barack Obama gesetzt, als am 18.12.2009 in Kopenhagen über ein neues weltklimapolitisches Bündnis gesprochen werden sollte. Umso größer war die Ent-täuschung darüber, dass das als „global player“ geltende Amerika, das einen hohen Ressour-cenverbrauch und eine hohe Umweltverschmutzung für sich beansprucht , sich jedoch nicht vertraglich festlegen wollte. Zwar hat Barack Obama sich dafür ausgesprochen, dass die USA ein Partner im Kampf gegen den „climate change“ darstellen wird, aber verbindlich wollte Obama sich nicht festlegen. Diese Handlung ist aber nur zu verständlich, da es in den USA noch Unstimmigkeiten im Kongress gibt, dessen Meinung in einem System der „checks and balances“ wichtig ist. Seit Juni 2009 wird über den Entwurf des „Clean Energy and Security Act“ im Senat debattiert, obwohl dieser schon lange im Repräsentantenhaus verabschiedet wurde . Es scheint, dass der mächtigste Mann der Welt Probleme hat, sich in Sachen Klima-politik innenpolitisch durchzusetzen. Welche Faktoren den Machteinfluss des Präsidenten in dieser Hinsicht mitbestimmen, soll die folgende Untersuchung zeigen. Dabei wird auf die Theorie des American Exceptionalism zurückgegriffen, dessen Grundlage der Konstruktivis-mus darstellt. Konstruktivismus deshalb, weil Kommunalität und Spezifizität eine Rolle spie-len. Die Kyotovertragsstaaten erwarteten von Obamas Vorgänger, George W. Bush, die lang erhoffte Ratifizierung des Kyoto-Protokolls der USA und dachten, dass die USA sich führend im Kampf gegen den Klimawandel hervortun würden. Da dies aber nicht geschah, waren die Hoffnungen gegenüber der neuen Regierung Barack Obamas in dieser Hinsicht verhalten. Erleichterung unter den Staaten breitete sich aus, als Obama in seiner ersten Rede am 18.11.2008 alle Staaten aufrief, sich den USA im Kampf gegen den Klimawandel anzuschließen . Er befürchtet nicht wie Bush eine Schädigung der US-Wirtschaft durch einen neuen klimapolitischen Kurs, sondern erkennt es als Chance, Millionen neue, gut bezahlte Arbeitsplätze zu schaffen .
Obama will für die USA „a new chapter in American leadership on climate change" und da-mit den Kurs vorgeben, wie ein eventuell weltpolitisches Klimabündnis aussehen könnte. Dieses Streben nach einer Führungsrolle entspricht ganz dem American Exceptionalism, der in dieser Untersuchung den Konstruktivismus erweitern wird.
...
Inhaltsverzeichnis
- Yes, We can? Die Bemühungen Barack Obamas um einen neuen klimapolitischen Kurs der USA
- Between Leadership and Refusal: Die Umwelt- und Klimapolitik der USA bis in die 1990er Jahre
- Norms and Identities Matter: Der Konstruktivismus und die außenpolitische Sonderstellung der USA
- Institutions Matter: Der Kongress und die Klimapolitik
- Public Opinion Matters – Die öffentliche Meinung im Hinblick auf die US- Klimapolitik
- Back to Unilateralism: Die Präsidentschaft George W. Bushs und die Ablehnung des Kyoto-Protokolls
- Back to Multilateralism: Die Präsidentschaft Barack Obamas und der angestrebte Paradigmenwechsel in der Klimapolitik
- Ready for change - Die Nachfolgeregelung des Kyoto-Protokolls in Mexiko City
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Klimapolitik der Vereinigten Staaten unter den Präsidenten George W. Bush und Barack Obama. Ziel ist es, die Ursachen für die unterschiedlichen politischen Strategien der beiden Präsidenten zu analysieren und die Rolle des American Exceptionalism in diesem Kontext zu beleuchten. Dabei wird die Bedeutung des Konstruktivismus, des Einflusses des Kongresses und der öffentlichen Meinung auf die US-Klimapolitik beleuchtet.
- Der American Exceptionalism und sein Einfluss auf die US-Klimapolitik
- Die Rolle des Konstruktivismus bei der Gestaltung der internationalen Klimapolitik
- Die innenpolitischen Herausforderungen für die US-Klimapolitik
- Der Einfluss des Kongresses und der öffentlichen Meinung auf die US-Klimapolitik
- Die Bedeutung des Kyoto-Protokolls für die internationale Klimapolitik
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel analysiert die Bemühungen Barack Obamas um einen neuen klimapolitischen Kurs für die USA. Es beleuchtet die Herausforderungen, denen sich Obama in diesem Bereich gegenübersieht, insbesondere die Unstimmigkeiten im Kongress. Das zweite Kapitel bietet einen historischen Überblick über die Umwelt- und Klimapolitik der USA bis in die 1990er Jahre. Es beleuchtet die Entwicklung des Umweltschutzes in den USA und die Bedeutung von Schlüsselereignissen wie der Ölkrise und der Verabschiedung des Montrealer Protokolls. Die Kapitel drei und vier analysieren den Konstruktivismus und die institutionellen Strukturen der USA, die einen Einfluss auf die US-Klimapolitik haben. Kapitel fünf behandelt die öffentliche Meinung im Hinblick auf die US-Klimapolitik.
Schlüsselwörter
American Exceptionalism, Konstruktivismus, Klimapolitik, Umweltpolitik, USA, Kyoto-Protokoll, Kongress, öffentliche Meinung, internationale Zusammenarbeit, George W. Bush, Barack Obama.
Was bedeutet „American Exceptionalism“ in der Klimapolitik?
Es bezeichnet die Vorstellung der USA als eine Nation mit einer Sonderrolle, die sich oft internationalen Verpflichtungen entzieht, aber gleichzeitig eine globale Führungsrolle beansprucht.
Wie unterschied sich Obamas Klimapolitik von der seines Vorgängers Bush?
Während George W. Bush das Kyoto-Protokoll ablehnte, strebte Barack Obama einen Paradigmenwechsel hin zu Multilateralismus und Investitionen in grüne Energien an.
Welche Rolle spielt der Kongress bei US-Klimaentscheidungen?
Aufgrund des Systems der „Checks and Balances“ kann der US-Präsident internationale Verträge oft nicht ohne Zustimmung des Kongresses (insbesondere des Senats) ratifizieren, was zu innenpolitischen Blockaden führen kann.
Was ist der „Clean Energy and Security Act“?
Ein Gesetzentwurf unter Obama, der darauf abzielte, die CO2-Emissionen zu senken und die Sicherheit durch saubere Energie zu fördern, jedoch im Senat auf starken Widerstand stieß.
Wie beeinflusst die öffentliche Meinung die US-Umweltpolitik?
Die öffentliche Meinung ist gespalten und stark von wirtschaftlichen Sorgen sowie ideologischen Überzeugungen geprägt, was den politischen Spielraum für verbindliche Klimaziele einschränkt.