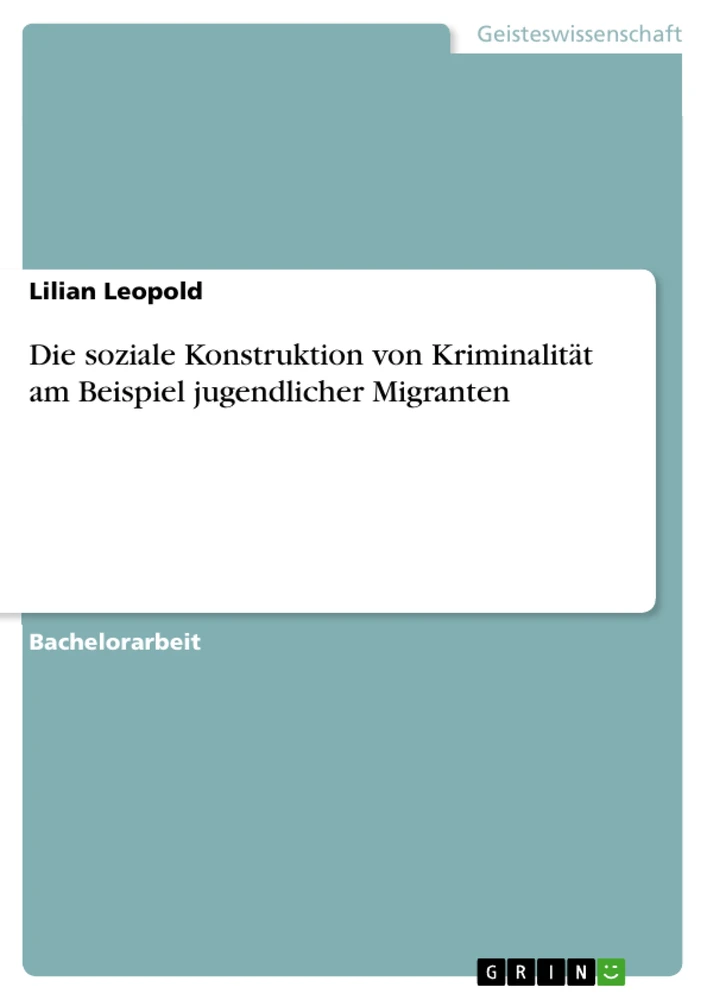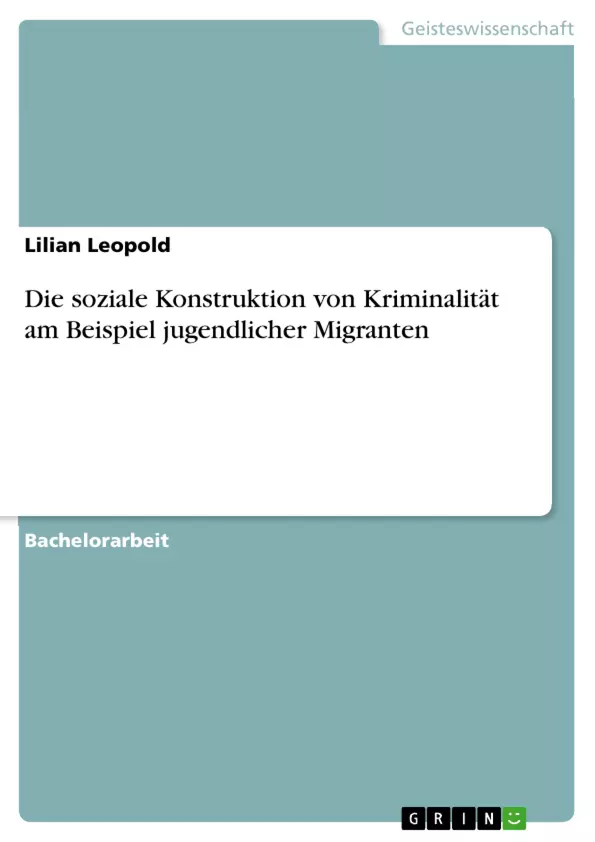Der Theorieansatz des Labeling Approach vertritt eine Sichtweise, die unter anderem von Berger und Luckmanns Beschreibungen der gesellschaftlichen Konstruktion der Wirklichkeit beeinflusst wurde.
(..) Es stellt sich die Frage, ob der frühe Ansatz des Labeling Approach ein Phänomen erklären kann, das sich hartnäckig in den Köpfen der Menschen hält und sich schon seit längerer Zeit auffallend häufig in der öffentlichen Diskussion wiederfindet: das „Problem“ der Kriminalität jugendlicher (männlicher) Migranten.
(..)Kriminalität wird heute als soziales Problem behandelt, das von der Bevölkerung hauptsächlich durch die Medien erfahren wird. Vermischt mit dem Diskurs um die allgemeine Jugendkriminalität wird die Thematik seit den 1980er Jahren regelmäßig über die Politik und die Medien in den gesellschaftlichen Diskurs transportiert. Hierbei ist scheinbar weniger von Belang, dass wissenschaftliche Studien schon seit vielen Jahren eine Höherbelastung der Kriminalität jugendlicher Migranten empirisch widerlegen. Auch wenn es auf den ersten Blick so erscheint, als würden allein die Massenmedien ein Bild aufrechterhalten und reproduzieren, das (migrantische) Jugendliche als Bedrohung zeigt, scheinen sich dahinter komplexere Zusammenhänge zu verbergen, die das Bild des kriminellen jugendlichen Migranten konstruieren und reproduzieren. Interessant erscheint die Frage, ob es weitere Institutionen gibt, die an einer Etikettierung beziehungsweise Stigmatisierung teilhaben. Zur Klärung dieser Frage sollen einzelne, ausgewählte Institutionen, denen eine Beeinflussung und Konstitution der gesellschaftlichen Wirklichkeit unterstellt werden kann, beleuchtet werden. Kann die Erklärung des sozialen Problems „Kriminalität jugendlicher Migranten“ durch die Überprüfung machtpolitischer Institutionen dem Labeling Approach helfen, deren Funktionen und Interessen offenzulegen und das Phänomen als soziale Konstruktion zu „entlarven“?
Neben den Kontroll- und Straforganen des Strafrechts sollen hierzu das Zuschreibungsverhalten von Politik, Medien und von der Bevölkerung als gesellschaftliche Institution überprüft werden. Falls die Überlegung einer Selektion beziehungsweise Stigmatisierung zutrifft, muss in einem zweiten Schritt geprüft werden, ob allein diese Erkenntnis ausreicht, um das Phänomen erklären zu können. Schließlich sollen Theorieansätze und Anregungen aufgezeigt werden, die dem Labeling Approach als Ergänzung bei der Erklärung des Phänomens dienen können.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Der Labeling Approach
- II. 1 Ein Gegenentwurf zur traditionellen Kriminologie
- II. 2 Die Hauptaussagen des Labeling Approach
- II. 3 1968 bis heute: Die Entwicklung der Kritischen Kriminologie
- II. 4 Die Prämissen des „,radikalen“ Theorieansatzes
- III. Die Erklärungskraft des Labeling Approach bezüglich des Phänomens „Kriminalität migrantischer Jugendlicher“
- III. 1 Die sozialen Voraussetzungen jugendlicher Migranten
- III. 2 Die strafrechtlichen Instanzen und deren Kontrollorgane
- III. 2.1 Die „symbolischen“ Funktionen des Strafrechts
- III. 2. 2 Die Polizei
- III. 2. 2.1 Die praktische Funktion der Kontrolle und Selektion
- III. 2. 2. 2 Das theoretische Output: Die Polizeiliche Kriminalstatistik
- III. 3. Machtpolitische Institutionen als „Mit-Konstukteure“ sozialer Probleme?
- III. 3. 1 Politische Akteure im Wahlkampf
- III. 3. 2 Die Medienberichterstattung
- III. 3. 3 Der gesellschaftliche Diskurs um Kriminalität
- III. 4 Zwischenfazit
- III. 5 Erklärungsprobleme des Labeling Approach
- III. 6 Ergänzungsvorschläge anderer (ätiologischer) Theorien
- IV. Fazit
- V. Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die soziale Konstruktion von Kriminalität am Beispiel jugendlicher Migranten. Sie analysiert, inwiefern der Labeling Approach das Phänomen der Kriminalität jugendlicher Migranten erklären kann und ob dieser Ansatz dazu beitragen kann, die Funktionen und Interessen der beteiligten Institutionen offenzulegen.
- Der Labeling Approach als Gegenentwurf zur traditionellen Kriminologie.
- Die Rolle staatlicher Kontroll- und Straforgane bei der Konstruktion von Kriminalität.
- Die Bedeutung von Machtpolitischen Institutionen (Politik, Medien, Gesellschaft) bei der Konstruktion des Bildes vom kriminellen jugendlichen Migranten.
- Erklärungsprobleme des Labeling Approach.
- Ergänzungsmöglichkeiten des Labeling Approach durch andere Theorien.
Zusammenfassung der Kapitel
- I. Einleitung: Die Arbeit stellt das Forschungsfeld der sozialen Konstruktion von Kriminalität vor und führt den Leser in die Thematik der Kriminalität jugendlicher Migranten ein. Sie beschreibt die Grundannahmen des Labeling Approach und stellt die Forschungsfragen der Arbeit dar.
- II. Der Labeling Approach: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung des Labeling Approach, seine Kritik an der traditionellen Kriminologie und seine Hauptthesen. Es werden verschiedene Interpretationen des Ansatzes und die Bedeutung der Etikettierung durch staatliche Kontrollorgane erläutert.
- III. Die Erklärungskraft des Labeling Approach bezüglich des Phänomens „Kriminalität migrantischer Jugendlicher“: Dieses Kapitel untersucht die sozialen Voraussetzungen jugendlicher Migranten und die Rolle der strafrechtlichen Instanzen und deren Kontrollorgane bei der Konstruktion des Phänomens. Es werden verschiedene Machtpolitische Institutionen wie die Politik, die Medien und die Gesellschaft analysiert und die Frage nach der konstruktiven Rolle dieser Institutionen bei der Stigmatisierung von jugendlichen Migranten als kriminell gestellt.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Labeling Approach, Kriminalität, jugendliche Migranten, soziale Konstruktion, Machtpolitische Institutionen, Stigmatisierung, Etikettierung, Kontrollorgane, Strafrecht, Politik, Medien, Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt der Labeling Approach in der Kriminologie?
Dieser Ansatz besagt, dass Kriminalität eine soziale Konstruktion ist, die durch die Etikettierung (Labeling) bestimmter Gruppen durch Kontrollinstanzen wie Polizei und Justiz entsteht.
Wie wird Kriminalität bei jugendlichen Migranten konstruiert?
Die Arbeit untersucht, wie Politik, Medien und gesellschaftlicher Diskurs das Bild des „kriminellen Migranten“ erschaffen und reproduzieren, oft unabhängig von realen Kriminalitätsraten.
Welche Rolle spielen die Medien bei der Stigmatisierung?
Medien transportieren und verstärken Stereotype, indem sie Kriminalität oft im Kontext ethnischer Herkunft thematisieren, was zur gesellschaftlichen Ausgrenzung führt.
Was ist die „symbolische Funktion“ des Strafrechts?
Strafrecht dient oft nicht nur der Verbrechensbekämpfung, sondern auch der Bestätigung gesellschaftlicher Normen und der Machtdemonstration gegenüber stigmatisierten Gruppen.
Kann der Labeling Approach das Phänomen allein erklären?
Die Arbeit prüft Erklärungsprobleme des Ansatzes und schlägt Ergänzungen durch ätiologische Theorien vor, um die Ursachen von Delinquenz umfassender zu verstehen.
- Quote paper
- Lilian Leopold (Author), 2010, Die soziale Konstruktion von Kriminalität am Beispiel jugendlicher Migranten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/160687