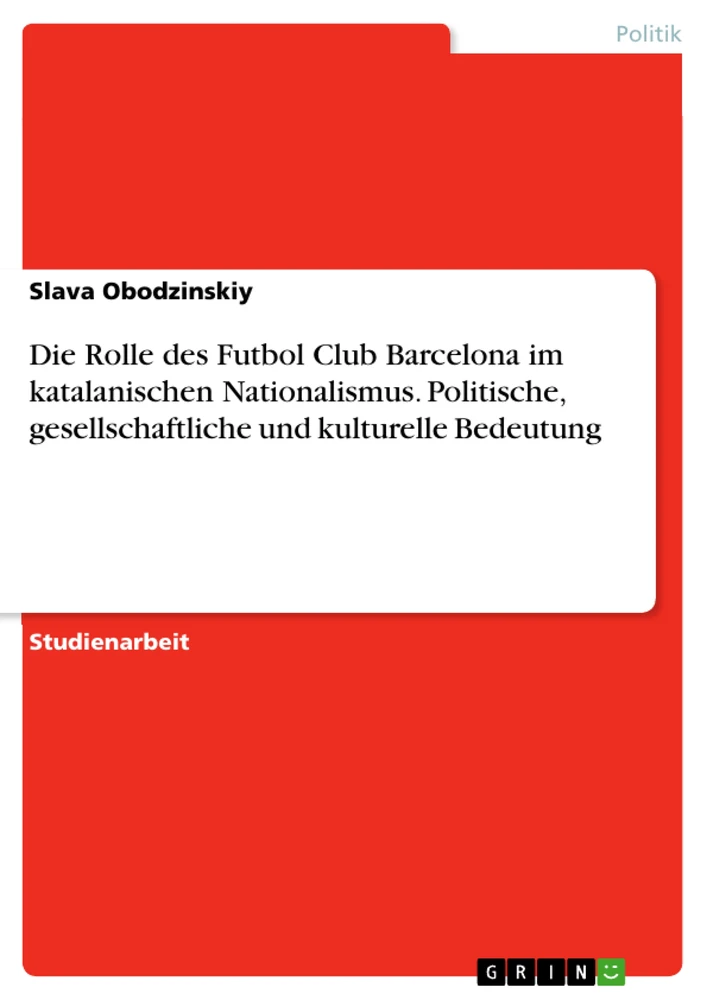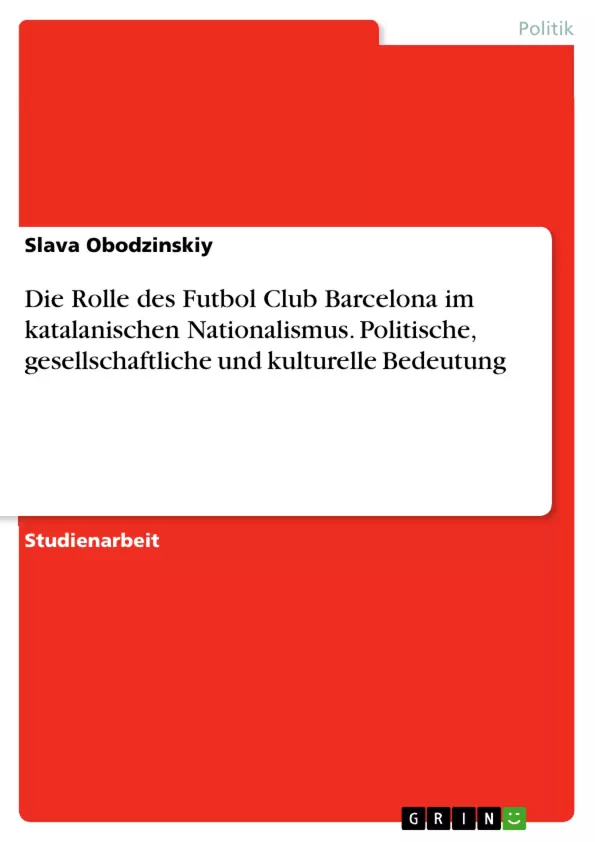Der 1899 gegründete Futbol Club Barcelona ist heute mit über 170000 Mitgliedern nicht nur der größte und erfolgreichste Sportverein Kataloniens, sondern auch eine einflussreiche Organisation, die sich für Katalonien und für die katalanische Nation einsetzt. Da der Verein, wie auch der Katalanismus, zu Beginn des 20. Jahrhunderts einen schnellen Aufschwung erlebte, entwickelte er sich bereits kurz nach seiner Gründung zu einer Institution, die den katalanischen Nationalismus aktiv unterstützte. Zur Zeit der Diktaturen von Primo de Rivera und Franco war der „FC Barcelona“ stets eine Hochburg des Widerstandes in der Region. Der Verein organisierte Demonstrationen, im Stadion wurden damals verbotene katalanische Lieder gesungen sowie katalanische Sprache gesprochen und während der Spiele fanden Protestaktionen gegen die Zentralregierung statt. Seit dem Tod Francos 1975 fördert der Klub verstärkt katalanische Projekte im Bereich Kultur und setzt sich für die Erhaltung der katalanischen Sprache ein. Viele Funktionäre des Vereins sind politisch aktiv und stehen dem Katalanismus nahe. Außerdem erhält der „FC Barcelona“ Unterstützung aus der Politik, vor allem aus der bürgerlich-katalanistischen CiU (Convergéncia i Unió, dt. „Konvergenz und Union“).
Auf Grund seines großen gesellschaftlichen Einflusses wird der „FC Barcelona“ nicht selten als ein „nationaler Klub“ Kataloniens gesehen.
Wodurch zeichnet sich der katalanische Nationalismus aus? Wie erheblich ist die Rolle des „FC Barcelona“ innerhalb des politischen Katalanismus? Wie entwickelte sich der Klub im Laufe seiner Geschichte zu einer politischen Institution? Welche waren die bedeutendsten Stationen in dieser Entwicklung?
Das sind die zentralen Fragen, mit denen sich diese Hausarbeit befasst.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Fragestellung
- 1.2. Literaturlage
- 2. Katalanischer Nationalismus
- 2.1. Begriff Nationalismus
- 2.2. Geschichte und Wesenszüge des Katalanismus
- 3. Fußball und Nationalismus in Spanien
- 4. FC Barcelona und Katalanismus
- 4.1. Vereinsgründung und katalanistische Positionierung
- 4.2. Der Verein und die katalanische Identität in der Franco-Zeit
- 4.3. „FC Barcelona“, Demokratie, Globalisierung und Katalanismus
- 5. Fazit: „Barça“ – eine nationale Institution?
- 6. Ausblick: Fußball - ein Ausdruck nationaler Identität?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die bedeutende Rolle des FC Barcelona im katalanischen Nationalismus. Im Fokus steht die Entwicklung des Vereins im Kontext der spanischen und katalanischen Geschichte des 20. Jahrhunderts. Die Arbeit beleuchtet die Verschränkung von Sport und Politik, insbesondere die politische Instrumentalisierung des Vereins und des katalanischen Sports.
- Definition und Entwicklung des katalanischen Nationalismus
- Der spanische Fußball im Kontext des Nationalismus
- Der FC Barcelona als politische Institution: Entstehung und Entwicklung
- Der FC Barcelona während der Franco-Diktatur
- Der FC Barcelona in der Demokratie und Globalisierung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Rolle des FC Barcelona im katalanischen Nationalismus vor. Sie verweist auf die Aussage Jordi Pujols, die den engen Zusammenhang zwischen dem Erfolg des FC Barcelona und dem katalanischen Nationalismus verdeutlicht. Die Arbeit skizziert den Forschungsansatz und die einzelnen Kapitel.
2. Katalanischer Nationalismus: Dieses Kapitel definiert den Begriff Nationalismus und beleuchtet die Geschichte und die wesentlichen Merkmale des katalanischen Nationalismus. Es legt die Grundlagen für das Verständnis des Kontextes, in dem der FC Barcelona agiert.
3. Fußball und Nationalismus in Spanien: Hier wird der spanische Fußball im 20. Jahrhundert im Kontext von Nationalismus und nationalistischer Politik untersucht. Der Fokus liegt auf der Beziehung zwischen nationalem und regionalen Nationalismus im Fußball. Die Kapitel analysiert wie Fußball als Mittel der politischen und nationalen Identitätsbildung genutzt wurde.
4. FC Barcelona und Katalanismus: Dieses Kapitel analysiert die Entwicklung des FC Barcelona in drei Phasen. Es untersucht die Vereinsgründung und die frühe Positionierung des Vereins im katalanischen Nationalismus, die Rolle des Vereins während der Franco-Diktatur als Hochburg des Widerstands und seine Entwicklung in der Demokratie und Globalisierung. Es beleuchtet die Strategien des Vereins, um die katalanische Identität zu fördern. Die sportlichen Erfolge und Rivalitäten mit anderen Vereinen, insbesondere Real Madrid, werden in den Kontext der politischen Entwicklung eingebunden.
Schlüsselwörter
Katalanischer Nationalismus, FC Barcelona, Fußball, Spanien, Franco-Diktatur, Identität, Politik, Sport, Globalisierung, nationale Institution, regionale Identität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: FC Barcelona und Katalanischer Nationalismus
Was ist der Gegenstand der Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die bedeutende Rolle des FC Barcelona im katalanischen Nationalismus. Der Fokus liegt auf der Entwicklung des Vereins im Kontext der spanischen und katalanischen Geschichte des 20. Jahrhunderts und der Verschränkung von Sport und Politik.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Entwicklung des katalanischen Nationalismus, den spanischen Fußball im Kontext des Nationalismus, den FC Barcelona als politische Institution (Entstehung und Entwicklung), seine Rolle während der Franco-Diktatur und in der Demokratie/Globalisierung. Die sportlichen Erfolge und Rivalitäten (insbesondere mit Real Madrid) werden im Kontext der politischen Entwicklung analysiert.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Hausarbeit ist in sechs Kapitel gegliedert: Einleitung (mit Forschungsfrage und Literaturlage), Katalanischer Nationalismus, Fußball und Nationalismus in Spanien, FC Barcelona und Katalanismus (unterteilt in Vereinsgründung, Franco-Zeit und die Entwicklung in der Demokratie/Globalisierung), Fazit (ist der FC Barcelona eine nationale Institution?) und Ausblick (Fußball als Ausdruck nationaler Identität?).
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Welche Rolle spielt der FC Barcelona im katalanischen Nationalismus?
Welche Quellen werden in der Arbeit verwendet?
Die Hausarbeit bezieht sich explizit auf die Aussage von Jordi Pujol über den Zusammenhang zwischen dem Erfolg des FC Barcelona und dem katalanischen Nationalismus. Weitere Quellen werden zwar nicht direkt genannt, jedoch implizieren die Kapitelüberschriften und Zusammenfassungen den Gebrauch historischer und politikwissenschaftlicher Literatur.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Hausarbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Katalanischer Nationalismus, FC Barcelona, Fußball, Spanien, Franco-Diktatur, Identität, Politik, Sport, Globalisierung, nationale Institution, regionale Identität.
Welche Kapitelzusammenfassungen bietet die Übersicht?
Die Übersicht enthält Kapitelzusammenfassungen, die die Inhalte der einzelnen Kapitel kurz beschreiben und die Argumentationslinien skizzieren. Die Zusammenfassung der Einleitung führt die Thematik und die Forschungsfrage ein. Die Kapitel zum katalanischen Nationalismus und zum spanischen Fußball legen die notwendigen Grundlagen. Das Kapitel zum FC Barcelona analysiert dessen Entwicklung in drei historischen Phasen. Das Fazit und der Ausblick werten die Ergebnisse aus und geben einen Ausblick auf weiterführende Fragestellungen.
Für wen ist diese Hausarbeit relevant?
Diese Hausarbeit ist relevant für Leser, die sich für den katalanischen Nationalismus, die Geschichte des FC Barcelona und die Verknüpfung von Sport und Politik interessieren. Sie ist insbesondere für Studierende der Geschichte, Politikwissenschaft oder Sportwissenschaften von Interesse.
Welche Rolle spielte der FC Barcelona während der Franco-Diktatur?
Die Hausarbeit untersucht den FC Barcelona während der Franco-Diktatur als Hochburg des Widerstands gegen das Regime und als wichtigen Träger katalanischer Identität.
Wie wird der FC Barcelona in der Demokratie und Globalisierung dargestellt?
Die Hausarbeit analysiert die Entwicklung des FC Barcelona in der Demokratie und Globalisierung und beleuchtet die Strategien des Vereins zur Förderung der katalanischen Identität in diesem neuen Kontext.
- Arbeit zitieren
- Slava Obodzinskiy (Autor:in), 2010, Die Rolle des Futbol Club Barcelona im katalanischen Nationalismus. Politische, gesellschaftliche und kulturelle Bedeutung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/161215