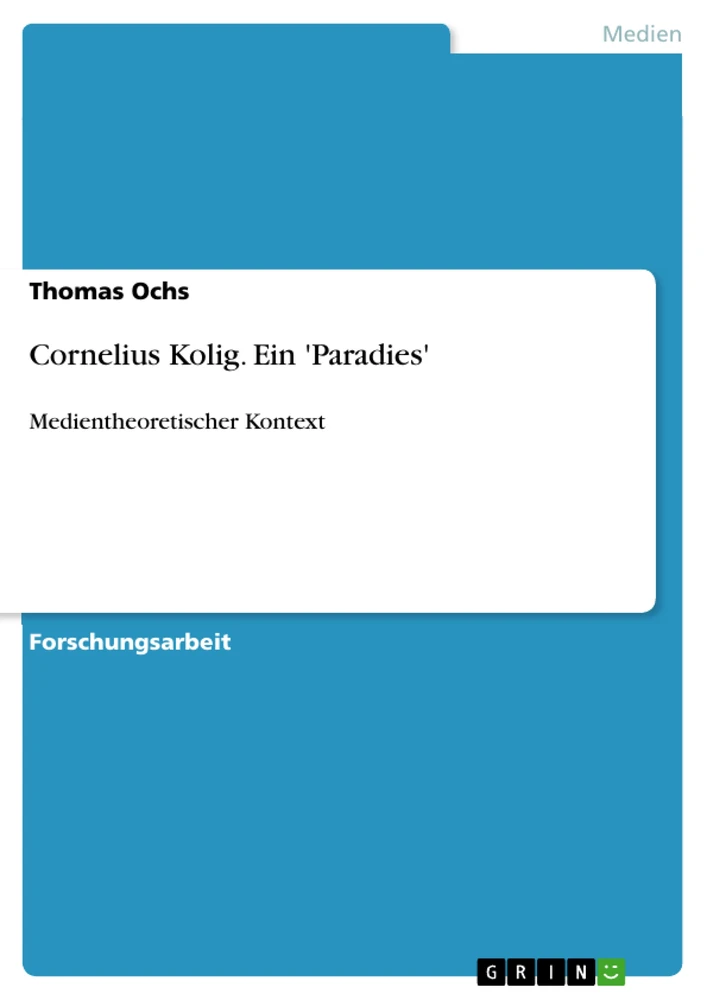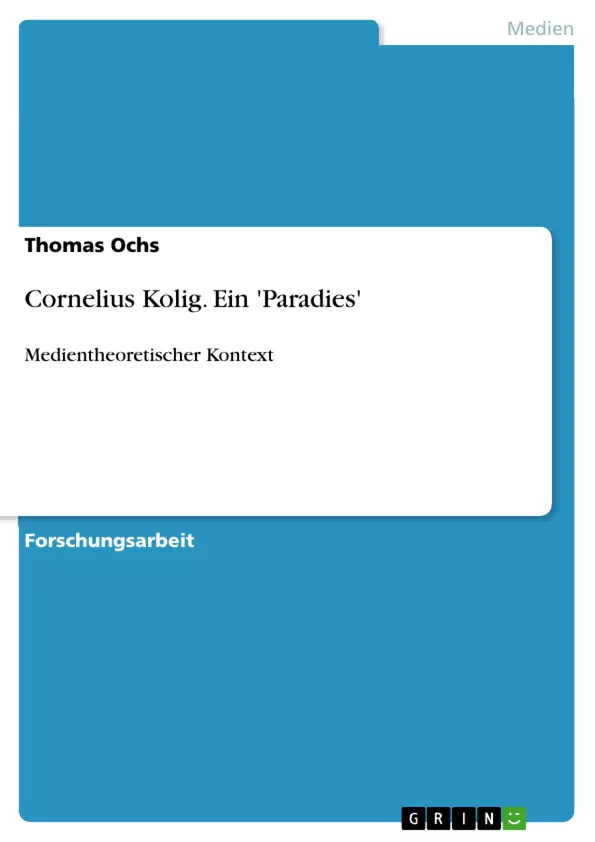Ein Interesse an dem künstlerischen Schaffen von Cornelius Kolig resultierte aus einem Ausstellungsbesuch des Essl Museums am 03.07.2009. Die Folge davon waren Diskussionen, die Grenzen oder Offenheit von Kunst zu beschreiben versuchten. Daraus entwickelte sich sowohl ein Verständnis für Unverständnis als auch eine gewisse Begeisterungsfähigkeit für solch künstlerische Ausdrucksformen. Da sich diese Ausstellungssituation gerade bei Cornelius Kolig als aus seinem Schaffen herausgenommene, vielleicht sogar zu gewissen Teilen entzogene Betrachtungsweise charakterisieren lässt, konnte nur die intensivere Beschäftigung mit seinem Konzept des ‚Paradies’, weiterführende Verstehensprozesse anregen. Eine wissenschaftliche Auseinandersetzung im medienwissenschaftlichen Kontext stellt nun einen gewissen textuellen Endpunkt von Verstehen dar. In der Folge sollen solche Kontemplationsprozesse kontextualisiert und in einen medientheoretischen Zusammenhang gebracht werden um in letzter Konsequenz eine Möglichkeit zu dokumentieren Kunst immer als eine Öffnung von Grenzen zu verstehen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Paradiesische Zustände einer Gegenwart. Hinführung
- Natur von Material(ien), Technik(en), Topoi(s)
- Maschinen als Verstärker. Maschinen als Vermittler
- Video(s). Doppelstepper (1993)
- Videostill. Von der Natur zur Kunst (1993/2009)
- Audio. Akustische Reanimation (2008)
- Fotografie. Ich habe euch nichts zu sagen! (1999/2009)
- Möglichkeit(en) von Kunstbetrachtung(en) im medientheoretischen Kontext
- Zusammenfassung und Problematisierung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das künstlerische Schaffen von Cornelius Kolig im Kontext der Medientheorie. Sie analysiert die Beziehung zwischen Koligs Konzept des "Paradies" und den verschiedenen Medien, die er in seiner Arbeit verwendet. Der Fokus liegt dabei auf der Frage, wie Koligs Kunst die Grenzen zwischen Kunst und Leben, Individuum und Gesellschaft, sowie Natur und Technik verschwimmen lässt.
- Die Bedeutung des "Paradies" als künstlerisches Konzept und Lebensraum
- Die Rolle von Medien und Technologien in Koligs Arbeit
- Die Interaktion zwischen Kunst, Natur und Technik
- Die Frage der Kunstbetrachtung im Kontext der Medientheorie
- Die Öffnung der Grenzen zwischen Kunst und Leben
Zusammenfassung der Kapitel
- Das Vorwort führt in die Arbeit ein und beschreibt den Ursprung des Interesses des Autors am Schaffen von Cornelius Kolig.
- Das Kapitel "Paradiesische Zustände einer Gegenwart. Hinführung" stellt Koligs "Paradies" als ein nie vollendetes und niemals zu vollendendes Gesamtkonstrukt partieller künstlerischer Ausdrucksfähigkeit vor.
- Das Kapitel "Video(s). Doppelstepper (1993)" analysiert ein spezifisches Videowerk von Cornelius Kolig.
- Das Kapitel "Videostill. Von der Natur zur Kunst (1993/2009)" analysiert ein weiteres Videowerk von Cornelius Kolig.
- Das Kapitel "Audio. Akustische Reanimation (2008)" analysiert ein Audiowerk von Cornelius Kolig.
- Das Kapitel "Fotografie. Ich habe euch nichts zu sagen! (1999/2009)" analysiert ein Fotowerk von Cornelius Kolig.
- Das Kapitel "Möglichkeit(en) von Kunstbetrachtung(en) im medientheoretischen Kontext" diskutiert verschiedene Möglichkeiten der Kunstbetrachtung im Kontext der Medientheorie.
Schlüsselwörter
Cornelius Kolig, Paradies, Medientheorie, Kunstbetrachtung, Video, Fotografie, Audio, Natur, Technik, Leben, Gesellschaft, Grenzen, Öffnung, künstlerische Ausdrucksfähigkeit, Werk, Kunst, Medien, Dokumentation, Rezeption
Häufig gestellte Fragen
Wer ist Cornelius Kolig?
Cornelius Kolig ist ein österreichischer Künstler, der vor allem für sein monumentales und provokantes Projekt „Das Paradies“ in Kärnten bekannt ist.
Was verbirgt sich hinter Koligs Konzept des „Paradieses“?
Es handelt sich um ein lebenslanges, nie vollendetes Gesamtkunstwerk, das als Lebensraum und Ort künstlerischer Ausdrucksfähigkeit dient und Natur, Technik sowie den menschlichen Körper verbindet.
Welche Medien nutzt Cornelius Kolig in seiner Arbeit?
Kolig arbeitet interdisziplinär mit Video, Fotografie, Audio-Installationen sowie Maschinen und technischen Objekten, die oft als „Verstärker“ oder „Vermittler“ fungieren.
Wie wird Koligs Kunst medientheoretisch eingeordnet?
Die Arbeit dokumentiert Kunst als eine „Öffnung von Grenzen“ zwischen Individuum und Gesellschaft sowie zwischen Natur und Technik im Sinne moderner Medientheorien.
Was thematisiert das Werk „Ich habe euch nichts zu sagen!“?
Dabei handelt es sich um eine fotografische Arbeit Koligs (1999/2009), die im Kontext seiner Auseinandersetzung mit Kommunikation und Verweigerung in der Kunst steht.
- Citar trabajo
- Thomas Ochs (Autor), 2010, Cornelius Kolig. Ein 'Paradies', Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/161447