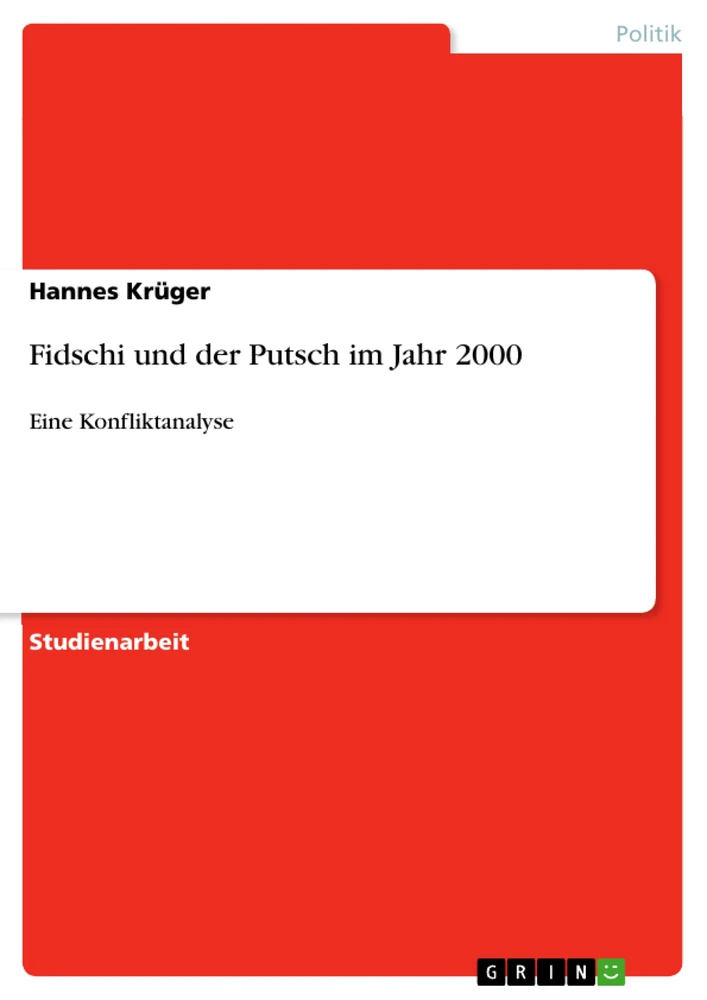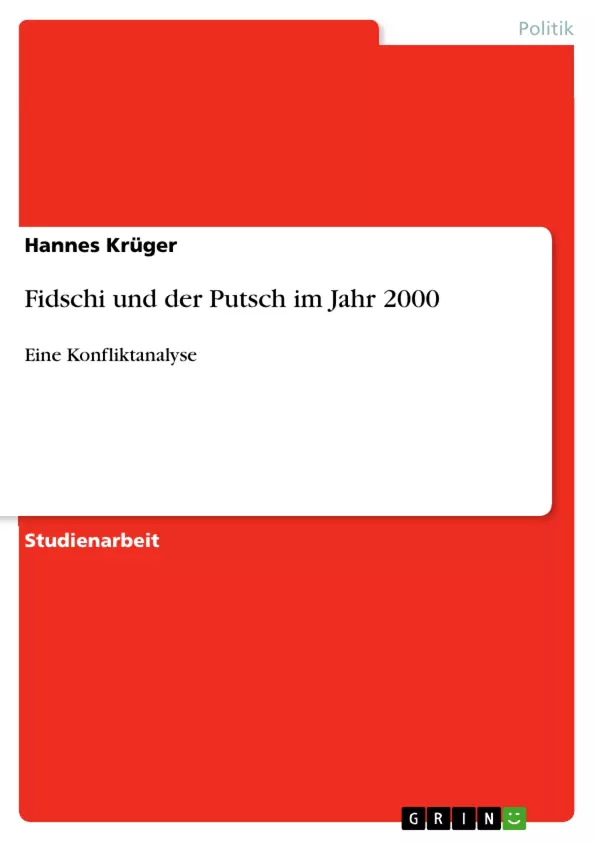Das Wort ‚Fidschi’ ist ein Inbegriff von Sonne, Urlaub und palmengesäumten weißen Stränden. Ein Urlaub in dem Inselstaat im Pazifik gilt als Ausweg aus der sonst so klein gewordenen und hektischen Welt.
Doch findet Fidschi nicht nur als Urlaubsparadies den Weg in unsere Medien: zuletzt putschte im Jahr 2006 Josaia Voreqe Bainimarama, der damalige Militärchef und heutige Regierungschef des Staates, und sorgte damit weltweit für Schlagzeilen. Dies war bereits der vierte Staatsputsch in nur 20 Jahren und deutet auf eine politisch recht instabile Lage hin. Trotzdem schaffen es Touristikverbände und Politiker, den Konflikt so klein zu spielen, dass sich die Ströme von Urlaubern nicht, oder nur kurzzeitig, unterbrechen.
Was also ist das für ein Konflikt, der anscheinend für Besucher so schlecht, für die Einwohner aber elementar zu erkennen ist?
Diese Frage hatte mein Interesse geweckt. Mit der vorliegenden Ausarbeitung möchte ich mich genauer mit diesem Konflikt und seinen Konfliktlinien auseinandersetzen.
Dabei werde ich mich auf den Staatsstreich von 2000 beschränken, dem dritten in der Geschichte der Republik, bei dem der Geschäftsmann George Speight die Führung des Landes kurzzeitig an sich riss.
Dazu werde ich zu Beginn den Staat Fidschi genauer vorstellen und dabei auf die Geographie, Bevölkerung und Politik eingehen. Anschließend werde ich eine theoretische Einordnung des Konfliktes anhand des Protracted Social Conflict Modells von Azar, der Human needs Theorie von Burton und anhand des jährlich erscheinenden Heidelberger Konfliktbarometers vornehmen. Es folgt eine allgemeine Konfliktbeschreibung, in der ich die hauptsächlichen Konfliktlinien herausarbeite und in einen historischen Kontext stelle.
Um ein genaueres Verständnis von der Ausgangslage des Putsches zu bekommen, werde ich die politische Geschichte von Fidschi darstellen. Nach der genauren Beschreibung des Putschverlaufes werde ich abschließend noch einmal die während dieser Zuspitzung des Konfliktes involvierten Akteure mit deren Zielsetzungen und Handlungenmöglichkeiten beschreiben. Am Ende ziehe ich ein Fazit, in dem ich eine Bewertung der Ereignisse vornehmen werde.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- GRUNDDATEN VON FIDSCHI
- KONFLIKTBESCHREIBUNG
- THEORETISCHE EINORDNUNG DES KONFLIKTES
- Human Needs Theorie
- Protracted Social Conflict
- Heidelberger Konfliktbarometer
- HISTORISCHE ENTWICKLUNG
- VERLAUF DES PUTSCHES
- DIE AKTEURE UND IHRE ZIELE
- Akteure von innen
- George Speight
- Polizei/Armee
- Regierung
- Übergangsregierung
- Oberstes Gericht
- Parteien
- Kirchen
- Der Westen Viti Levus
- Great Council of Chiefs
- Arbeiter
- Wasserkraftwerk
- Akteure von außen
- Australien
- Neuseeland
- USA
- Japan
- Großbritannien
- Indien
- United Nations
- EU
- Commonwealth of Nations
- Australian Trade Union Movement
- Rotes Kreuz
- Medien
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit dem Konflikt in Fidschi, der im Jahr 2000 zu einem Putsch führte. Er analysiert die Ursachen, die zur Eskalation des Konflikts führten, und beleuchtet die verschiedenen Akteure und ihre Ziele im Kontext der Ereignisse.
- Die ethnischen Konflikte zwischen den indigenen Fidschianern und den Indo-Fidschianern
- Die Rolle traditioneller Strukturen und der Great Council of Chiefs
- Die Bedeutung wirtschaftlicher Ungleichgewichte und Machtkämpfe
- Die Reaktion der internationalen Gemeinschaft auf den Putsch
- Die Folgen des Putsches für die politische und wirtschaftliche Situation Fidschis
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel führt in die Thematik ein und stellt Fidschi als Urlaubsparadies und zugleich als politisch instabilen Staat dar. Der Fokus liegt auf dem Staatsstreich von 2000.
- Im zweiten Kapitel werden die Grunddaten von Fidschi vorgestellt, einschließlich Geographie, Bevölkerung, Politik und Wirtschaft.
- Das dritte Kapitel beleuchtet die Konfliktlinien in der fidschianischen Gesellschaft, insbesondere den Streit um Land, Macht und Ressourcen zwischen den indigenen Fidschianern und den Indo-Fidschianern. Es wird die Überlappung von traditionellen und modernen Institutionen als Konfliktursache hervorgehoben.
- Kapitel vier setzt sich mit der theoretischen Einordnung des Konflikts auseinander. Es werden die Theorien von Burton und Azar zur Analyse von sozialen Konflikten sowie das Heidelberger Konfliktbarometer herangezogen.
- Kapitel fünf beleuchtet die historische Entwicklung von Fidschi, die mit dem Aufkommen der europäischen Kolonialisierung und der Einwanderung indischer Kontraktarbeiter beginnt. Es werden die Entstehung ethnischer Stereotype und die Entwicklung von Machtstrukturen beschrieben, die zu den heutigen Konflikten beitragen.
- Kapitel sechs schildert den Verlauf des Putsches von 2000, beginnend mit dem Angriff auf das Parlament und der Geiselnahme des Premierministers, über die Eskalation der Gewalt bis hin zur Einsetzung der Übergangsregierung.
Schlüsselwörter
Die Hauptthemen des Textes sind die ethnischen Konflikte in Fidschi, die zum Putsch von 2000 führten. Dabei stehen die verschiedenen Kulturen und die ungleiche Verteilung von Macht und Ressourcen im Vordergrund. Wichtige Schlüsselbegriffe sind: indigene Fidschianer, Indo-Fidschianer, Great Council of Chiefs (GCC), Protracted Social Conflict, Human Needs, Heidelberger Konfliktbarometer, Putsch, Staatsstreich, Geiselnahme, Übergangsregierung, internationale Gemeinschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was war die Ursache für den Putsch im Jahr 2000 auf Fidschi?
Der Putsch wurzelte in tiefen ethnischen Spannungen zwischen indigenen Fidschianern und Indo-Fidschianern sowie in Machtkämpfen um Land, Ressourcen und politische Vorherrschaft.
Wer war George Speight?
George Speight war ein Geschäftsmann, der im Jahr 2000 das Parlament stürmte, den Premierminister als Geisel nahm und kurzzeitig die Führung des Landes an sich riss.
Welche theoretischen Modelle werden zur Analyse des Konflikts genutzt?
Die Arbeit verwendet das "Protracted Social Conflict" Modell von Azar, die "Human Needs" Theorie von Burton und das Heidelberger Konfliktbarometer.
Welche Rolle spielt der "Great Council of Chiefs" (GCC)?
Der GCC ist eine traditionelle Institution der indigenen Bevölkerung, die eine zentrale Rolle in der politischen Stabilität und bei der Vermittlung während Krisen spielt.
Wie reagierte die internationale Gemeinschaft auf die Ereignisse?
Akteure wie Australien, Neuseeland, die UN und die EU reagierten mit politischem Druck und Sanktionen, um die Rückkehr zur demokratischen Ordnung zu erzwingen.
- Citar trabajo
- Hannes Krüger (Autor), 2008, Fidschi und der Putsch im Jahr 2000, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/161797