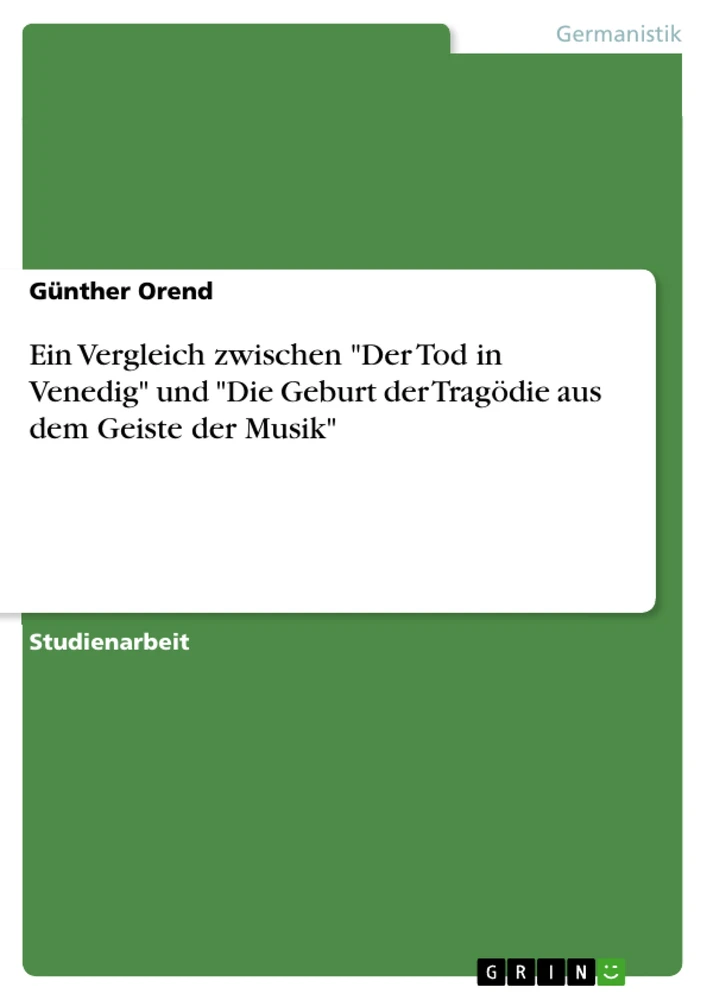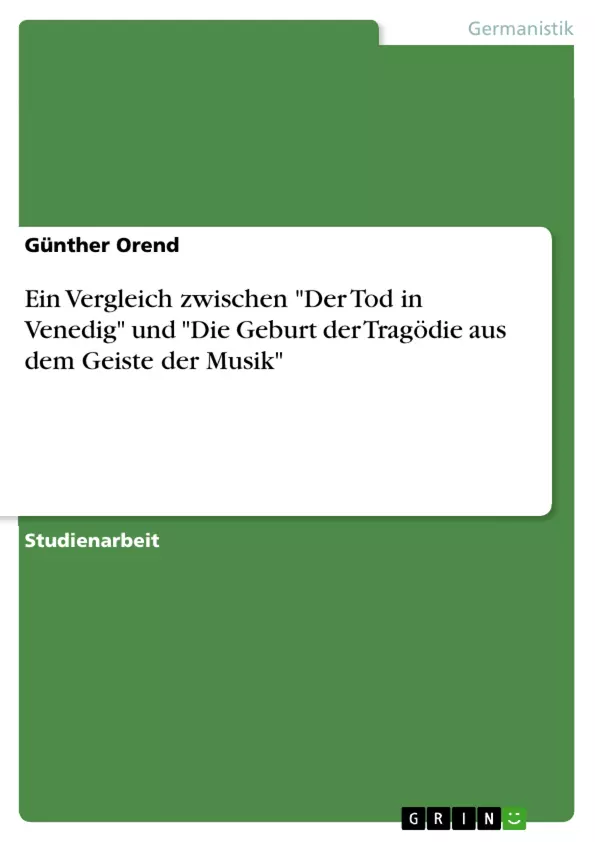„Wer Nietzsche ‚eigentlich’ nimmt, wörtlich nimmt, wer ihm glaubt, ist verloren.“ So äußerte sich Thomas Mann 1947 über Friedrich Nietzsche in seinem Vortrag „Nietzsches Philosophie im Lichte unserer Erfahrung“. Seine Haltung Nietzsche gegenüber war neben Bewunderung schon immer von einer ironischen Distanz geprägt. Nach den Verbrechen des Zweiten Weltkrieges, für die er Nietzsches Philosophie mit verantwortlich machte, schlug seine Bewunderung in ästhetische
und ethische Kritik um. So war Zarathustra für ihn nun „dieser gesicht- und gestaltlose Unhold und Flügelmann“ mit einer „zweifelhaften Prophetie“.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Apollinische und das Dionysische
- Der Einfluss Schopenhauers auf Nietzsches Philosophie
- Das Zusammenwirken des Apollinischen und des Dionysischen in der Kunst
- Die Entwicklung Aschenbachs
- Die Künstlerproblematik
- Dekadenz
- Nietzsches Dekadenzbegriff
- Aschenbach als ein décadent im Sinne Nietzsches
- Mythos
- Die Funktion des tragischen Mythos
- Griechische Mythologie
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit einem Vergleich zwischen Thomas Manns Novelle „Der Tod in Venedig“ und Friedrich Nietzsches Werk „Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik“. Ziel ist es, die gegenseitigen Einflüsse der beiden Werke aufzuzeigen und zu untersuchen, wie sich Nietzsches Philosophie in Manns Werk niederschlägt.
- Das Gegensatzpaar apollinisch-dionysisch
- Die Dekadenz als kulturelles und individuelles Phänomen
- Die Bedeutung des Mythos in Kunst und Literatur
- Die Künstlerproblematik und die Suche nach dem Sinn
- Das Spannungsverhältnis zwischen Vernunft und Leidenschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt den Vergleich zwischen Thomas Manns „Der Tod in Venedig“ und Friedrich Nietzsches „Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik“ in den Kontext der literarischen und philosophischen Debatten des frühen 20. Jahrhunderts. Sie beleuchtet Manns kritische Haltung gegenüber Nietzsche und beschreibt den Einfluss von Nietzsches Werk auf Manns Novelle.
Das Apollinische und das Dionysische
Dieses Kapitel untersucht das zentrale Gegensatzpaar apollinisch-dionysisch, das sowohl bei Nietzsche als auch bei Mann eine wichtige Rolle spielt. Es wird der Einfluss Arthur Schopenhauers auf Nietzsches Philosophie erläutert, insbesondere seine Lehre von der Welt als Wille und der Welt als Vorstellung, die bei Nietzsche in die beiden Kunsttriebe apollinisch und dionysisch überführt werden. Anschließend wird das Zusammenwirken dieser beiden Triebe in der Kunst beleuchtet. Im weiteren Verlauf wird die Entwicklung Aschenbachs im Kontext des apollinischen und dionysischen Prinzips analysiert und die Künstlerproblematik im Spannungsfeld dieser beiden Pole beleuchtet.
Dekadenz
In diesem Kapitel wird Nietzsches Dekadenzbegriff im Zusammenhang mit seiner Philosophie diskutiert und auf Aschenbach als einen „décadent“ im Sinne Nietzsches eingegangen. Es werden die kulturellen und individuellen Aspekte der Dekadenz im Werk von Mann untersucht und mit Nietzsches Analyse des Verfalls der europäischen Kultur verglichen.
Mythos
Der Abschnitt widmet sich der Funktion des tragischen Mythos in beiden Werken. Es wird die Bedeutung der griechischen Mythologie für die Kunst von Mann und Nietzsche analysiert und die Rolle des Mythos als Ausdruck von tieferen menschlichen Erfahrungen und Sehnsüchten herausgestellt.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themenbereiche der Arbeit sind: Thomas Mann, „Der Tod in Venedig“, Friedrich Nietzsche, „Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik“, apollinisch-dionysisch, Dekadenz, Mythos, Künstlerproblematik, Kunstverständnis, ästhetisches Erlebnis, Schopenhauer, Philosophie, Literaturgeschichte, Kulturgeschichte.
- Quote paper
- Günther Orend (Author), 2005, Ein Vergleich zwischen "Der Tod in Venedig" und "Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/161799