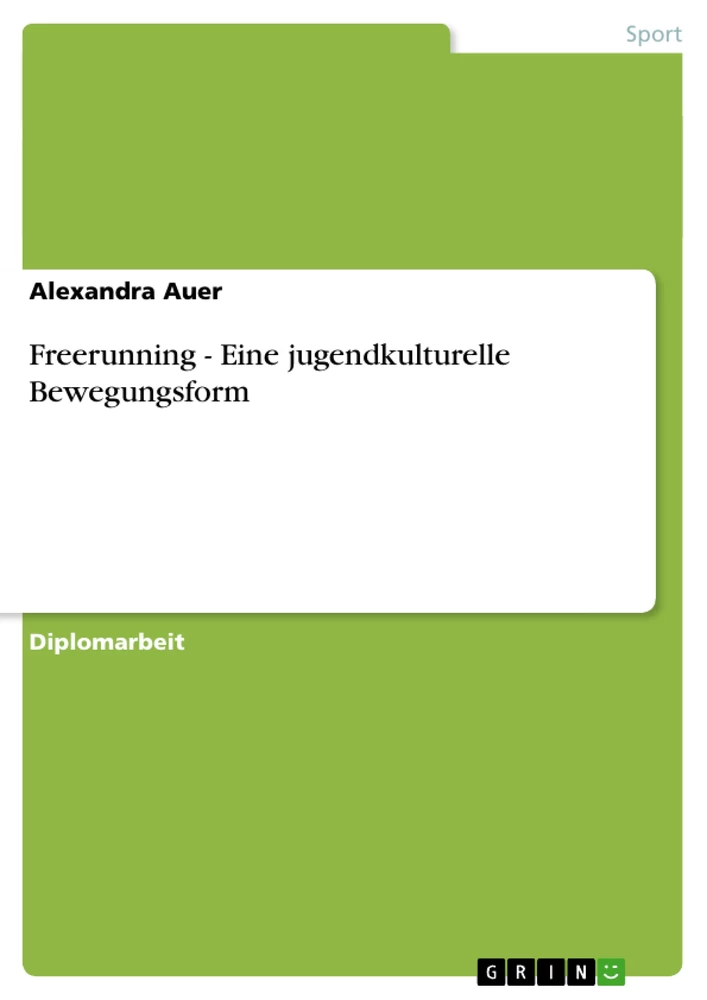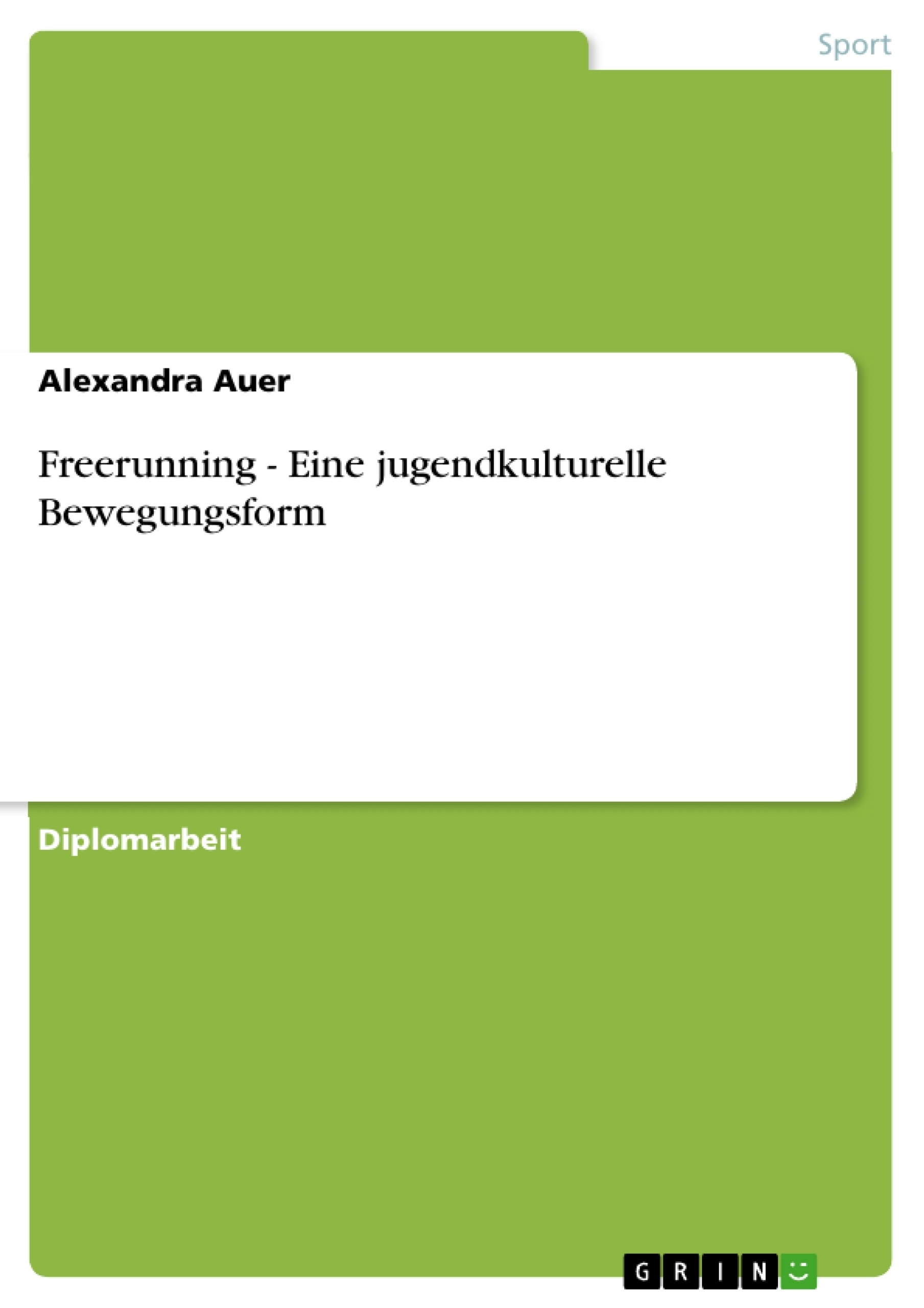Freerunning ist eine immer mehr bekannt werdende Bewegungsform, die sich augenblicklich erscheinend in subkulturellen urbanen Lebenssituationen entwickelt hat und hier auch seinen Lauf findet.
Freerunning ist eine völlig neu entstandene urbane Freestyle-Sportart, ohne „Mutterdisziplin“, welche andere Sportarten wie New School (Ski Alpin), Dirt/Slopestyle (Mountainbiken) oder auch Freestyle Fußball (Fußball) jedoch sehr wohl haben (vgl. Botros 2007). Für mich ist es interessant herauszufinden, wo diese reine Freestyle Sportart ihre Wurzeln hat und in welchen sozialen Schichten diese urbane Freestyle-Sportart entstanden ist. Hier gilt es erstmals zu thematisieren, was Freerunning ist. Aber ist es überhaupt sinnvoll, Definitionen zu erstellen? Oder stehen Definitionen doch eher im Widerspruch zum „Freestyle-Gedanken“ bzw. zur Einstellung jugendkultureller Szenen? Kann man Freerunning als Trendsport sehen und wie weit grenzt sich Freerunning vom Wettkampfsport ab? Steht Individualität und Kreativität vor Normierungen und Reglementierungen, welche von jugendkulturellen Szenen oftmals verachtet werden oder weshalb sich neue jugendkulturelle Szenen überhaupt entwickeln?
Da Freerunning eine sehr junge Bewegungsform jugendkultureller Szenen ist und noch wenig wissenschaftliche Untersuchungen vorliegen, möchte ich meine Arbeit der Thematisierung dieser Bewegungsform widmen. Es sollen nicht Hypothesen erstellt und hinterfragt bzw. belegt oder widerlegt werden, sondern, in Hinblick auf die jugendliche Suche nach personaler und sozialer Identität, die gegenwärtig zu einer verstärkten Thematisierung von Körper und Bewegung führt, ein neuer Forschungshorizont eröffnet werden, der neue Forschungsfragen und Hypothesen zulässt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Wissenschaftliche Fragestellungen
- 1.2 Zum forschungsmethodischen Vorgehen
- 1.3 Gliederung der Arbeit
- 2 Zum Stand der Forschung
- 2.1 Einleitung
- 2.1.1 Die Entwicklung der Sportart Freerunning (historischer Abriss)
- 2.1.2 Philosophie und Sport - Philosophie und Freerunning
- 2.2 Jugendkulturen und jugendkulturelle Bewegungsformen
- 2.2.1 Jugendkultur und jugendkulturelle Szenen
- 2.2.2 Jugendszenen, Stile und Codes
- 2.2.4 Jugendkulturen und Geschlecht
- 2.2.5 Jugendszenen und soziale Herkunft
- 2.2.6 Merkmale, Strukturen und Symbole bewegungsorientierter Jugendszenen
- 2.3 Freerunning - eine jugendkulturelle Bewegungsform
- 2.3.1 Freerunning als neue Trendsportart?
- 2.3.2 Bewegung und Kunst = Freerunning. Kunst als Selbstausdruck des Inszenierers.
- 2.3.3 Bewegung in einer urbanen Umgebung
- 2.3.4 Präsentation von Freerunning
- 3 Empirischer Teil
- 3.1 Das Setting
- 3.1.1 Die Sportler
- 3.1.2 Die Interviews
- 3.1.3 Der Interviewleitfaden
- 3.2 Die Analyse
- 3.3 Vertikale Analyse
- 3.3.1 Erstes Interview. Freerunning Biographie
- 3.3.2 Zweites Interview
- 3.3.3 Drittes Interview
- 3.3.4 Viertes Interview
- 3.3.5 Fünftes Interview
- 3.4 Horizontale Analyse
- 3.4.1 Soziodemographische Herkunft
- 3.4.2 Sportbiographien
- 3.4.3 Freerunning Biographien
- 3.4.4 Freerunning Alltag
- 3.4.5 Freerunning als Lifestyle
- 4 Zusammenfassung
- 4.1 Beantwortung der wissenschaftlichen Fragestellungen
- 4.1.1 Freerunning als jugendkulturelle Bewegungsform
- 4.1.2 Ähnlichkeiten in den (sport-)biographischen Verläufen, die zur Ausübung von Freerunning führen
- 4.1.3 Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten in der alltäglichen Ausübung von Freerunning
- 4.1.4 Beweggründe für etwaige Wettkampfteilnahme, Präsentation von Freerunning in der Öffentlichkeit
- 4.2 Schluss
- 5 Anhang
- 5.1 Beispiel Interview
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Freerunning als jugendkulturelle Bewegungsform. Ziel ist es, die sozialen und biografischen Hintergründe der Freerunner zu beleuchten und Freerunning im Kontext von Jugendkulturen zu verorten. Die Studie analysiert die Praktiken, Motivationen und den Lifestyle der Freerunner.
- Freerunning als jugendkulturelle Praxis
- Biografische Verläufe und der Weg zum Freerunning
- Der Alltag der Freerunner und die Integration von Freerunning in ihr Leben
- Freerunning als Lifestyle und Selbstdarstellung
- Wettkampfteilnahme und öffentliche Präsentation von Freerunning
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema Freerunning als jugendkulturelle Bewegungsform ein, formuliert die wissenschaftlichen Fragestellungen der Arbeit und beschreibt das methodische Vorgehen. Es skizziert den Aufbau und die Struktur der gesamten Arbeit.
2 Zum Stand der Forschung: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zu Freerunning, Jugendkulturen und deren Schnittmenge. Es beleuchtet die historische Entwicklung des Freerunning, diskutiert philosophische Aspekte und untersucht die Charakteristika von Jugendkulturen und deren Ausprägungen im Bereich der Bewegungskultur. Besonderes Augenmerk liegt auf der Einordnung von Freerunning innerhalb dieser Rahmenbedingungen.
3 Empirischer Teil: Der empirische Teil präsentiert die Ergebnisse der durchgeführten Interviews mit Freerunnern. Es wird das Setting der Studie detailliert beschrieben, inklusive der Auswahl der Interviewpartner und des verwendeten Interviewleitfadens. Die Daten werden sowohl vertikal (individuelle Interviews) als auch horizontal (vergleichende Analyse) ausgewertet, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Hintergrund, den Biografien und dem Alltag der Befragten aufzuzeigen.
Schlüsselwörter
Freerunning, Jugendkultur, Bewegungsform, Sportbiografie, Lifestyle, Trendsportart, urbane Umgebung, Selbstdarstellung, Interview, qualitative Forschung, Jugendliche, Soziale Herkunft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse von Freerunning als jugendkulturelle Bewegungsform
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht Freerunning als jugendkulturelle Bewegungsform. Sie beleuchtet die sozialen und biografischen Hintergründe der Freerunner und verortet Freerunning im Kontext von Jugendkulturen. Analysiert werden Praktiken, Motivationen und der Lifestyle der Freerunner.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf folgende Punkte: Freerunning als jugendkulturelle Praxis, biografische Verläufe und den Weg zum Freerunning, den Alltag der Freerunner und die Integration von Freerunning in ihr Leben, Freerunning als Lifestyle und Selbstdarstellung, sowie Wettkampfteilnahme und öffentliche Präsentation von Freerunning.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Überblick zum Stand der Forschung, einen empirischen Teil, eine Zusammenfassung und einen Anhang. Die Einleitung stellt die Forschungsfragen und die Methodik vor. Der Forschungsüberblick beleuchtet Freerunning, Jugendkulturen und deren Schnittmenge. Der empirische Teil präsentiert die Ergebnisse von Interviews mit Freerunnern. Die Zusammenfassung beantwortet die Forschungsfragen und zieht Schlussfolgerungen. Der Anhang enthält beispielsweise ein Beispielinterview.
Welche Methode wurde angewendet?
Im empirischen Teil der Arbeit wurden qualitative Interviews mit Freerunnern geführt. Die Datenanalyse erfolgte sowohl vertikal (individuelle Interviews) als auch horizontal (vergleichende Analyse) um Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzuzeigen.
Welche Forschungsfragen werden gestellt?
Die Arbeit untersucht, wie sich Freerunning als jugendkulturelle Bewegungsform darstellt, welche Ähnlichkeiten in den (sport-)biografischen Verläufen zur Ausübung von Freerunning bestehen, welche Gemeinsamkeiten im alltäglichen Ausüben von Freerunning zu finden sind und welche Beweggründe für etwaige Wettkampfteilnahmen oder öffentliche Präsentationen von Freerunning existieren.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst folgende Kapitel: Einleitung (mit wissenschaftlichen Fragestellungen, methodischem Vorgehen und Gliederung), Stand der Forschung (mit Unterkapiteln zu Freerunning, Jugendkulturen und deren Verbindung), Empirischer Teil (mit Settingbeschreibung, Datenanalyse und Auswertung), Zusammenfassung (mit Beantwortung der Forschungsfragen und Schlussfolgerung) und Anhang (mit Beispielinterview).
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Freerunning, Jugendkultur, Bewegungsform, Sportbiografie, Lifestyle, Trendsportart, urbane Umgebung, Selbstdarstellung, Interview, qualitative Forschung, Jugendliche, Soziale Herkunft.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für akademische Zwecke bestimmt und dient der Analyse von Themen in strukturierter und professioneller Weise.
- Quote paper
- Bachelor Alexandra Auer (Author), 2010, Freerunning - Eine jugendkulturelle Bewegungsform, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/162111