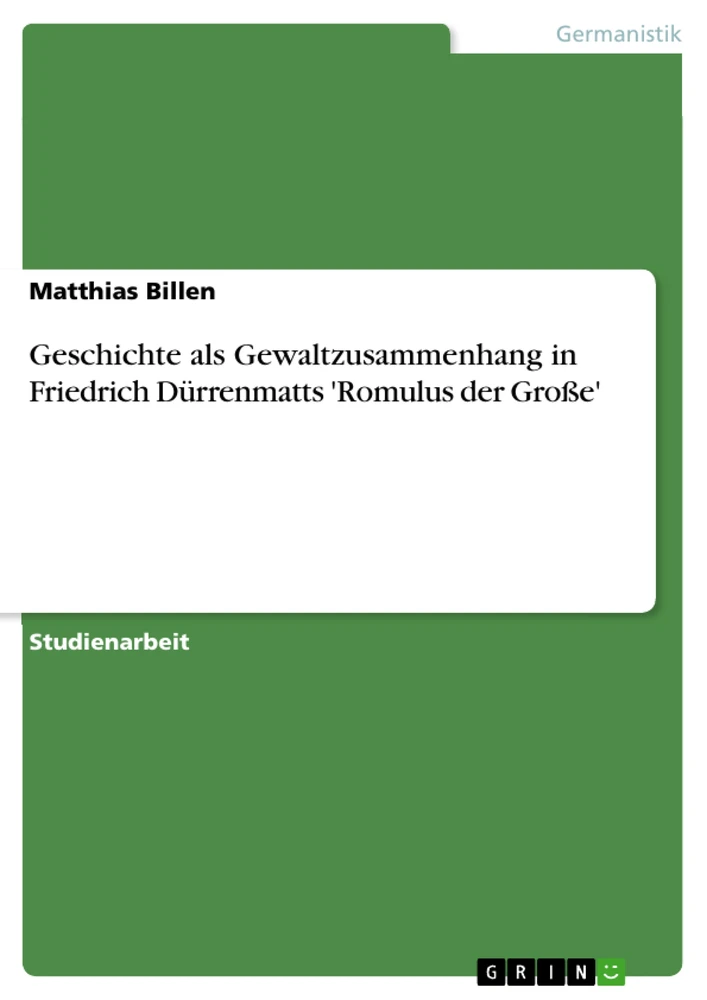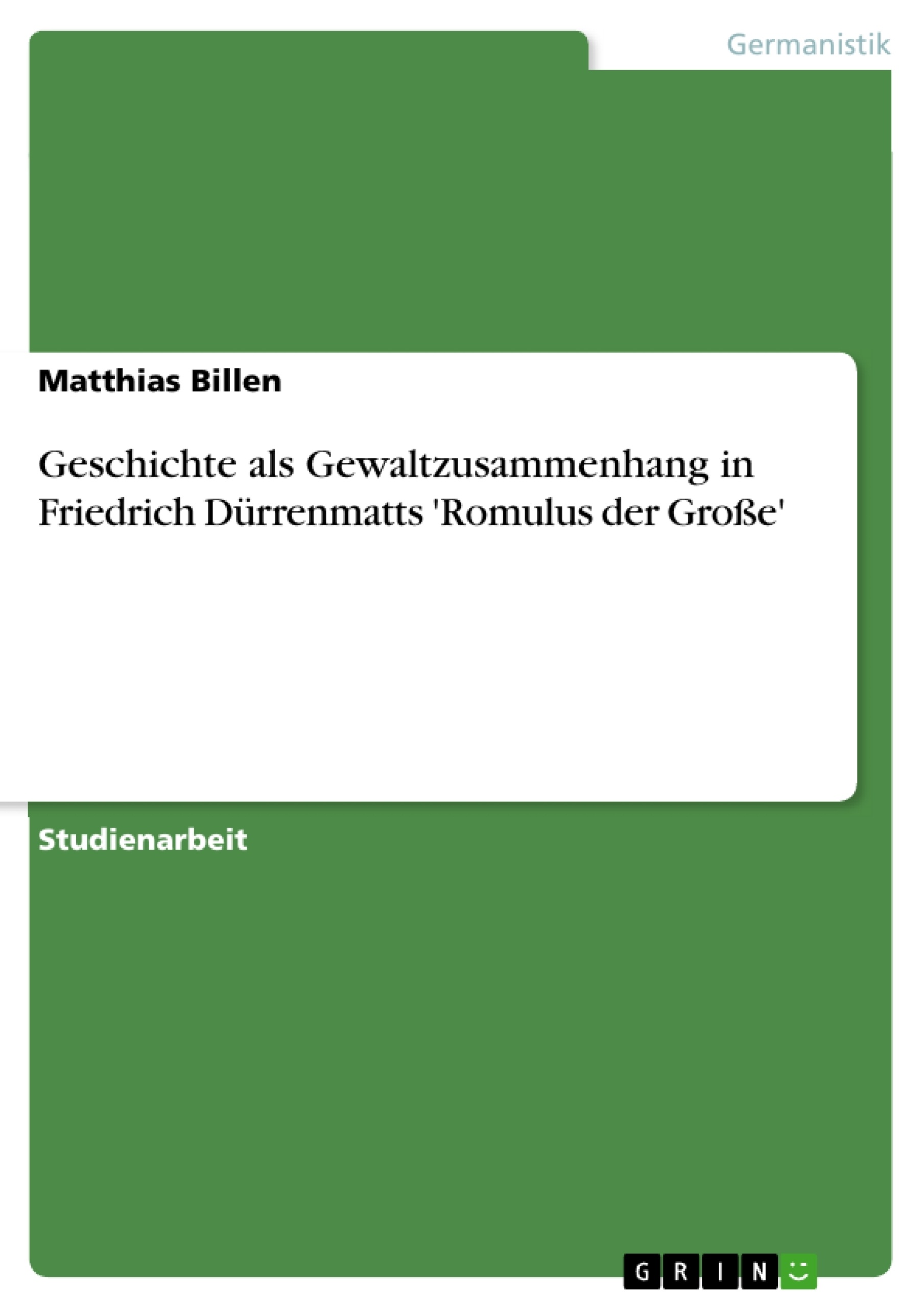Die Geschichte des Römischen Reiches ist einer der zentralen Bereiche vor allem der Ge-schichtswissenschaft, jedoch wird dieses Thema auch in vielen anderen wissenschaftlichen und nicht-wissenschaftlichen Disziplinen rezipiert. Für die Germanistik wird diese histori-sche Thematik u.a. relevant bei der Behandlung von Dramen mit historischen Stoffen. Friedrich Dürrenmatts Komödie „Romulus der Große“1 bedient sich dieser historischen Motive, indem es den letzten römischen Kaiser Romulus als Hauptfigur des Dramas agie-ren lässt. Aus dem letzten Tag des Römischen Reiches wird somit ein groteskes Zerrbild der Historie. Das Thema dieser Arbeit soll daher die Frage sein, inwiefern Dürrenmatt Geschichte in seinem Drama verarbeitet und welche Bedeutung Individuen für den Verlauf der Geschich-te haben. Dies veranlasst zu der These, dass Geschichte zu einer Abfolge von Gewaltzu-sammenhängen konstruiert wird, was sich einerseits im Handeln bzw. Nicht-Handeln der einzelnen Charaktere im Drama zeigt, aber auch in den zeithistorischen Anspielungen vor dem Hintergrund des 20. Jahrhunderts. Diese Gewaltzusammenhänge perpetuieren sich fortgehend und die einzelnen Individuen, ob Kaiser oder Kammerdiener, können den Ver-lauf der Geschichte in dieser spezifischen Geschichtsauffassung nicht beeinflussen. Im Folgenden sollen daher die spezifische Form der Komödie, wie sie in „Romulus der Große“ verwirklicht wird, sowie die verschiedenen Charaktere auf der Figuren- und auf der teils abweichenden Textebene analysiert werden. In einem weiteren Schritt wird Bezug genommen auf den vierten Akt als inhaltlichen Bruch, der die spezifische Konzeption von Geschichte deutlich markiert. Diese Konzeption geschieht auf einer textuellen Ebene, es soll jedoch auch versucht werden, Zusammenhänge zur konkreten Zeithistorie Dürrenmatts zu beleuchten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Geschichte als „Komödie“
- Geschichtsdrama und historisches Drama
- Theaterkonzept Dürrenmatts
- Realisierung der Komödie in „Romulus der Große“
- Motivationen der zentralen Charaktere
- Figurenebene
- Romulus
- Odoaker
- Ämilian
- Textebene
- Figurenebene
- Der vierte Akt als inhaltlicher Wendepunkt
- Konzeption von Geschichte
- Verarbeitung der Antike
- Zeithistorische Bezüge
- Das Individuum und die Geschichte
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Friedrich Dürrenmatts Komödie „Romulus der Große“ und untersucht, inwiefern das Stück Geschichte verarbeitet und welche Bedeutung Individuen für den Verlauf der Geschichte haben. Dabei wird die These aufgestellt, dass Dürrenmatt Geschichte als eine Abfolge von Gewaltzusammenhängen konstruiert, die sich sowohl im Handeln der Charaktere als auch in zeithistorischen Bezügen widerspiegeln. Die Arbeit analysiert die spezifische Form der Komödie, die zentralen Charaktere und den vierten Akt als inhaltlichen Wendepunkt, um die Konzeption von Geschichte in „Romulus der Große“ zu beleuchten.
- Verarbeitung von Geschichte in einem dramatischen Kontext
- Dürrenmatts Theaterkonzept und die Rolle der Komödie
- Motivationen und Handlungen der zentralen Charaktere
- Der vierte Akt als Wendepunkt in der dramatischen Entwicklung
- Zeithistorische Bezüge und die Konzeption von Geschichte
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und führt in die Thematik von Geschichte und Individuum in Dürrenmatts „Romulus der Große“ ein. Sie erläutert die Forschungsfrage, die These der Arbeit und die Vorgehensweise.
- Geschichte als „Komödie“: Dieses Kapitel analysiert die Verwendung komödiantischer Mittel in Dürrenmatts Stück und beleuchtet den Unterschied zu traditionellen Komödien. Es beleuchtet den Begriff des „Geschichtsdramas“ und die Bedeutung historischer Stoffe in der Dramaturgie.
- Motivationen der zentralen Charaktere: Dieses Kapitel untersucht die Figuren und ihre Motivationen, wobei sowohl die Figurenebene als auch die Textebene beleuchtet werden. Die Analyse fokussiert auf die Figuren Romulus, Odoaker und Ämilian.
- Der vierte Akt als inhaltlicher Wendepunkt: Dieses Kapitel analysiert den vierten Akt als entscheidenden Punkt in der dramatischen Entwicklung und zeigt, wie er die spezifische Konzeption von Geschichte im Stück verdeutlicht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die folgenden Schlüsselbegriffe: Friedrich Dürrenmatt, „Romulus der Große“, Komödie, Geschichtsdrama, historisches Drama, Gewaltzusammenhänge, Individuum, Geschichte, zeithistorische Bezüge, Groteske, Absurdität.
Häufig gestellte Fragen
Warum bezeichnet Dürrenmatt „Romulus der Große“ als Komödie?
Dürrenmatt nutzt die Komödie, um die tragischen Aspekte der Geschichte durch Groteske und Absurdität darzustellen, da er glaubt, dass die moderne Welt durch das Tragische allein nicht mehr fassbar ist.
Was ist die zentrale These zur Geschichte in diesem Drama?
Die Arbeit vertritt die These, dass Dürrenmatt Geschichte als einen „Gewaltzusammenhang“ konstruiert, in dem das Individuum kaum Einfluss auf den Verlauf der Ereignisse hat.
Welche Rolle spielt die Figur des Romulus?
Romulus agiert als ein Kaiser, der den Untergang seines Reiches bewusst herbeiführt, um die historische Schuld Roms zu sühnen, was ihn zu einer paradoxen Heldenfigur macht.
Wie wird der vierte Akt im Stück interpretiert?
Der vierte Akt gilt als inhaltlicher Wendepunkt, der die spezifische Konzeption von Geschichte deutlich markiert und die Machtlosigkeit der Charaktere gegenüber den historischen Prozessen zeigt.
Gibt es in dem Stück Bezüge zur Zeitgeschichte des 20. Jahrhunderts?
Ja, Dürrenmatt nutzt den historischen Stoff der Antike, um auf die Gewaltzusammenhänge und politischen Strukturen seiner eigenen Zeit, insbesondere die Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs, anzuspielen.
- Arbeit zitieren
- Matthias Billen (Autor:in), 2008, Geschichte als Gewaltzusammenhang in Friedrich Dürrenmatts 'Romulus der Große', München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/162170