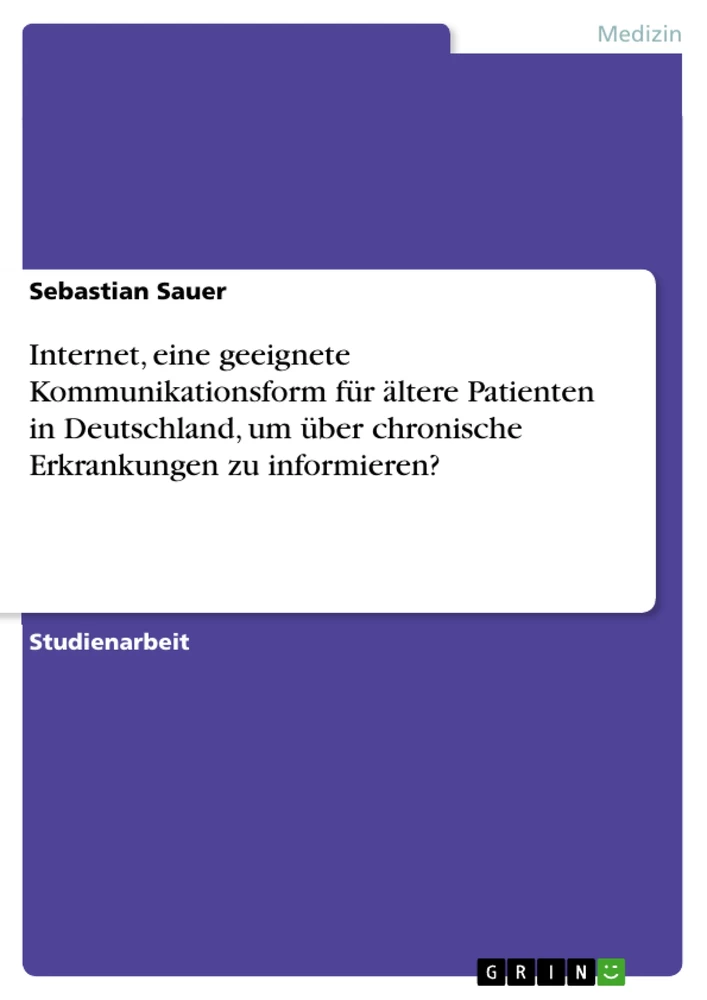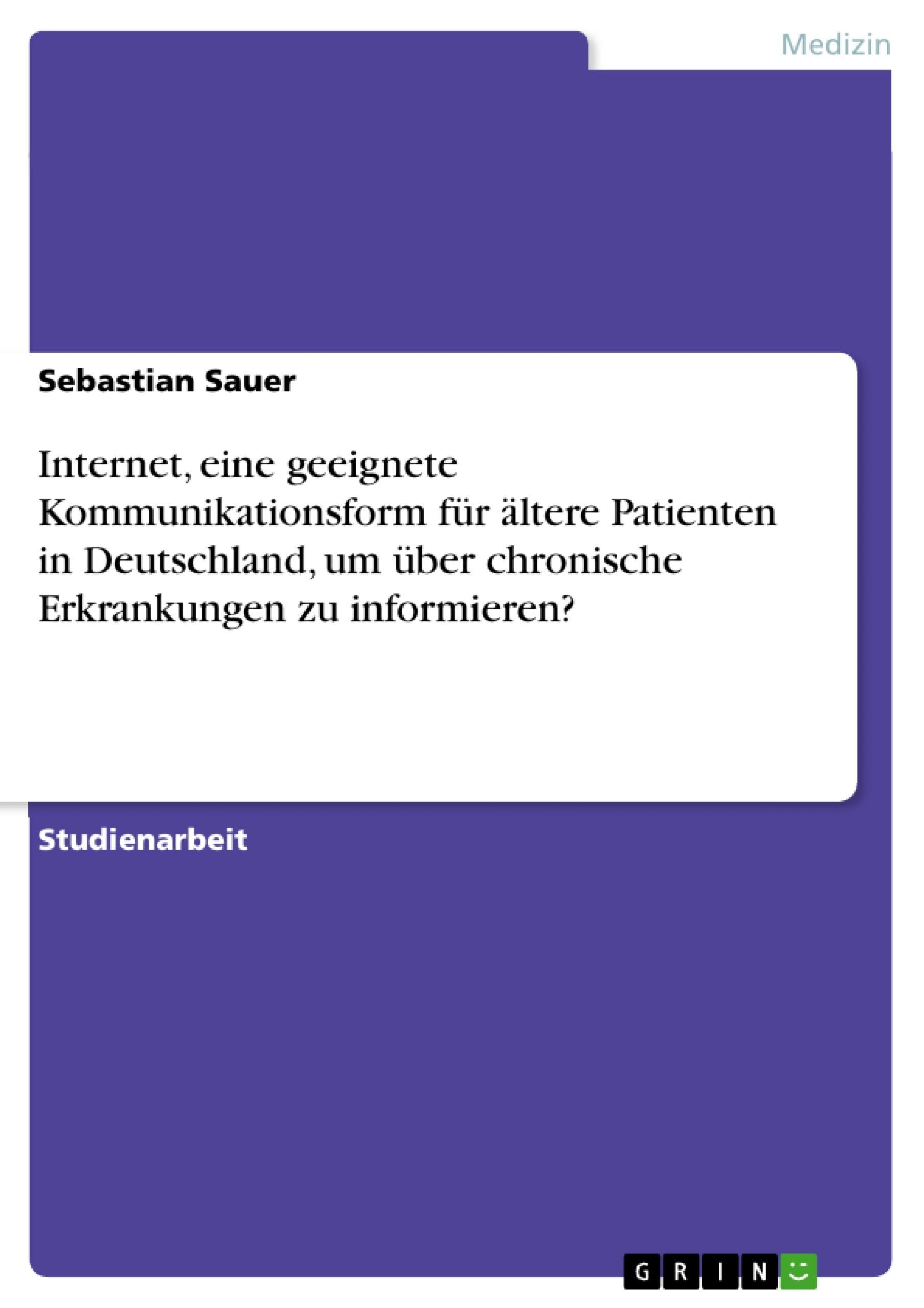In der wissenschaftlichen Literatur wird immer mehr davon gesprochen, dass Patienten gesundheitsbezogene Internetinformationen zur ärztlichen Konsultation mitbringen (vgl. Kaltenborn 2001). Inwieweit sich die Kommunikationsform Internet eignet, um speziell die ältere Patientengruppe über chronische Erkrankungen zu informieren, stellt in anbetracht der demographischen Entwicklung (vgl. Statistisches Bundesamt 2006) aus Public-Health-Perspektive eine wichtige Fragestellung für die zukünftige gesundheitliche Versorgungssituation in Deutschland dar.
Inwieweit die Grundvoraussetzungen zu einer gesundheitsbezogenen Internetnutzung innerhalb der Personengruppe 50+ in Deutschland vorliegen, soll anhand der Faktoren zur sozialen Ungleichheit und den bekannten statistischen Kennzahlen zur Internetnutzung exemplarisch für die nicht übertragbaren chronischen Erkrankungen Adipositas, Typ-2-Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs mittels des aktuellen wissenschaftlichen Forschungsstandes diskutiert werden.
Hierzu werden im zweiten Kapitel definitorische Grundlagenbegriffe, sowie theoretische Grundlagenmodelle zur Medien- und Internetnutzung im Krankheitsfall vorgestellt. Im Anschluss (Kapitel drei) werden epidemiologische Grunddaten und vulnerable Gruppen der sozialen Ungleichheit, der hier zu untersuchenden chronischen Erkrankungen aufgezeigt. Das viertel Kapitel stellt statistische Kennzahlen zur Internetnutzung und den aktuellen wissenschaftlichen Forschungsstand zur gesundheitsbezogenen Internetnutzung der Personengruppe 50+ dar. Mögliche Vor- und Nachteile von internetbasierten Gesundheitsinformationen werden zum Überblick im fünften Kapitel tabellarisch aufgelistet, um abschließend im sechsten Kapitel die hier vorgestellten Ergebnisse kritisch zu diskutieren und um einen potentiellen Forschungsbedarf, der einen Einfluss auf die gesundheitliche Versorgungssituation in Deutschland haben könnte, aufzuzeigen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definitorische Grundlagen
- 2.1. (Internet) Kommunikation und Information
- 2.2. Gesundheitskommunikation
- 2.3. Theoretische Modellannahmen zur Medien- und Internetnutzung im Krankheitsfall
- 3. Chronische Erkrankungen
- 3.1. Adipositas
- 3.2. Typ-2-Diabetes
- 3.3. Herz-Kreislauf-Krankheiten
- 3.4. Krebs
- 3.5. Zusammenfassung: Chronische Erkrankungen
- 4. Statistische Kennzahlen zur (gesundheitsbezogenen) Internetnutzung der Personengruppe 50+
- 4.1. On-, Offliner und Nutzungsplaner der Personengruppe 50+
- 4.2. Vulnerable Gruppen von On- und Offliner der Personengruppe 50+
- 4.3. Wissenschaftlicher Forschungsstand zur gesundheitsbezogenen Internetnutzung
- 5. Vor- und Nachteile von internetbasierten Gesundheitsinformationen
- 6. Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, ob das Internet eine geeignete Kommunikationsform für ältere Patienten in Deutschland ist, um über chronische Erkrankungen zu informieren. Angesichts der demographischen Entwicklung in Deutschland rückt die Versorgung chronisch kranker Menschen in den Vordergrund und stellt neue Herausforderungen für das öffentliche Gesundheitswesen dar. Die Arbeit untersucht die Faktoren, die die Internetnutzung bei der Personengruppe 50+ beeinflussen, und analysiert, inwieweit das Internet als Informationsquelle über chronische Erkrankungen geeignet ist.
- Soziale Ungleichheit und Internetnutzung
- Statistische Kennzahlen zur Internetnutzung der Personengruppe 50+
- Chronische Erkrankungen und ihre Auswirkungen
- Vor- und Nachteile internetbasierter Gesundheitsinformationen
- Potentieller Forschungsbedarf im Bereich der Gesundheitsversorgung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Relevanz des Themas in Bezug auf die demographische Entwicklung und die steigende Bedeutung der gesundheitsbezogenen Internetnutzung beleuchtet. Das zweite Kapitel führt grundlegende Begriffe und theoretische Modelle zur Medien- und Internetnutzung im Krankheitsfall ein. Im dritten Kapitel werden epidemiologische Grunddaten und vulnerable Gruppen der sozialen Ungleichheit in Bezug auf die betrachteten chronischen Erkrankungen dargestellt. Das vierte Kapitel präsentiert statistische Kennzahlen zur Internetnutzung der Personengruppe 50+ und den aktuellen wissenschaftlichen Forschungsstand zur gesundheitsbezogenen Internetnutzung. Das fünfte Kapitel fasst die Vor- und Nachteile von internetbasierten Gesundheitsinformationen zusammen, während das sechste Kapitel die Ergebnisse kritisch diskutiert und einen potentiellen Forschungsbedarf aufzeigt.
Schlüsselwörter
Internet, ältere Patienten, chronische Erkrankungen, Gesundheitskommunikation, soziale Ungleichheit, Internetnutzung, Gesundheitsversorgung, Public Health, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Eignet sich das Internet zur Information älterer Patienten?
Ja, aber es gibt Barrieren. Während immer mehr Menschen über 50 das Internet nutzen, verhindern soziale Ungleichheit und mangelnde Medienkompetenz bei einigen Gruppen den Zugang zu Gesundheitsinformationen.
Welche chronischen Krankheiten sind für die Gruppe 50+ besonders relevant?
Zentral sind Adipositas, Typ-2-Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebserkrankungen, da deren Häufigkeit mit dem Alter zunimmt.
Was sind die Vorteile von Gesundheitsinformationen aus dem Internet?
Vorteile sind die ständige Verfügbarkeit, die Anonymität bei sensiblen Themen und die Möglichkeit, sich vor oder nach dem Arztbesuch vertiefend zu informieren.
Was ist die "soziale Ungleichheit" bei der Internetnutzung?
Menschen mit geringerem Einkommen oder niedrigerer Bildung haben seltener Zugang zum Internet (Digital Divide), was ihre Chancen auf eine gute gesundheitliche Information verschlechtert.
Wie beeinflussen Internetinformationen das Arzt-Patient-Verhältnis?
Patienten bringen immer häufiger Informationen aus dem Netz mit in die Praxis. Dies kann die Konsultation bereichern, erfordert aber von Ärzten eine neue Rolle als "Informationsvermittler".
- Quote paper
- Sebastian Sauer (Author), 2009, Internet, eine geeignete Kommunikationsform für ältere Patienten in Deutschland, um über chronische Erkrankungen zu informieren?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/162320