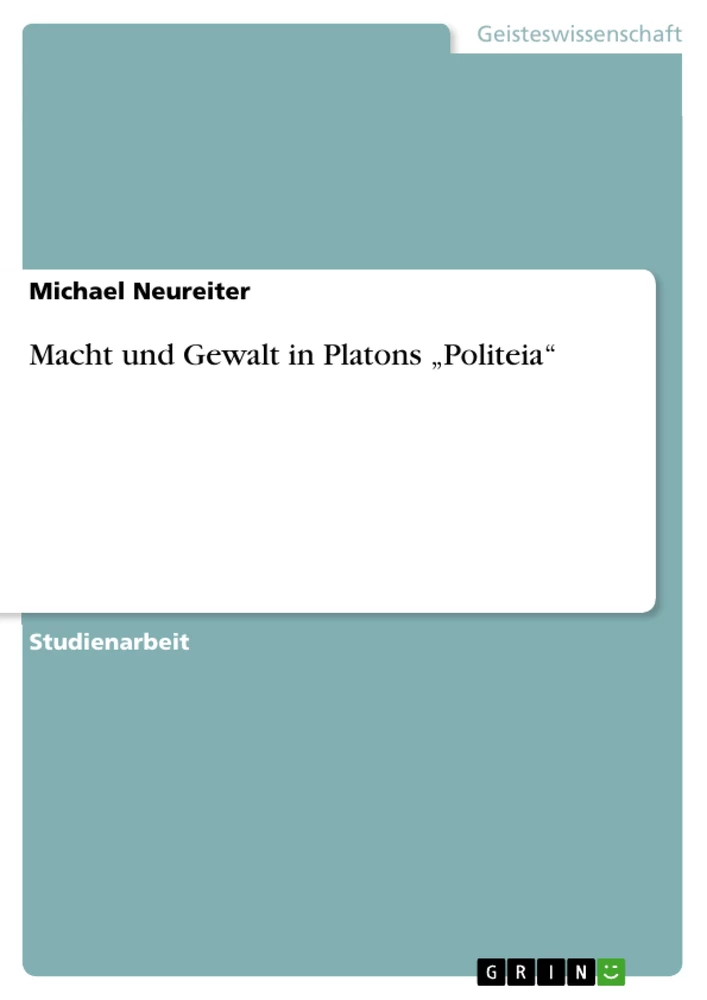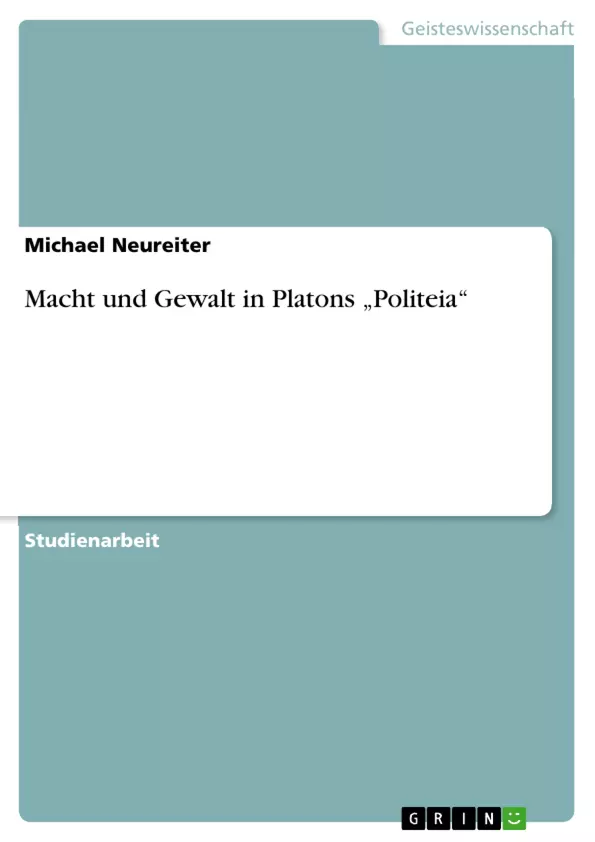Im Laufe der folgenden Ausführungen soll exemplarisch das Hauptwerk eines großen klassischen Denkers betrachtet werden, um zu prüfen, ob es brauchbare Antworten auf die in der Ethik häufig diskutierten Fragen nach der Beschaffenheit akzeptabler Machtverhältnisse (im Staat) sowie nach dem legitimen Einsatz von Gewalt bietet. Die Wahl fiel hierbei auf die Politeia, welche das Hauptwerk des antiken griechischen Philosophen Platon (ca. 427-347 v. Chr.) darstellt. Um dem/der geneigten Leser/-in einen prägnanten Überblick über die Macht- und Gewaltelemente in Platons Politeia zu gewähren (was ja schließlich das Ziel dieser Arbeit ist), sollen zunächst die Begriffe der Macht und der Gewalt selbst näher erläutert werden. Auch der zweite Punkt dient der Präsentation grundlegender Informationen; in ihm werden die zentralen Aussagen und Inhalte der Politeia zusammenfassend dargestellt. Die Punkte drei und vier bilden schließlich den Kern dieser Arbeit; sie sollen Platons Ansichten zu Fragen der Macht und der Gewalt wiedergeben, bevor dann in einem abschließenden Fazit die wichtigsten Erkenntnisse dieser Arbeit noch einmal komprimiert dargestellt werden. Zudem enthält das Fazit eine persönliche Bewertung der in den Punkten drei und vier dargestellten Ansichten sowie die Untersuchung der Frage, ob diese für die heutige Zeit Gültigkeit beanspruchen können bzw. als Lösungsansatz für gegenwärtige Probleme im Zusammenhang mit Macht und Gewalt in Frage kommen.
Inhaltsverzeichnis
- A: Einleitung
- B: Macht und Gewalt in Platons Politeia
- 1. Begriffsbestimmungen
- 1.1 Macht
- 1.2 Gewalt
- 2. Platons Politeia: Aussagen und Inhalte
- 3. Macht in der Politeia
- 4. Gewalt in der Politeia
- 1. Begriffsbestimmungen
- C: Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit setzt sich zum Ziel, die Ansichten Platons zur Macht und Gewalt in seinem Hauptwerk, der Politeia, zu untersuchen und zu analysieren. Dabei soll geklärt werden, ob Platons Gedanken zur Beschaffenheit akzeptabler Machtverhältnisse im Staat und zum legitimen Einsatz von Gewalt auch heute noch relevant und anwendbar sind.
- Begriffsbestimmungen von Macht und Gewalt
- Zentrale Aussagen und Inhalte der Politeia
- Platons Verständnis von Macht im Kontext der Politeia
- Platons Vorstellung von Gewalt und deren Anwendung in der Politeia
- Relevanz und Gültigkeit von Platons Gedanken für die heutige Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
A: Einleitung
Der Text beleuchtet die Bedeutung klassischer Werke wie Platons Politeia für das Verständnis von Fragen des menschlichen Zusammenlebens, insbesondere in Bezug auf Macht und Gewalt. Es wird die Relevanz antiker Schriften für heutige Probleme des politischen und philosophischen Diskurses hervorgehoben. Die Arbeit soll anhand der Politeia Platons untersuchen, ob diese brauchbare Antworten auf Fragen nach akzeptablen Machtverhältnissen im Staat und dem legitimen Einsatz von Gewalt bietet.
B: Macht und Gewalt in Platons Politeia
1. Begriffsbestimmungen
1.1 Macht
Der Text beleuchtet die Vielschichtigkeit des Machtbegriffs und unterschiedliche Interpretationen in Alltags- und wissenschaftlichem Sprachgebrauch. Besondere Aufmerksamkeit wird der Definition von Max Weber gewidmet, die Macht als die Chance definiert, den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen. Es werden zentrale Aspekte der Macht wie ihre Relationale Natur, ihre Ubiquität, ihre asymmetrische Beziehung, ihr konflikthaftes Element sowie ihre Institutionalisierung zu Herrschaft erörtert.
1.2 Gewalt
Die Arbeit widmet sich der Komplexität des Gewaltbegriffs und der anhaltenden wissenschaftlichen Debatte über seine Definition und Bewertung. Der Text geht über das alltägliche Verständnis von Gewalt hinaus und bezieht Formen wie physische, psychische, institutionelle, kulturelle, symbolische und strukturelle Gewalt ein. Es wird der von Johan Galtung geprägte Terminus der strukturellen Gewalt erläutert, der die Auswirkungen gesellschaftlicher Strukturen auf die Lebensmöglichkeiten von Menschen in den Fokus rückt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe der Arbeit sind Macht, Gewalt, Politeia, Platon, Herrschaft, Gerechtigkeit, staatliche Ordnung, akzeptable Machtverhältnisse, legitimer Einsatz von Gewalt, antike Philosophie, politischer Diskurs.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Untersuchung von Platons „Politeia“?
Die Arbeit prüft, ob Platons Hauptwerk brauchbare Antworten auf Fragen nach akzeptablen Machtverhältnissen im Staat und dem legitimen Einsatz von Gewalt bietet.
Wie definiert die Arbeit den Begriff „Macht“?
Es wird insbesondere auf die Definition von Max Weber Bezug genommen: Macht als Chance, den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen.
Was versteht man unter „struktureller Gewalt“ nach Johan Galtung?
Strukturelle Gewalt bezeichnet Auswirkungen gesellschaftlicher Strukturen, die die Lebensmöglichkeiten von Menschen einschränken, ohne dass ein direkter physischer Täter erkennbar ist.
Sind Platons Ansichten heute noch aktuell?
Das Fazit der Arbeit bewertet, ob Platons antike Lösungsansätze als Modell für gegenwärtige Probleme im Zusammenhang mit staatlicher Ordnung und Gewalt dienen können.
Welche Rolle spielt die Gerechtigkeit in der Politeia?
Gerechtigkeit ist das zentrale Thema der Politeia und bildet das Fundament für Platons Entwurf einer idealen staatlichen Ordnung.
- Quote paper
- Michael Neureiter (Author), 2010, Macht und Gewalt in Platons „Politeia“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/162378