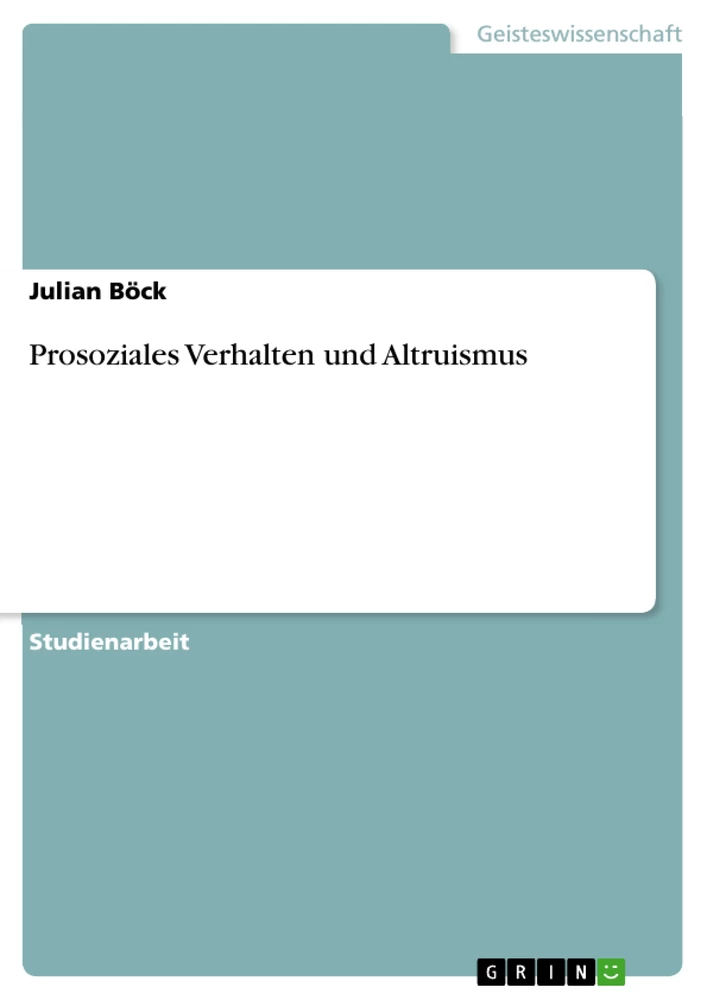Thema dieser Arbeit ist zum einen die Entwicklung prosozialen Verhaltens im Lebenslauf und zum anderen der Altruismus. Dies ist ein Teilgebiet der sozial-emotionalen Entwicklung in der Entwicklungspsychologie.
Im ersten Teil wird es um die Entwicklung des prosozialen Verhaltens vom Säuglingsalter bis zum Erwachsenenalter gehen. Säuglinge imitieren noch die Gefühle anderer Menschen dh sie weinen wenn sie eine andere Person weinen hören, ohne einen Grund dazu zu haben. Wenn sie ca. zwei Jahre alt sind, haben sie bereits gelernt die Gefühle anderer Menschen nachzufühlen, ohne sie zu imitieren. Ab diesem Alter können auch erste Hilfeleistungen der zweijährigen Kinder beobachtet werden. Diese werden durch den Erwerb der Sprache differenzierter und auch die Lebensgeschichte der Hilfebedürftigen Person wird in die Hilfeleistung miteinbezogen. Im Schul- und Jugendalter wird den situativen Bedingungen vermehrt Aufmerksamkeit geschenkt dh inwieweit die hilfsbedürftige Person zu ihrer Notsituation beigetragen hat. Außerdem können Hinweisreize auf Notsituationen mit fortschreitendem Alter besser erkannt und entschlüsselt werden, was zum Teil auch auf die besseren kognitiven Fähigkeiten zurückzuführen ist. Im Zuge dessen nimmt auch die Komplexität der prosozialen Handlungen zu. Jedoch kann prosoziales Verhalten auch gezielt gefördert werden z.B. durch einen verständnisvollen und unterstützenden Erziehungsstil, aber auch durch die Vermittlung von moralischen Grundsätzen und Werten und durch pädagogische Intervention.
Der zweite Teil der Arbeit wird sich mit dem Thema Altruismus beschäftigen, der als die stärkste Ausprägung prosozialen Verhalten gilt.
Doch was genau bedeutet eigentlich Altruismus? Stellen Sie sich vor, Sie laufen als Tourist über eine Brücke in einer fremden Stadt und sehen, dass unten im Wasser ein Kind zu ertrinken droht. Kurzer Hand entschließen Sie sich in das Wasser zu springen und das Kind zu retten, auch wenn Sie sich dadurch selbst in Gefahr bringen. Dies machen Sie freiwillig und ohne das Kind zu kennen, oder irgendeinen Nutzen daraus zu ziehen, dh beispielsweise dafür bezahlt zu werden. Genau dieses Verhalten nennt man altruistisch. Doch wie oft tritt dieses Verhalten beim Menschen auf? Und was beeinflusst das prosoziale Verhalten? Diese und weitere Fragen werden im zweiten Teil der Arbeit beantwortet.
-
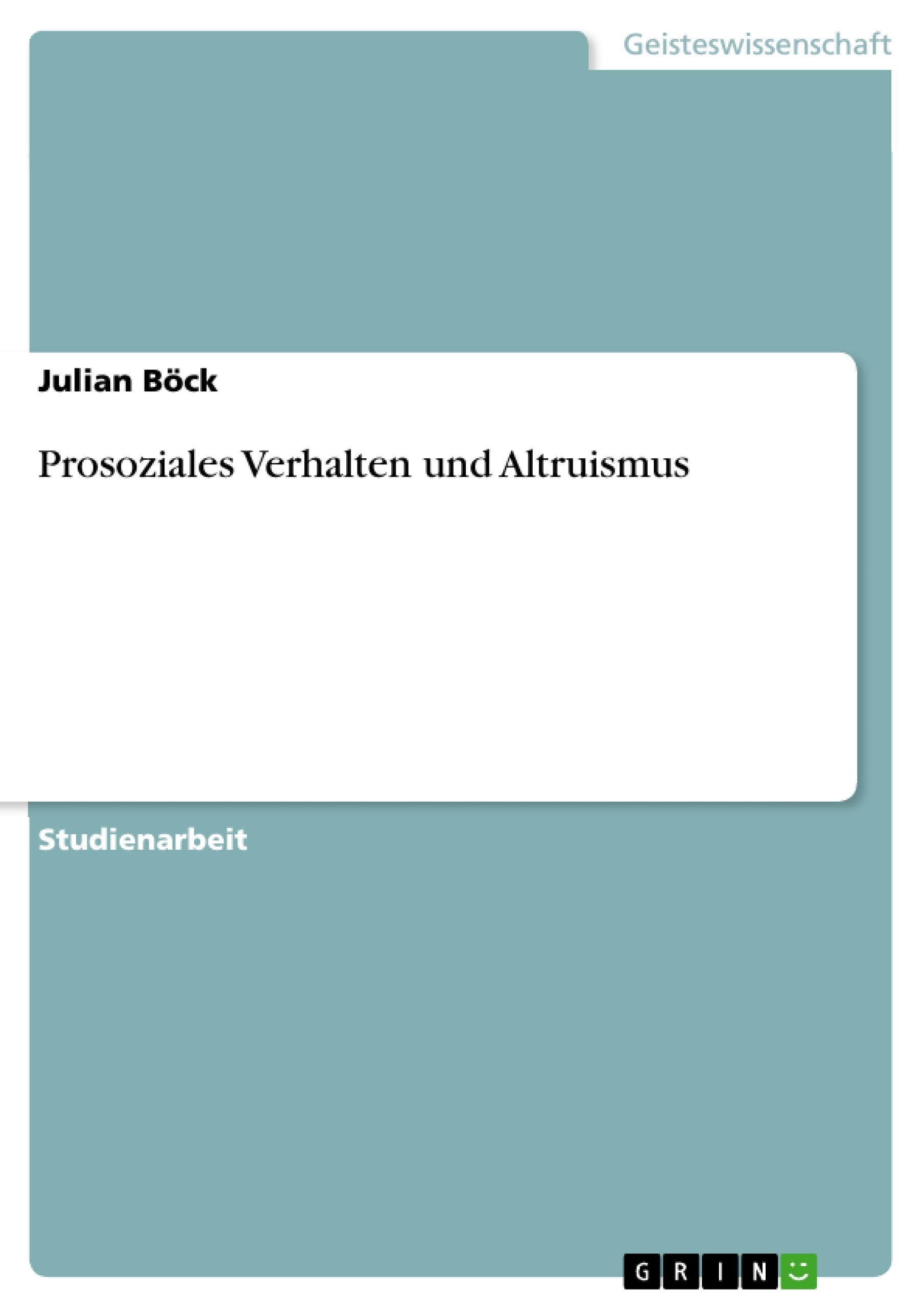
-

-

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen.