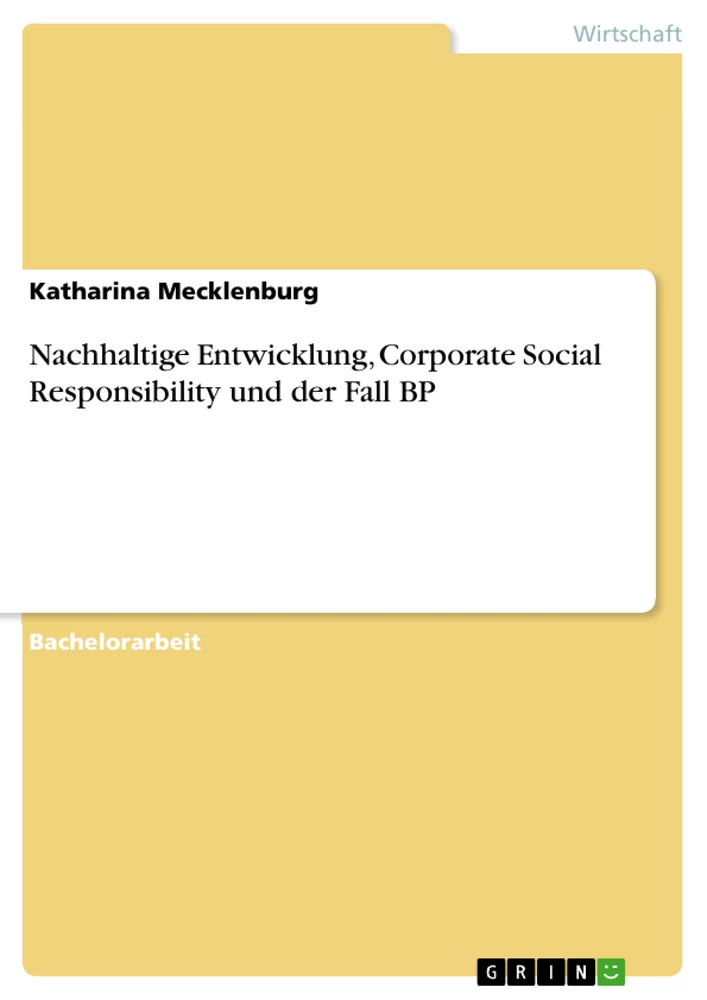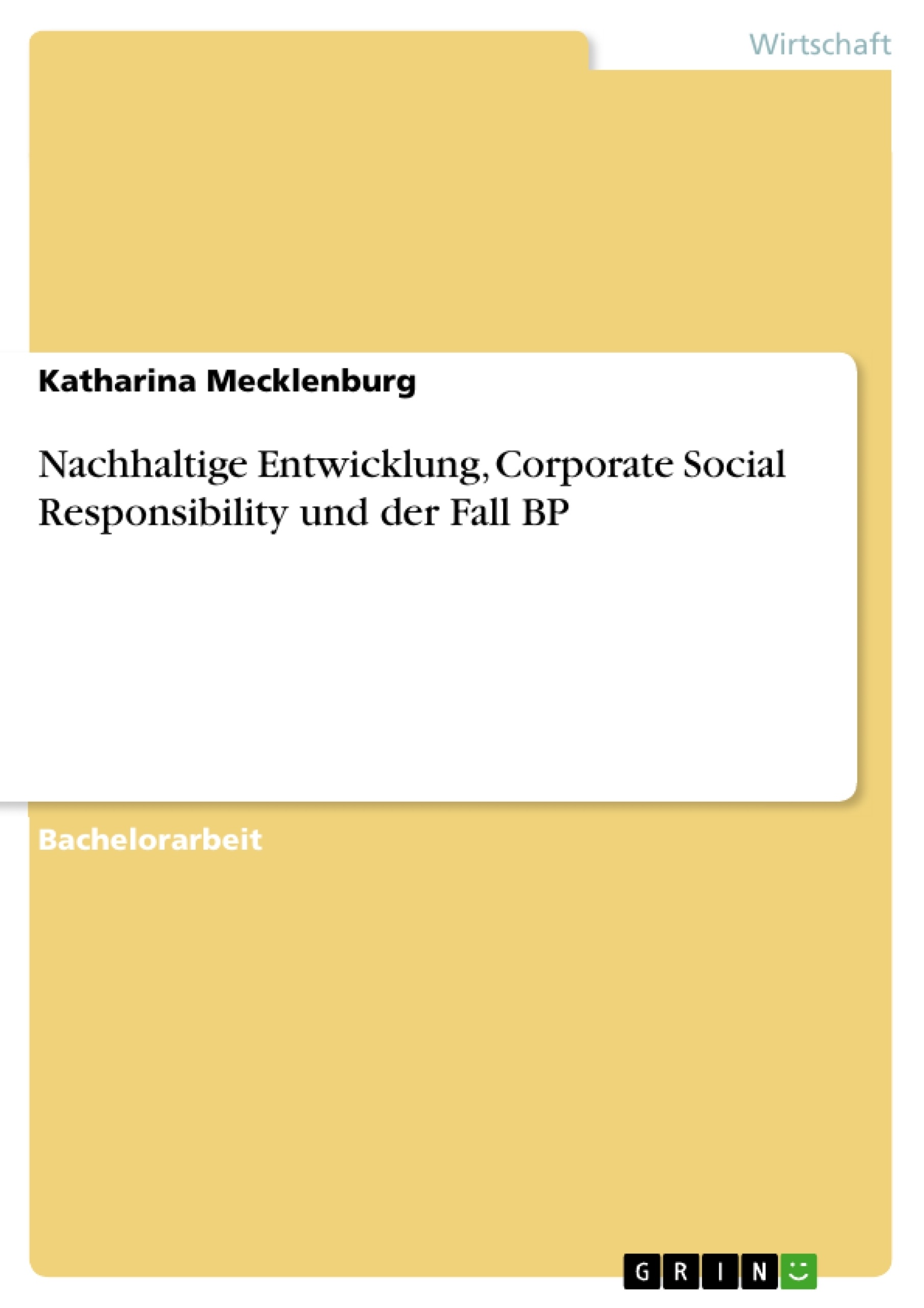In den letzten Jahren wurde der Ruf nach Nachhaltigkeit und sozialem Engagement großer Konzerne immer lauter. Vor allem seit der Klimawandel eine Umstrukturierung der Produktionen fordert und die Kluft zwischen arm und reich auf der Welt immer größer wird, fordern Regierungen und Gesellschaften ein Umdenken der Unternehmen. Oft gerät dieses Engagement in Verruf lediglich zu einem guten Image und somit zu höheren Absatzzahlen verhelfen zu sollen. Vergessen wird hier aber, dass dieses Engagement auf lange Sicht zu Vorteilen für alle Gesellschaften der Erde und die Umwelt führen kann, wenn es richtig umgesetzt wird.
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema der nachhaltigen Entwicklung als Basis für das Prinzip Corporate Social Responsi-bility (CSR), das anhand des Ölkonzerns BP verdeutlicht werden soll.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Nachhaltige Entwicklung
- 2.1. Ursprung und Geschichte
- 2.1.1. Die Umweltkonferenz der Vereinten Nationen
- 2.1.2. Der Brundtland-Bericht
- 2.1.3. Der Rio-Folgeprozess
- 2.2. Definition von nachhaltiger Entwicklung
- 2.3. Die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit
- 2.3.1. Ökonomische Nachhaltigkeit
- 2.3.2. Ökologische Nachhaltigkeit
- 2.3.3. Soziale Nachhaltigkeit
- 2.4. Starke und schwache Nachhaltigkeit
- 2.5. Indikatoren und Zielwerte für Nachhaltige Entwicklung in großen Unternehmen
- 2.6. Nachhaltigkeit als Basis für CSR
- 3. Corporate Social Responsibility
- 3.1. Historische Ursprünge
- 3.2. Definition von Corporate Social Responsibility
- 3.2.1. Corporate Citizenship
- 3.3. Die Beziehung von CSR und CC zu nachhaltiger Entwicklung
- 3.4. Das Stakeholder-Modell
- 3.5. Standards und Richtlinien
- 3.5.1. OECD -Richtlinien für multinationale Unternehmen
- 3.5.2. UN-Global Compact
- 3.5.3. Global Reporting Initiative
- 3.5.4. ISO-Standards
- 4. BP plc - Beyond Petroleum?
- 4.1. Geschichte des Unternehmens
- 4.2. Unternehmenswerte und Strategie
- 4.3. Nachhaltigkeitsberichterstattung bei BP
- 4.3.1. Sicherheit
- 4.3.2. Umwelt
- 4.3.3. Mitarbeiter
- 4.4. Besondere Umstände am Golf von Mexiko
- 4.5. Corporate Social Responsibility bei BP
- 4.5.1. Förderung der Gleichberechtigung: „India: Educate a girl, educate a family“
- 4.5.2. Finanzielle Unterstützung: “Supporting communities with micro-credits”
- 4.5.3. Bildung
- 4.5.4. Umwelt: \"Reusing waste in Brazil“
- 4.5.5. Menschenrechte
- 5. Genaue Betrachtung der subjektiven Auskünfte von BP
- 5.1. Einfluss der Stakeholder
- 6. Bewertung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelor-Thesis analysiert die Nachhaltigkeitsstrategie des Ölkonzerns BP im Kontext von Corporate Social Responsibility (CSR). Ziel ist es, die Bemühungen von BP in Bezug auf nachhaltige Entwicklung und CSR zu untersuchen, insbesondere im Hinblick auf die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit: Ökologie, Ökonomie und Soziales. Dabei wird auch auf die Rolle von Stakeholdern und die Bedeutung von Transparenz und Berichterstattung eingegangen.
- Nachhaltige Entwicklung: Geschichte, Definition, Dimensionen
- Corporate Social Responsibility: Definition, Standards und Richtlinien
- BP plc: Geschichte, Unternehmenswerte und Strategie
- Nachhaltigkeitsberichterstattung bei BP: Schwerpunkte und Kritikpunkte
- Die Rolle von Stakeholdern bei der Bewertung von CSR-Aktivitäten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit und die Forschungsfrage vor. Kapitel 2 beleuchtet den Ursprung und die Entwicklung des Konzepts der nachhaltigen Entwicklung sowie seine drei Dimensionen: Ökologie, Ökonomie und Soziales. Kapitel 3 definiert Corporate Social Responsibility (CSR) und beleuchtet die Beziehung von CSR zu nachhaltiger Entwicklung. Dabei werden Standards und Richtlinien für CSR-Berichterstattung vorgestellt. Kapitel 4 konzentriert sich auf den Ölkonzern BP und untersucht dessen Geschichte, Unternehmenswerte und Strategien im Hinblick auf Nachhaltigkeit. Es werden die Nachhaltigkeitsberichterstattung von BP analysiert und kritisch betrachtet. Kapitel 5 untersucht die subjektiven Auskünfte von BP und deren Einfluss auf Stakeholder. Kapitel 6 bewertet die Nachhaltigkeit der BP-Strategie im Kontext der CSR.
Schlüsselwörter
Nachhaltige Entwicklung, Corporate Social Responsibility, CSR, BP plc, Stakeholder, Nachhaltigkeitsberichterstattung, Transparenz, Ökologie, Ökonomie, Soziales, Standards, Richtlinien, OECD, UN-Global Compact, Global Reporting Initiative, Ölindustrie, Umweltmanagement, Social Impact
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen CSR und nachhaltiger Entwicklung?
Nachhaltige Entwicklung ist das übergeordnete Zielkonzept, während CSR (Corporate Social Responsibility) die spezifische Umsetzung dieser Prinzipien im Handeln von Unternehmen beschreibt.
Welche drei Dimensionen der Nachhaltigkeit gibt es?
Die drei Dimensionen sind Ökonomie, Ökologie und Soziales.
Warum wird der Fall BP kritisch betrachtet?
Trotz des Slogans „Beyond Petroleum“ geriet BP besonders durch die Katastrophe am Golf von Mexiko in die Kritik bezüglich der Glaubwürdigkeit ihres Engagements.
Welche Rolle spielen Stakeholder für BP?
Stakeholder (wie Umweltgruppen oder Anleger) beeinflussen die Bewertung der CSR-Aktivitäten und fordern Transparenz in der Berichterstattung.
Was ist der Brundtland-Bericht?
Ein historisches Dokument, das die heute gängige Definition nachhaltiger Entwicklung maßgeblich prägte.
- Quote paper
- Katharina Mecklenburg (Author), 2010, Nachhaltige Entwicklung, Corporate Social Responsibility und der Fall BP, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/162664