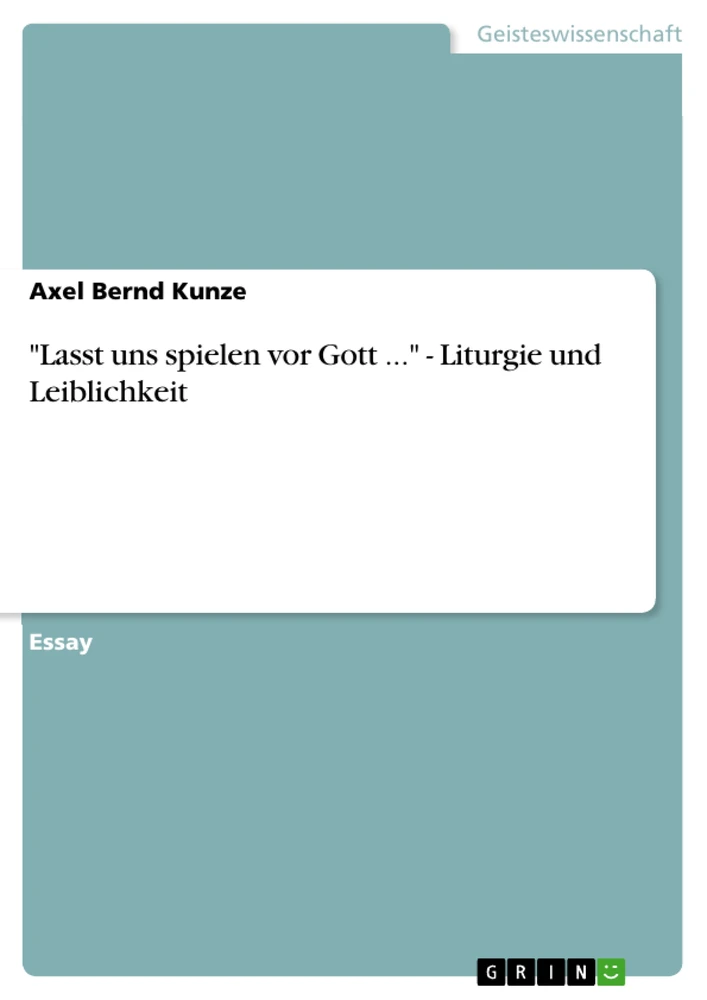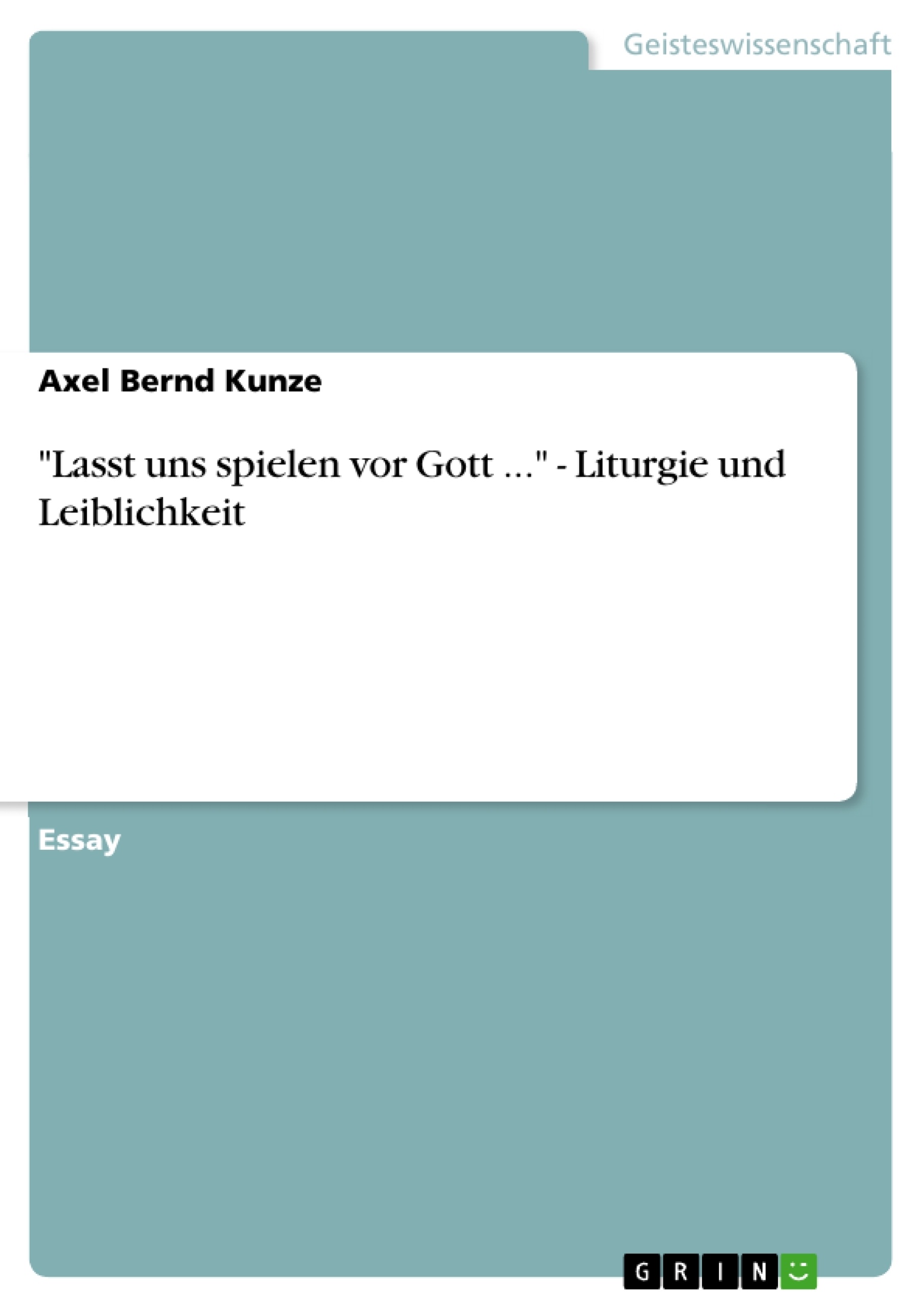Der Beitrag versucht aus zwei Richtungen zu skizzieren, warum christliche Liturgie notwendigerweise leibbezogen ist. Der erste Zugang begreift Liturgie als kommunikative Zeichenhandlung im dialogischen Heilsgeschehen zwischen Gott und Mensch, der zweite Zugang betont den Charakter der Liturgie als "heiliges Spiel vor Gott".
Inhaltsverzeichnis
- Ein Wort zuvor
- 1 Liturgie als kommunikative Zeichenhandlung
- Der Mensch ist wesenhaft durch seine Leiblichkeit geprägt
- Gottes Heilshandeln spricht den Menschen in seiner Leiblichkeit an
- Liturgie ist an sinnlich erfahrbare Zeichen gebunden
- 2 Liturgie als Spiel menschlicher Freiheit
- Leiblichkeit ist Ort der Gottesbegegnung
- Spiel, Feier und Tanz sind Ausdruck der menschlichen Freiheit
- Im Spielen feiert der Mensch die ihm geschenkte Liebe
- 3 Plädoyer für eine leibhaftige Liturgie mit allen Sinnen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Beitrag beleuchtet die enge Verbindung zwischen christlicher Liturgie und menschlicher Leiblichkeit. Er argumentiert, dass Liturgie als kommunikative Zeichenhandlung im Heilsgeschehen zwischen Gott und Mensch verstanden werden muss, und gleichzeitig als Spiel und Feier der menschlichen Freiheit. Ziel ist es, die Bedeutung einer leibhaftigen Liturgie zu verdeutlichen, die alle Sinne des Menschen anspricht und ihm ermöglicht, auf Gottes Heilszusage in einer ganzmenschlichen Weise zu antworten.
- Liturgie als kommunikative Zeichenhandlung
- Leiblichkeit als Ort der Gottesbegegnung
- Spiel, Feier und Tanz als Ausdruck der menschlichen Freiheit
- Die Bedeutung einer ganzheitlichen Liturgie für die menschliche Erfahrung
- Die Verbindung von Liturgie und der christlichen Tradition
Zusammenfassung der Kapitel
Ein Wort zuvor
Dieser Beitrag stellt die beiden zentralen Zugänge zum Thema der leibbezogenen Liturgie vor: Liturgie als kommunikative Zeichenhandlung und Liturgie als Spiel und Feier.
1 Liturgie als kommunikative Zeichenhandlung
Dieses Kapitel befasst sich mit der Leiblichkeit des Menschen als Grundlage für die Kommunikation und die Gotteserfahrung. Es wird betont, dass Gottes Heilshandeln leibhaftig vermittelt wird und die Liturgie als Ausdruck dieser Kommunikation verstanden werden kann.
2 Liturgie als Spiel menschlicher Freiheit
Der zweite Teil des Beitrags betont die spielerische Natur der Liturgie. Die Leiblichkeit des Menschen wird als Ort der Gottesbegegnung beschrieben, und es wird erläutert, wie Spiel, Feier und Tanz Ausdruck der menschlichen Freiheit darstellen. Die Liturgie wird als ein „heiliges Spiel vor Gott“ präsentiert, in dem der Mensch die Liebe Gottes feiert.
3 Plädoyer für eine leibhaftige Liturgie mit allen Sinnen
Im dritten Kapitel wird ein Plädoyer für eine Liturgie gehalten, die alle Sinne des Menschen anspricht und ihm ermöglicht, in seiner Ganzheit Gott zu begegnen. Die Liturgie soll nicht nur intellektuell, sondern auch emotional, körperlich und spirituell erfahrbar sein.
Schlüsselwörter
Liturgie, Leiblichkeit, Zeichenhandlung, Spiel, Feier, Tanz, Gottesbegegnung, menschliche Freiheit, ganzheitliche Liturgie, Tradition, Kommunikation, Heilsgeschichte, Heilshandeln, Gemeinde, Sinneserfahrung.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist christliche Liturgie notwendigerweise leibbezogen?
Weil der Mensch wesenhaft durch seine Leiblichkeit geprägt ist und Gottes Heilshandeln den Menschen in seiner Ganzheit anspricht.
Was bedeutet „Liturgie als heiliges Spiel“?
Dieser Zugang betont den Charakter der Liturgie als zweckfreies Feiern der göttlichen Liebe und als Ausdruck menschlicher Freiheit vor Gott.
Welche Rolle spielen Tanz und Feier in der Liturgie?
Sie sind leibhaftige Ausdrucksformen der menschlichen Freiheit und ermöglichen eine emotionale und körperliche Antwort auf Gottes Heilszusage.
Was ist das Ziel einer „ganzheitlichen Liturgie“?
Ziel ist es, Gott mit allen Sinnen zu begegnen, sodass die Liturgie nicht nur intellektuell, sondern auch spirituell und körperlich erfahrbar wird.
Wie wird Leiblichkeit als Ort der Gottesbegegnung definiert?
Die Leiblichkeit ist das Medium, durch das Kommunikation und Erfahrung überhaupt erst möglich werden, und somit der primäre Ort, an dem Gott dem Menschen begegnet.
- Citation du texte
- Axel Bernd Kunze (Auteur), 2010, "Lasst uns spielen vor Gott ..." - Liturgie und Leiblichkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/162853