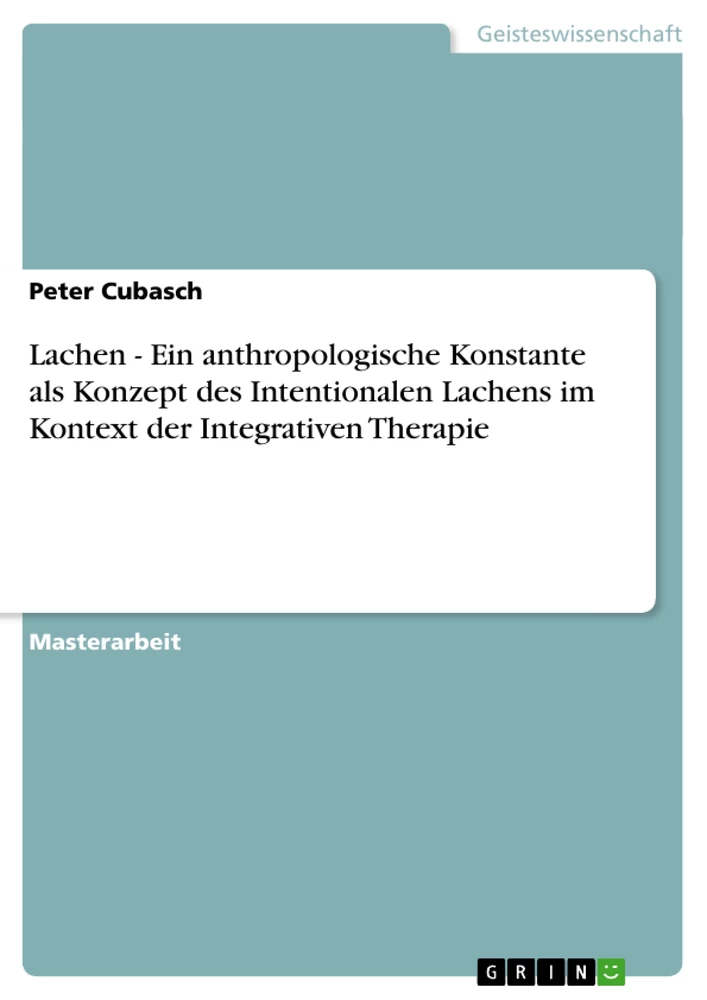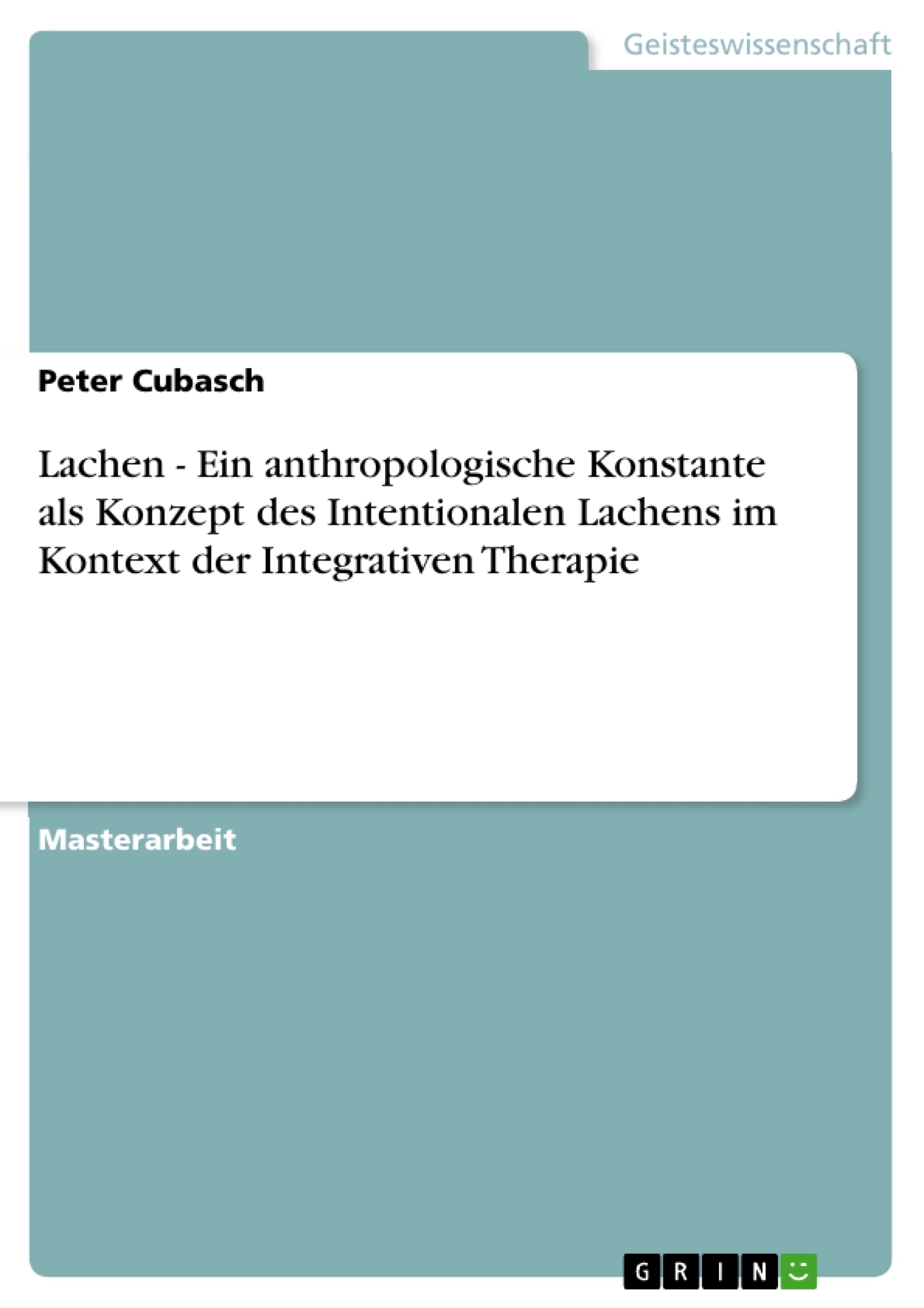Lachen ist im Zusammenhang mit Gesundheitsförderung ein vielbeachtetes Thema, das durch die Ergebnisse der Gelotologie, einer medizinisch orientierten Lachforschung, wissenschaftlichen Rückhalt bekommt. Die Frage, ob und wie Lachen auch im Rahmen von Psychotherapie sinnvoll zur Anwendung kommen kann, macht es erforderlich, Lachen komplex zu erfassen und genau zu beschreiben. Es wird erforderlich, spontanes und absichtliches Lachen zu differenzieren und von angrenzenden Themen wie Humor, Clownerie, dem Lächerlichen und Witz abzugrenzen. Die Sichtung der philosophischen Literatur und der vorliegenden Lach- und Humortheorien zeigt, dass dem Thema Lachen explizit bisher wenig Beachtung zuteil wurde. Erst das Aufkommen einer neuen, durch Lachyoga ausgelösten Lachbewegung hat erweitere Perspektiven auf das Lachen ermöglicht und der Lachpraxis starke Impulse gegeben. Lachpraxis im Rahmen von Psychotherapie bedarf gründlicher anthropologischer und entwicklungstheoretischer Begründungen und therapeutischer Verfahren, die theoretisch begründete Modelle zur Adaption und Integration kompatibler Methoden und Techniken bereitstellen. Das Konzept des Intentionalen Lachens nimmt die Methode des Lachyogas von Madan Kataria auf, erweitert sie durch angrenzende Themen wie Lächeln, Lachen und Blickkontakt und verbindet sie mit den theoretischen Konzepten der Integrativen Therapie. Exemplarische Modelle zeigen Anwendungs-möglichkeiten des Lachens im Rahmen therapeutischer Arbeit.
Abstract
Laughing is a much noticed topic in the promotion of health that is backed up scientifically by results in gelotology, the medically orientated research into laughing. The question as to whether and how laughing can also be used meaningfully in psychotherapy demands that laughing is comprehended in its complexity and described precisely.
It will be essential to differentiate between spontaneous and deliberate laughing and to delineate it from neighbouring themes such as humour, clowning, the laughable and jokes.
Inspecting philosophical literature and the current theories of laughter and humour shows that until now the theme of laughing has explicitly been granted little recognition.
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung
- Abstract
- Vorwort
- Einleitung
- Annäherung an das Lachen
- Etymologie
- Redewendungen und sprachlich-literarische Zugänge zum Lachen
- Über die Schwierigkeiten bei der Erforschung eines unwissenschaftlichen Phänomens
- An-, Ab- und Begrenzungen
- Lachen und Weinen
- Lächeln und Lachen
- Lachen, Heiterkeit und Fröhlichkeit
- Lachen und das Lächerliche
- Lachen, Witz und Humor
- Lachen und Glück
- Echtes, künstliches und natürliches Lachen
- Funktionalisiertes und instrumentalisiertes Lachen
- Definitionen, Erscheinungsbilder und Funktionen des Lachens
- Definitionen des Lachens
- Lachen als akustisches und phonetisches Phänomen
- Mimik und Blickverhalten beim Lächeln und Lachen
- Körperbewegungen beim Lächeln und Lachen
- Variationen und Qualitäten des Lächelns und Lachens
- Funktionen und Wirkungen des Lachens
- Evolution des Lächelns und Lachens
- Lächeln und Lachen aus phylogenetischer Sicht
- Lächeln als Submissionsgeste – “Silent Bared Teeth Display”
- Lachen als Ausdruck einer Spielintention – “Relaxed Open Mouth Display”
- Lächeln und Lachen aus ontogenetischer Sicht
- Die Entwicklung des Lächelns beim Säugling
- Die Entwicklung des ersten Lachens
- Paläoanthropologische Überlegungen zum Lächeln und Lachen
- Lächeln und Lachen aus phylogenetischer Sicht
- Lachtheorien
- Überlegenheitstheorie
- Inkongruenztheorie
- Energetische Lachtheorien
- Traditionelle Lachtheorien und Intentionales Lachen
- Anthropologie des Lachens
- Zur Psychologie des Lachens und der Freude
- Zur Anthropologie des Lächelns und der Freundlichkeit
- Lächeln, Lachen und die Babyforschung – „Engelskreise positiver Gegenseitigkeit“
- Mimik, Spielgesicht und Spiellaune
- Lachen und Spielen
- Die dunklen Seiten des Lachens - Anthropologisch-ethische Überlegungen
- Das dunkle Lachen, der „böse“ Mensch und säkularer humanitärer Meliorismus
- Gelotologie – gesundheitsorientierte Lachforschung
- Physiologische Auswirkungen des Lachens (nach Fry)
- Lachen und Schmerz
- Lachen, Neurologie und Psychoneuroimmunologie
- Gegenwärtige Lachforschung
- Das Heiterkeits- und Lachnetzwerk
- Lachen in der Psychotherapie
- Moreno, „der Mann, der das Lachen in die Psychiatrie brachte“
- Freud, der Witz und der Humor
- Therapeutischer Humor, „HumorCare“ und das Lachen
- Provokative Therapie und Lachen
- Lachen als Beitrag zur Humantherapie
- Lachen in therapeutischen Prozessen
- Lächeln, Lachen und Freundlichkeit vor dem Hintergrund der Affiliationstheorie
- Lachyoga - Lachen und Yoga
- Entstehung des Hasya-Yoga
- Lachyoga - technisches Lachen?
- Zur Praxis des Lachyoga
- Anwendbarkeit von Lachyoga
- Intentionales Lachen
- Begriff und Bedeutung des Intentionalen Lachens
- Ziele des Intentionalen Lachens
- Integrative Therapie
- Integrative Humantherapie - Partnerschaftliches Handeln
- Die vier Wege der Heilung und Förderung
- Relationalität und Ko-respondenz
- Entwicklungstheoretische und persönlichkeitstheoretische Grundannahmen der IT
- Salutogenese- und Pathogense-Konzept der IT
- Theorie und Praxis des Intentionalen Lachens im Rahmen der Integrativen Therapie
- Beziehung von Lachyoga, IL und IT
- Metatheoretische Überlegungen – Integrationsparadigma und Kompatibilitätsprüfung als Voraussetzungen für die Anwendung des IL im Rahmen der IT
- Lachen in übungszentriert-funktionaler Modalität
- Atemanregung, Entspannung, Vitalisierung durch Lachen
- Balance finden durch Lachen und Atmen
- Intentionales Lachen und Lächeln in erlebnisorient-stimulierender Modalität
- Lächeln, Lachen und Mimik als psychophysische Selbsterfahrung
- Lächeln, Lachen und Schauen im mimischen Interplay
- Lächel-Meditation
- Die Kraft positiver Bilder
- Intentionales Lachen in aufdeckend-konfliktzentrierter Modalität
- Lach-Panorama
- Intentionales Lachen im Rahmen tragfähiger, sozialer Netzwerke
- Abschließende Bemerkungen und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Lachen als anthropologische Konstante und sein Potential im Kontext der Integrativen Therapie. Ziel ist es, das Konzept des Intentionalen Lachens zu beleuchten und seine Anwendbarkeit in der therapeutischen Praxis zu evaluieren.
- Anthropologische Aspekte des Lachens
- Physiologische und psychologische Wirkungen des Lachens
- Lachtheorien und ihre Relevanz für die Therapie
- Intentionales Lachen als therapeutisches Werkzeug
- Integration des Intentionalen Lachens in die Integrative Therapie
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Lachens ein und beschreibt den Forschungsansatz der Arbeit. Sie skizziert die Bedeutung des Lachens als anthropologische Konstante und kündigt die Untersuchung des Intentionalen Lachens im therapeutischen Kontext an. Der Fokus liegt auf der Erforschung des Potentials des Lachens als therapeutisches Instrument.
Annäherung an das Lachen: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Einführung in das Phänomen des Lachens, beginnend mit etymologischen und sprachlichen Aspekten. Es beleuchtet die Schwierigkeiten der wissenschaftlichen Erforschung des Lachens aufgrund seiner Komplexität und Vielschichtigkeit. Der Abschnitt differenziert zwischen verschiedenen Arten des Lachens (z.B. echtes vs. künstliches Lachen) und analysiert ihre Funktionen und Begrenzungen im Kontext von Weinen, Lächeln, Heiterkeit, Humor und Glück. Der Kapitelverlauf arbeitet systematisch verschiedene Aspekte des Lachens heraus, die für das Verständnis seines therapeutischen Potenzials relevant sind.
Definitionen, Erscheinungsbilder und Funktionen des Lachens: Dieses Kapitel liefert verschiedene Definitionen des Lachens aus unterschiedlichen Perspektiven. Es beschreibt das Lachen als akustisches und phonetisches Phänomen und analysiert die damit verbundene Mimik, Blickverhalten und Körperbewegungen. Es untersucht die Variationen und Qualitäten des Lachens und beleuchtet seine vielfältigen Funktionen und Wirkungen auf den menschlichen Organismus und die Psyche.
Evolution des Lächelns und Lachens: Dieses Kapitel beleuchtet die Evolution des Lächelns und Lachens aus phylogenetischer und ontogenetischer Perspektive. Es betrachtet das Lächeln als Submissionsgeste und das Lachen als Ausdruck einer Spielintention und analysiert die Entwicklung des Lächelns und Lachens beim Säugling. Paläoanthropologische Überlegungen liefern zusätzliche Erkenntnisse über die Entstehung und Entwicklung dieser Ausdrucksformen.
Lachtheorien: In diesem Kapitel werden verschiedene Lachtheorien vorgestellt und diskutiert, darunter die Überlegenheitstheorie, die Inkongruenztheorie und energetische Lachtheorien. Der Fokus liegt auf der Analyse traditioneller Lachtheorien und deren Verhältnis zum Intentionalen Lachen. Die verschiedenen Theorien werden kritisch gewürdigt und auf ihre Relevanz für die Arbeit überprüft.
Anthropologie des Lachens: Dieses Kapitel erforscht die anthropologischen Aspekte des Lachens, einschließlich der Psychologie des Lachens und der Freude, sowie der Anthropologie des Lächelns und der Freundlichkeit. Es integriert die Erkenntnisse der Babyforschung, untersucht Mimik und Spiellaune und beleuchtet die „dunklen Seiten“ des Lachens mit ethischen und anthropologischen Überlegungen. Der Kapitelverlauf zeichnet ein vielschichtiges Bild des Lachens als Ausdruck menschlicher Interaktion und Erfahrung.
Gelotologie – gesundheitsorientierte Lachforschung: Dieses Kapitel befasst sich mit der gelotologischen Forschung und ihren Erkenntnissen über die physiologischen Auswirkungen des Lachens, insbesondere im Hinblick auf Schmerz und die Psychoneuroimmunologie. Es analysiert den aktuellen Stand der Lachforschung und das Konzept des „Heiterkeits- und Lachnetzwerks“. Der Fokus liegt auf der Darstellung der gesundheitlichen Vorteile und der therapeutischen Relevanz des Lachens.
Lachen in der Psychotherapie: Dieses Kapitel betrachtet die Rolle des Lachens in der Psychotherapie, beginnend mit den Beiträgen von Moreno und Freud. Es diskutiert therapeutischen Humor und seine Anwendung in verschiedenen Therapieansätzen, wie der provokativen Therapie. Die Ausführungen zeigen die vielseitige Einsetzbarkeit des Lachens im therapeutischen Kontext.
Lachen als Beitrag zur Humantherapie: Dieses Kapitel erörtert die Anwendung des Lachens in verschiedenen therapeutischen Prozessen und analysiert seine Bedeutung im Kontext der Affiliationstheorie. Es wird deutlich gemacht, wie Lachen zu einem verbesserten Therapieerfolg beitragen kann.
Lachyoga - Lachen und Yoga: Dieses Kapitel beschreibt die Entstehung, Praxis und Anwendbarkeit von Lachyoga, und legt dar wie Lachyoga mit dem Konzept des Intentionalen Lachens zusammenhängt. Es werden sowohl die Techniken des Lachyoga als auch seine therapeutische Bedeutung erörtert.
Integrative Therapie: Dieses Kapitel gibt eine Einführung in die Integrative Therapie (IT) und deren grundlegende Prinzipien. Es werden die vier Wege der Heilung und Förderung, die Relationalität und Ko-respondenz und die Entwicklungstheoretischen und Persönlichkeitstheoretischen Grundannahmen der IT erläutert.
Schlüsselwörter
Lachen, Anthropologie, Integrative Therapie, Intentionales Lachen, Gelotologie, Lachforschung, Humor, Psychotherapie, Gesundheit, Heilung, Affiliationstheorie, Lachyoga, Mimik, Emotionen, Spiel, Evolution.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Intentionales Lachen in der Integrativen Therapie"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Lachen als anthropologische Konstante und sein Potential im Kontext der Integrativen Therapie. Der Fokus liegt auf dem Konzept des Intentionalen Lachens und seiner Anwendbarkeit in der therapeutischen Praxis.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Aspekte des Lachens, darunter anthropologische Aspekte, physiologische und psychologische Wirkungen, Lachtheorien, Intentionales Lachen als therapeutisches Werkzeug und die Integration des Intentionalen Lachens in die Integrative Therapie. Es werden etymologische, sprachliche und evolutionsbiologische Perspektiven einbezogen, sowie die Gelotologie und die Rolle des Lachens in verschiedenen Therapieansätzen (z.B. Psychotherapie, Lachyoga).
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zur Annäherung an das Lachen (Etymologie, Definitionen, Funktionen, Abgrenzungen zu ähnlichen Phänomenen), zur Evolution des Lachens, zu Lachtheorien, zur Anthropologie des Lachens (einschließlich der "dunklen Seiten"), zur Gelotologie, zum Lachen in der Psychotherapie, zum Lachen in der Humantherapie, zu Lachyoga, zur Integrativen Therapie und schließlich zur Theorie und Praxis des Intentionalen Lachens im Rahmen der Integrativen Therapie. Einleitende und abschließende Kapitel runden die Arbeit ab.
Was ist "Intentionales Lachen"?
Intentionales Lachen ist ein Konzept, das in dieser Arbeit im Detail untersucht wird. Es wird im Kontext von Lachyoga und der Integrativen Therapie betrachtet und beschreibt das bewusste und gezielte Auslösen von Lachen zu therapeutischen Zwecken. Die Arbeit untersucht seine Anwendung in verschiedenen therapeutischen Modalitäten.
Welche Lachtheorien werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert verschiedene Lachtheorien, darunter die Überlegenheitstheorie, die Inkongruenztheorie und energetische Lachtheorien. Diese werden kritisch gewürdigt und auf ihre Relevanz für das Verständnis und die Anwendung des Intentionalen Lachens untersucht.
Wie wird das Intentionale Lachen in der Integrativen Therapie integriert?
Die Arbeit untersucht die Integration des Intentionalen Lachens in die Integrative Therapie (IT) anhand verschiedener Modalitäten (übungszentriert-funktional, erlebnisorientiert-stimulierend, aufdeckend-konfliktzentriert). Es wird die Kompatibilität des Intentionalen Lachens mit den Grundannahmen der IT geprüft und die Anwendung in tragfähigen sozialen Netzwerken betrachtet.
Welche praktischen Anwendungen werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt praktische Anwendungen des Intentionalen Lachens, insbesondere im Zusammenhang mit Lachyoga und seinen therapeutischen Möglichkeiten. Es werden Techniken wie Lächelmeditation und die Nutzung positiver Bilder erwähnt.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, das Konzept des Intentionalen Lachens zu beleuchten und seine Anwendbarkeit in der therapeutischen Praxis zu evaluieren. Sie untersucht das Potential des Lachens als therapeutisches Instrument im Kontext der Integrativen Therapie.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Lachen, Anthropologie, Integrative Therapie, Intentionales Lachen, Gelotologie, Lachforschung, Humor, Psychotherapie, Gesundheit, Heilung, Affiliationstheorie, Lachyoga, Mimik, Emotionen, Spiel, Evolution.
- Citation du texte
- Peter Cubasch (Auteur), 2009, Lachen - Ein anthropologische Konstante als Konzept des Intentionalen Lachens im Kontext der Integrativen Therapie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/163807