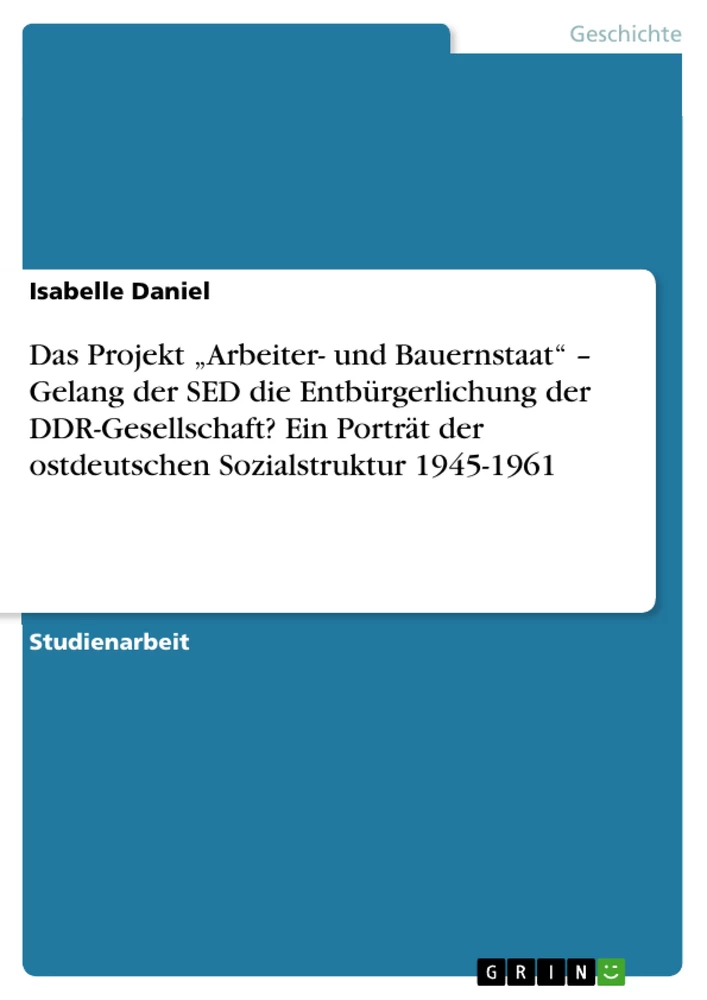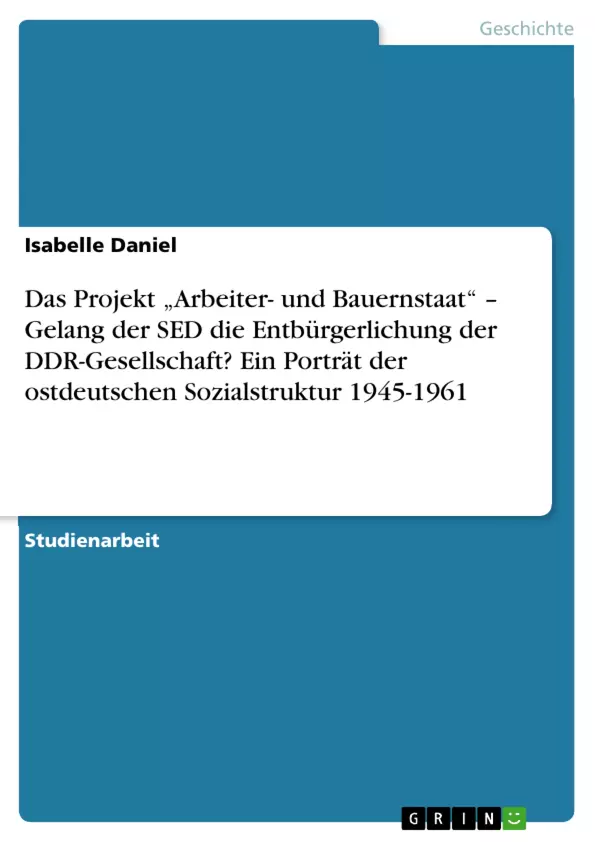Weil er gleichermaßen an die Teilung wie an die Wiedervereinigung einer Gesellschaft erinnern will, ersetzt der 3. Oktober seit 1990 den 17. Juni als deutschen Nationalfeiertag. Tatsächlich reichen die langfristigen Folgen der Teilung weit über den Niedergang der DDR hinaus. Bezeichnend genug ist, dass auch 20 Jahre nach dem Mauerfall ein Wahlkampf um das Amt des Bundespräsidenten ausreichend Anlass bietet, um über die Zulässigkeit oder Unzulässigkeit des Begriffs „Unrechtsstaat“ im Zusammenhang mit der DDR zu debattieren.
Wie totalitär war die DDR demzufolge? Durchwanderte der Einfluss von SED und Stasi alle Bereiche des Lebens? Eine Einstufung als totalitär setzt die Erfüllung dieses Kriteriums voraus. Dass die SED totalitäre Ansprüche hatte, ist unumstritten. Sie machte keinen Hehl daraus, dass ihr angepeiltes Ziel die Entbürgerlichung der Gesellschaft war, die nach marxistischer Logik determiniert aus dem Klassenkampf resultieren würde. Während in der Bundesrepublik ein Generationenwandel offensichtlich mit einem Wertewandel einherging, der seine Höhepunkte in den siebziger Jahren feierte, setzte die SED alles daran, einen Mentalitätswandel nach kommunistischen Standards durchzusetzen. Die vorliegende Arbeit will untersuchen, welcher Instrumente sich die Einheitspartei dabei behalf, und ob und inwiefern es der SED gelungen ist, Lebensstile und Mentalitäten in der ostdeutschen Gesellschaft zu steuern. Weil sich der gewünschte Wertewandel „von oben“ auf das Bürgertum spezifizierte, legt auch die vorliegende Arbeit ihr Hauptaugenmerk auf diese Gesellschaftsschicht. Anhand der Darstellung der Situation des Bürgertums in der DDR soll präsentiert werden, wie weit die Suggestion im SED-Staat reichte. Analysiert werden soll auch die Frage nach den Möglichkeiten des Widerstands gegen die oktroyierte Ideologie. Aus diesem Grund widmet sich die Arbeit in einem Kapitel dem Arbeiteraufstand am 17. Juni 1953 und untersucht die Frage nach bürgerlicher Beteiligung an dem Protest. Als empirische Grundlage für die Analyse dienen die Kernmilieus der ostdeutschen Bürgerlichkeit, nämlich die bürgerlichen Parteien sowie die protestantische Kirche. Dem voran geht eine knappe theoretische Einordnung der Bourgoisie in die soziologische Einteilung von sozialen Klassen und Schichten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Die Situation des Bürgertums nach 1945
- Das Bürgertum im sozialen Bewusstsein
- Charakteristika des Bürgertums
- Das Prinzip „Arbeiter- und Bauernstaat“ und die Lage der Bürgerlichen in der SBZ und der frühen DDR
- Die bürgerlichen Parteien
- Die DDR-CDU
- Die LDP
- Die Blockpolitik
- Die bürgerlichen Parteien
- Der 17. Juni 1953 und die Träger des Volksaufstands
- Die Akteure am 17. Juni 1953
- Wertewandel von unten?
- Die DDR als Nischengesellschaft: Bürgerliches Kernmilieu protestantische Kirche
- Die Situation des Bürgertums nach 1945
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, mit welchen Mitteln die SED versuchte, Lebensstile und Mentalitäten in der ostdeutschen Gesellschaft zu beeinflussen, und ob ihr dies im Hinblick auf die Entbürgerlichung der Gesellschaft gelang. Der Fokus liegt dabei auf dem Bürgertum als Zielgruppe der SED-Politik. Analysiert werden die Situation des Bürgertums in der DDR, der Widerstand gegen die Ideologie und die Rolle des 17. Juni 1953.
- Die Situation des Bürgertums in der unmittelbaren Nachkriegszeit und seine Wahrnehmung in der Gesellschaft.
- Die Strategien der SED zur Entbürgerlichung und deren Auswirkungen auf das Bürgertum.
- Die Rolle bürgerlicher Parteien (CDU, LDP) und der protestantischen Kirche in der DDR.
- Der 17. Juni 1953 als Ausdruck des Widerstands und die Beteiligung des Bürgertums.
- Die Frage nach dem Erfolg der SED-Politik hinsichtlich der Veränderung von Lebensstilen und Mentalitäten.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und erläutert die Forschungsfrage nach dem Erfolg der SED-Politik zur Entbürgerlichung der DDR-Gesellschaft. Sie betont die langfristigen Folgen der deutschen Teilung und die anhaltende Debatte um den Begriff „Unrechtsstaat“ im Kontext der DDR. Die Arbeit fokussiert auf das Bürgertum als zentrale Zielgruppe der SED-Politik und untersucht die Instrumente der Einheitspartei sowie Möglichkeiten des Widerstands.
Die Situation des Bürgertums nach 1945: Dieses Kapitel analysiert die Wahrnehmung des Bürgertums nach 1945 als scheinbar „tote Schicht“, unter Berücksichtigung unterschiedlicher Perspektiven. Es beleuchtet die Krise des Bürgertums nach dem Zweiten Weltkrieg, die auf verloren gegangenes Vertrauen und existenzielle Probleme zurückgeführt wird. Gleichzeitig werden auch Gegenpositionen diskutiert, die von einer Renaissance des Bildungsbürgertums und einem Überleben bürgerlicher Werte ausgehen. Die unterschiedlichen Interpretationen der historischen Quellen zeigen die Komplexität der Thematik.
Das Prinzip „Arbeiter- und Bauernstaat“ und die Lage der Bürgerlichen in der SBZ und der frühen DDR: Dieses Kapitel untersucht die Auswirkungen des Prinzips „Arbeiter- und Bauernstaat“ auf das Bürgertum in der SBZ und der frühen DDR. Es analysiert die Rolle der bürgerlichen Parteien (CDU und LDP) innerhalb der Blockpolitik und beleuchtet deren schwierige Position im kommunistischen System. Die Herausforderungen, vor denen die bürgerlichen Parteien und ihre Mitglieder standen und die Strategien, die sie zur Bewältigung dieser Herausforderungen einsetzten werden hier detailliert untersucht.
Der 17. Juni 1953 und die Träger des Volksaufstands: Das Kapitel konzentriert sich auf den Arbeiteraufstand vom 17. Juni 1953 und analysiert die beteiligten Akteure sowie die Frage nach dem Wertewandel "von unten". Es untersucht, inwieweit sich das Bürgertum an dem Aufstand beteiligte und welche Rolle die Proteste im Kontext des Verhältnisses zwischen SED und Bevölkerung spielte. Die Analyse der Ereignisse vom 17. Juni beleuchtet wichtige Aspekte des Widerstands gegen die SED-Politik.
Die DDR als Nischengesellschaft: Bürgerliches Kernmilieu protestantische Kirche: Dieses Kapitel behandelt die protestantische Kirche als ein wichtiges Kernmilieu der ostdeutschen Bürgerlichkeit. Es untersucht ihre Rolle als Ort des Widerstands und der Bewahrung bürgerlicher Werte in einer kommunistischen Gesellschaft. Die Analyse der Rolle der Kirche verdeutlicht die Bedeutung von Religion und Glaube im Kontext des gesellschaftlichen Wandels und des Konflikts zwischen Staat und Bevölkerung.
Schlüsselwörter
Entbürgerlichung, DDR, SED, Bürgertum, Arbeiter- und Bauernstaat, Blockpolitik, 17. Juni 1953, protestantische Kirche, Widerstand, Mentalitäten, Lebensstile, Sozialstruktur.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: "Entbürgerlichung in der DDR?"
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht, wie erfolgreich die SED in der DDR darin war, Lebensstile und Mentalitäten der Bevölkerung, insbesondere des Bürgertums, zu beeinflussen und zu verändern (Entbürgerlichung). Sie konzentriert sich auf die Strategien der SED, den Widerstand dagegen und die Rolle des 17. Juni 1953.
Welche Aspekte des Bürgertums werden behandelt?
Die Arbeit analysiert die Situation des Bürgertums in der unmittelbaren Nachkriegszeit, seine Wahrnehmung in der Gesellschaft, die SED-Strategien zur Entbürgerlichung und deren Auswirkungen. Es werden die Rolle bürgerlicher Parteien (CDU, LDP) und der protestantischen Kirche sowie die Beteiligung des Bürgertums am Aufstand vom 17. Juni 1953 untersucht.
Welche Rolle spielt der 17. Juni 1953 in der Arbeit?
Der 17. Juni 1953 wird als Ausdruck des Widerstands gegen die SED-Politik analysiert. Die Arbeit untersucht die beteiligten Akteure und die Frage, inwieweit der Aufstand einen Wertewandel von unten darstellte und wie stark das Bürgertum daran beteiligt war.
Welche Bedeutung hat die protestantische Kirche in diesem Kontext?
Die Arbeit betrachtet die protestantische Kirche als wichtiges Kernmilieu der ostdeutschen Bürgerlichkeit, das als Ort des Widerstands und der Bewahrung bürgerlicher Werte in der DDR fungierte. Ihre Rolle wird im Kontext des gesellschaftlichen Wandels und des Konflikts zwischen Staat und Bevölkerung analysiert.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Arbeit basiert auf einer Analyse unterschiedlicher historischer Quellen, die verschiedene Interpretationen der Situation des Bürgertums in der DDR zulassen und die Komplexität der Thematik verdeutlichen.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit untersucht die langfristigen Folgen der deutschen Teilung und die anhaltende Debatte um den Begriff „Unrechtsstaat“ im Kontext der DDR. Sie analysiert die Instrumente der Einheitspartei und die Möglichkeiten des Widerstands gegen die SED-Politik.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Entbürgerlichung, DDR, SED, Bürgertum, Arbeiter- und Bauernstaat, Blockpolitik, 17. Juni 1953, protestantische Kirche, Widerstand, Mentalitäten, Lebensstile, Sozialstruktur.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Hauptteil mit Kapiteln zur Situation des Bürgertums nach 1945, dem Prinzip „Arbeiter- und Bauernstaat“, dem 17. Juni 1953 und der Rolle der protestantischen Kirche, sowie eine Schlussbetrachtung.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Forschungsfrage und den Fokus auf das Bürgertum als Zielgruppe der SED-Politik erläutert. Danach folgen Kapitel, die die einzelnen Aspekte der Thematik detailliert behandeln. Die Arbeit endet mit einer Schlussbetrachtung.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für alle, die sich für die Geschichte der DDR, die SED-Politik, den Widerstand gegen das Regime und die Sozialgeschichte des Bürgertums interessieren. Sie bietet eine umfassende Analyse der Entbürgerlichungsprozesse in der DDR.
- Quote paper
- Isabelle Daniel (Author), 2009, Das Projekt „Arbeiter- und Bauernstaat“ – Gelang der SED die Entbürgerlichung der DDR-Gesellschaft? Ein Porträt der ostdeutschen Sozialstruktur 1945-1961, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/164486