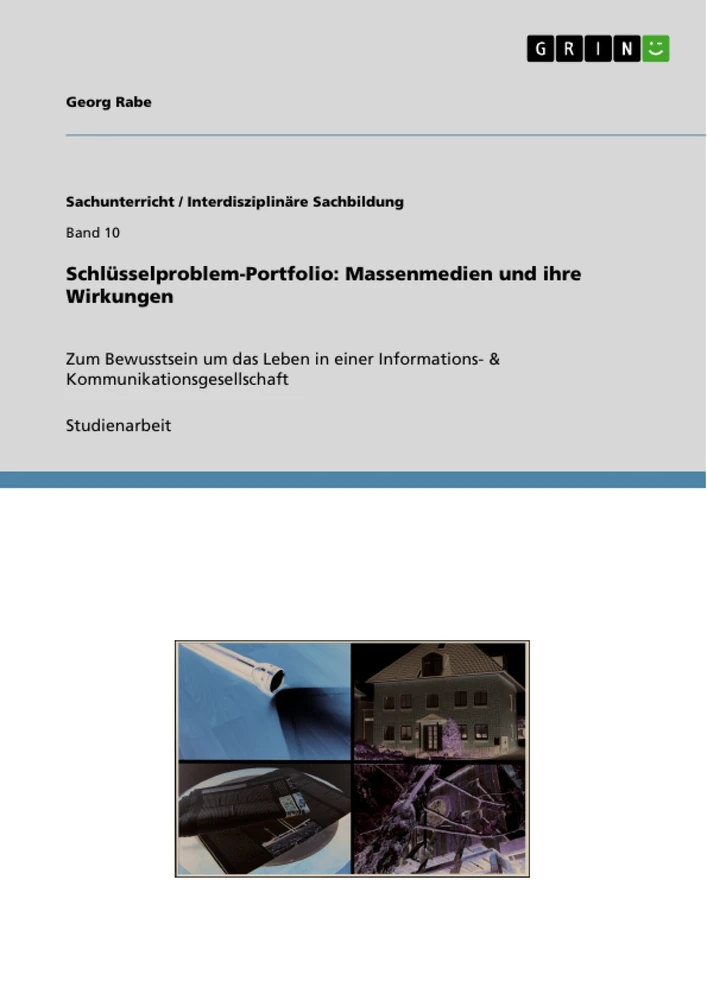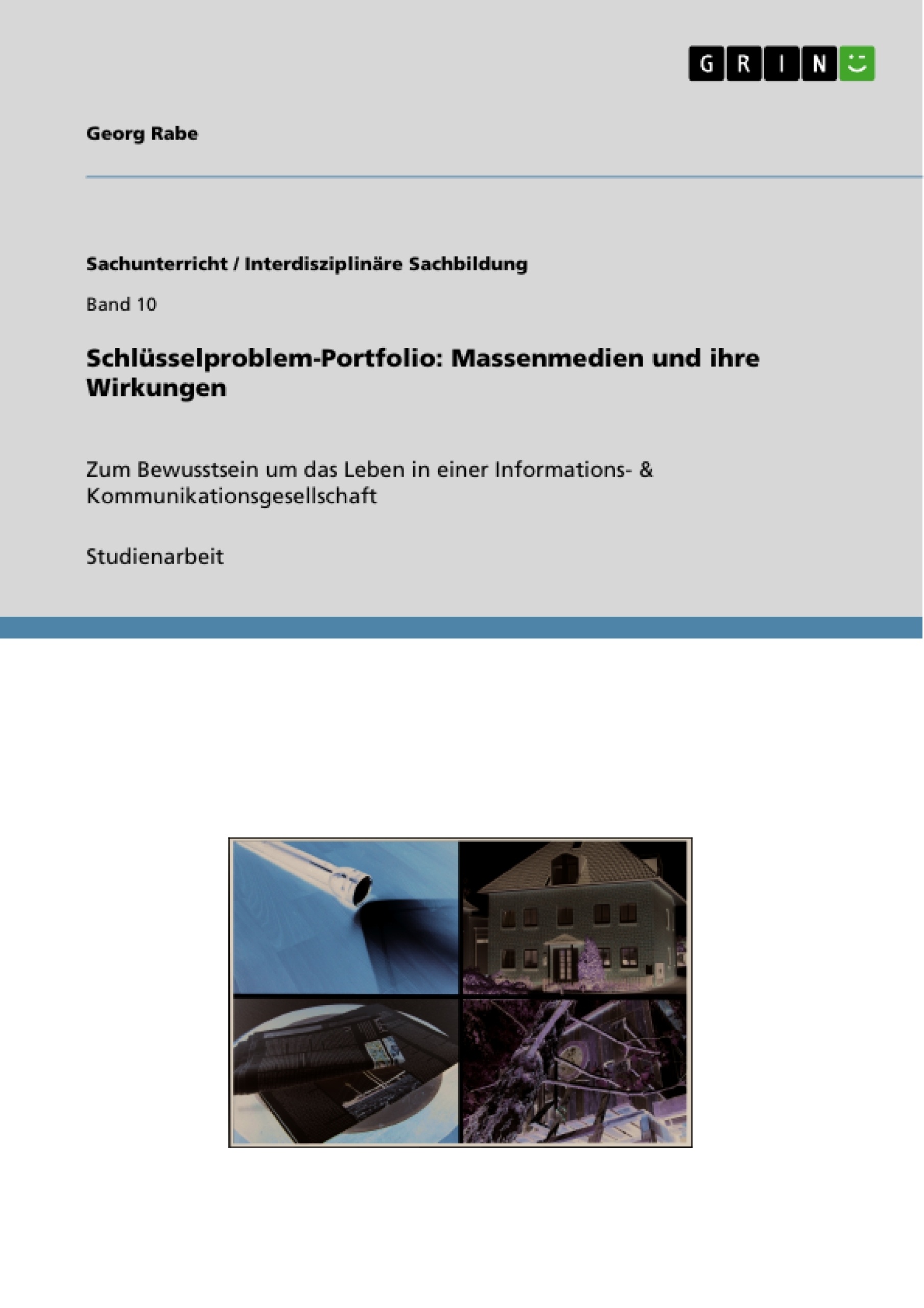aus der Einleitung:
Ein sogenanntes ästhetisches Objekt muss laut Fremdwörterbuch 'stilvoll-schön' bzw. 'geschmackvoll' sein. Die Bild-Zeitung ist jedoch weder das eine, noch das andere. Trotzdem drängte sie sich mir in dem Café förmlich auf, was vermutlich genau daran liegt, dass sie dieser Definition nicht entspricht. Denn durch das unfreiwillige Lesen der Überschriften wurde mir wieder schlagartig bewusst, dass die Bild-Zeitung m. E. weniger auf fundierte und informierende Inhalte setzt, als dass sie durch wohl selektierte und meist überspitzte Themen versucht, die Menschen zu verunsichern und aufzustacheln.
An diesem Punkt schließt sich wiederum der Kreis bezüglich der Ästhetik des Objekts, denn diese Ausgabe der Bild-Zeitung sprach mich nicht nur an, wie es in der Definition des Wortes ästhetisch im Fremdwörterduden steht, die Beschäftigung mit den provokanten Inhalten und dem unfreiwilligen Kopfschütteln darüber verselbständigte sich genau genommen.
Mein Ärger über die überzogene Art der Berichterstattung zeigte mir zwar, dass ich, als erwachsener Mensch, in der Lage war, diese Methode des Auflage-Machens zu durchschauen, die Überschriften und Artikel somit nicht ernst zu nehmen und mir deswegen meine Meinung durch andere Informationen und Erfahrungen bilden würde. Doch was ist mit der Vielzahl an Kindern, die ebenfalls bei diesem Bäcker kaufen und dort, oder in unzähligen anderen Geschäften, ohne Zutun diese Artikel lesen?
Die meisten dieser Kinder haben (noch) nicht das (Welt-)Wissen, mit dem ich dieser Zeitung begegne und haben ebenso wenig die Möglichkeit, sich vor diesem negativen Einfluss zu wehren.
Diese Gedanken, die ich einem ungeplanten Bäckereibesuch verdanke, haben mir den Anstoß gegeben, mich mit dem Schlüsselproblem „Massenmedien und ihre Wirkungen“ auseinanderzusetzen und dabei besonders auf die Fähigkeiten einzugehen, die nötig sind, um in der heutigen Informations- & Kommunikationsgesellschaft kompetent und weitestgehend selbst bestimmt leben zu können...
Inhaltsverzeichnis
- 1. Mein Erlebnis mit dem ästhetischen Objekt
- 2. Sachanalyse
- 2.1. Was ist ein Schlüsselproblem?
- 2.2. Was sind Massenmedien?
- 2.3. Das Massenmedium Fernsehen
- 2.3.1. Die geschichtliche Entwicklung des Fernsehens in der BRD
- 2.3.2. Die aktuelle Verbreitung von Fernsehgeräten in der BRD
- 3. Didaktische Analyse
- 4. Methodischer Vorschlag - „Das Grusel-Projekt”
- 4.1. Projektverlauf
- 4.2. Lernziele
- 5. Literatur- & Quellenverzeichnis
- 6. Abbildungsverzeichnis
- 7. Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Portfolio untersucht das Schlüsselproblem „Massenmedien und ihre Wirkungen" im Kontext der modernen Informations- & Kommunikationsgesellschaft. Es zielt darauf ab, die Fähigkeiten zu beleuchten, die notwendig sind, um in dieser komplexen Umgebung kompetent und selbstbestimmt zu leben.
- Die Relevanz von Massenmedien als zentrales Schlüsselproblem in der heutigen Gesellschaft.
- Die Analyse der Wirkungsmechanismen von Massenmedien, insbesondere des Fernsehens.
- Die didaktische Auseinandersetzung mit dem Thema und die Entwicklung eines methodischen Vorschlags für den Sachunterricht.
- Die Bedeutung von Medienkompetenz für ein selbstbestimmtes Leben in der Informationsgesellschaft.
- Die kritische Betrachtung der Rolle von Massenmedien in der Bildung und der Gestaltung von gesellschaftlichen Einstellungen.
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 beschreibt das ästhetische Objekt, das die Auseinandersetzung mit dem Schlüsselproblem ausgelöst hat: die Bild-Zeitung. Der Autor analysiert die provokative Berichterstattung und deren potenziellen Einfluss auf Kinder und Jugendliche.
Kapitel 2 definiert den Schlüsselproblemansatz nach Wolfgang Klafki und stellt die Relevanz von Massenmedien als Schlüsselproblem heraus. Das Kapitel beleuchtet die Definition und die Entwicklung des Massenmediums Fernsehen.
Kapitel 3 bietet eine didaktische Analyse des Schlüsselproblems und untersucht die Bedeutung von Medienkompetenz im Bildungskontext.
Kapitel 4 präsentiert einen methodischen Vorschlag für ein Unterrichtsprojekt, das sich mit der Thematik des Grusels im Fernsehen auseinandersetzt.
Schlüsselwörter
Schlüsselproblemansatz, Massenmedien, Fernsehen, Informationsgesellschaft, Medienkompetenz, Didaktik, Sachunterricht, Grusel, Bildung, Gesellschaftliche Einstellungen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein „Schlüsselproblem“ nach Wolfgang Klafki?
Es bezeichnet zentrale gesellschaftliche Herausforderungen (wie Massenmedien, Umwelt oder Frieden), mit denen sich Bildungsprozesse auseinandersetzen müssen.
Warum wird die „Bild-Zeitung“ als Beispiel herangezogen?
Die Arbeit analysiert die provokante Berichterstattung der Bild-Zeitung als Medium, das weniger informiert als vielmehr verunsichert und aufstachelt.
Welche Wirkung haben Massenmedien auf Kinder?
Kinder verfügen oft noch nicht über das notwendige Weltwissen, um manipulative Medieninhalte zu durchschauen, und benötigen daher gezielte Förderung der Medienkompetenz.
Was ist das „Grusel-Projekt“?
Ein methodischer Vorschlag für den Sachunterricht, der sich mit der Darstellung von Angst und Grusel im Fernsehen beschäftigt, um die Medienkritikfähigkeit zu stärken.
Wie hat sich das Fernsehen in Deutschland entwickelt?
Die Arbeit beleuchtet die geschichtliche Entwicklung des Fernsehens in der BRD und dessen heutige Rolle als eines der einflussreichsten Massenmedien.
- Quote paper
- M.Ed. Georg Rabe (Author), 2006, Schlüsselproblem-Portfolio: Massenmedien und ihre Wirkungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/165243