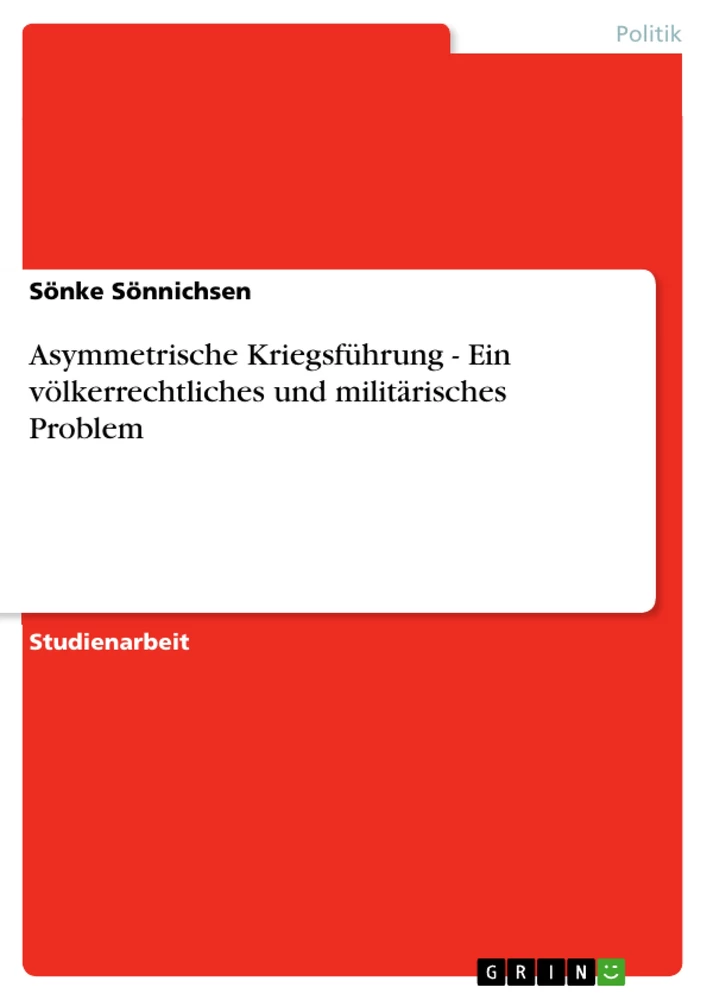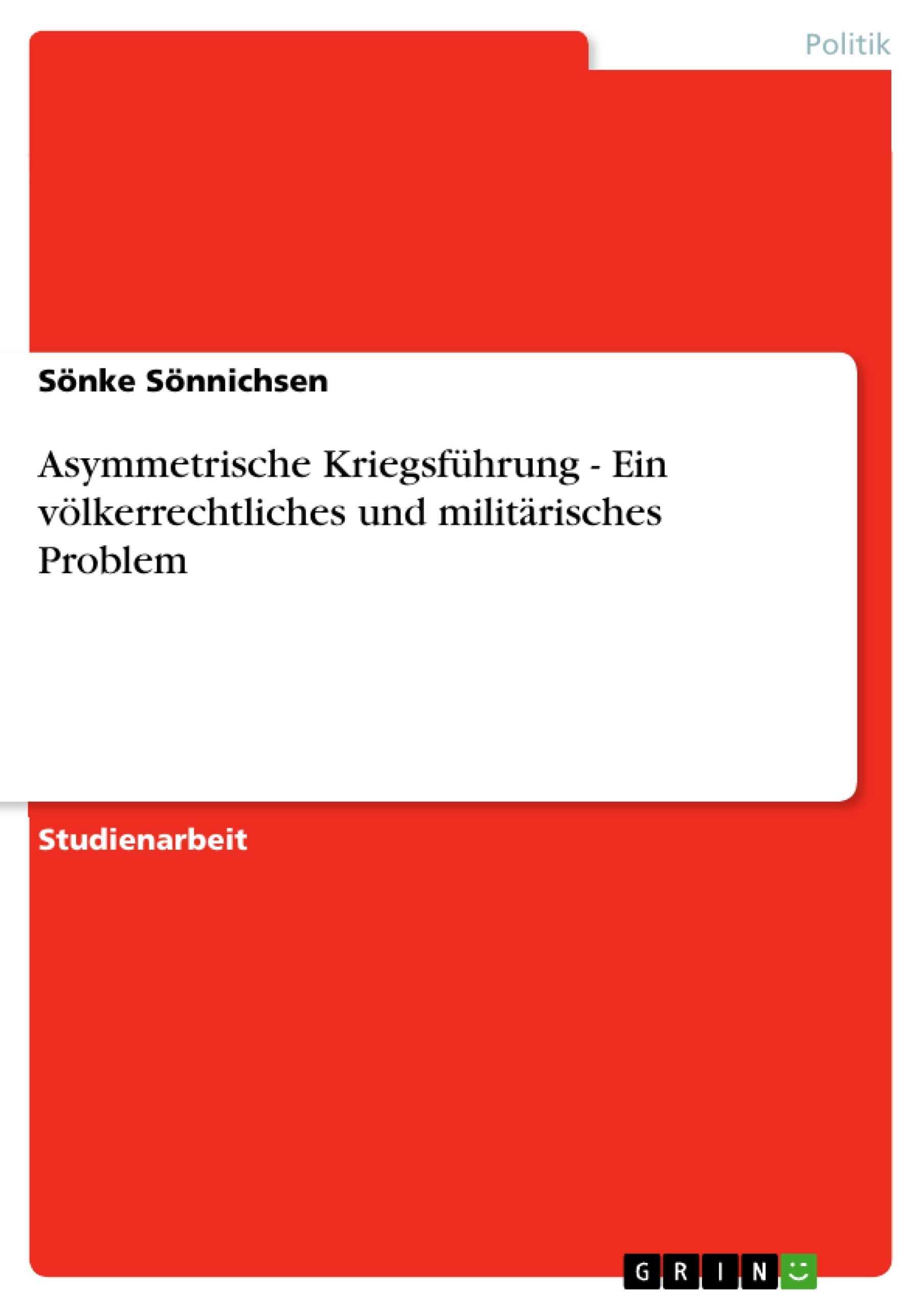Seit den Anschlägen des 11. September 2001 rückte die Bedrohung durch den internationalen Terrorismus stark in den Fokus moderner Medien. Martin van Creveld zeigt eine Entwicklung seit Ende des Kalten Krieges zu „low intensity conflicts“ und zu kleinen Kriegen mit nicht-symmetrischer Ausprägung auf. Auch Herfried Münkler spricht von völlig neuen Kriegen, die durch eine asymmetrische Bedrohung gekennzeichnet sind. Die internationale Staatengemeinschaft und somit auch die Bundesrepublik Deutschland sahen sich mit einer neuen Bedrohungslage konfrontiert. „Deutschland wird auch am Hindukusch verteidigt“, so fasste der damalige Verteidigungsminister Peter Struck die kurz darauf erlassenen Verteidigungspolitischen Richtlinien zusammen. Die Bundeswehr trägt seither in der Operation Enduring Freedom (OEF) und der International Security Assistence Force (ISAF) eine große Verantwortung und Belastung im Kampf gegen den internationalen Terrorismus. Doch welche rechtlichen und militärischen Probleme resultieren für die modernen demokratischen Staaten und ihre Streitkräfte auf dieser asymmetrischen Bedrohungslage?
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung: Eine neue sicherheitspolitische Herausforderung
- 2 Problemfelder asymmetrischer Konflikte
- 2.1 Rechtliche Problematiken
- 2.2 Militärische Problematiken
- 3 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Thematik des asymmetrischen Konflikts, einer neuen sicherheitspolitischen Herausforderung, die seit den Anschlägen des 11. September 2001 zunehmend an Bedeutung gewinnt. Sie untersucht die rechtlichen und militärischen Problemfelder, die sich aus dieser Form der Konfrontation ergeben, und analysiert die Herausforderungen für moderne demokratische Staaten und ihre Streitkräfte.
- Rechtliche Problematiken im asymmetrischen Konflikt
- Militärische Herausforderungen durch asymmetrische Konflikte
- Die Rolle der Bundeswehr im Kampf gegen den internationalen Terrorismus
- Definition und Charakteristika asymmetrischer Konflikte
- Die Folgen asymmetrischer Konflikte für die internationale Staatengemeinschaft
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Eine neue sicherheitspolitische Herausforderung
Die Einleitung beleuchtet die Entwicklung des asymmetrischen Konflikts als neue sicherheitspolitische Herausforderung, die durch den internationalen Terrorismus und „low intensity conflicts“ geprägt ist. Sie beleuchtet die Reaktion der internationalen Staatengemeinschaft auf diese Bedrohung und die Rolle der Bundeswehr im Kampf gegen den Terrorismus. Zudem werden zentrale Begriffe wie Krieg und Konflikt definiert und die Unterscheidung zwischen Kombattanten, Nichtkombattanten und Zivilisten im Kontext des humanitären Völkerrechts erläutert.
2 Problemfelder asymmetrischer Konflikte
Dieses Kapitel befasst sich mit den rechtlichen und militärischen Problemfeldern, die sich aus asymmetrischen Konflikten ergeben. Es analysiert die Herausforderungen für die Anwendung des humanitären Völkerrechts in Situationen, in denen die Konfliktparteien über unterschiedliche Ressourcen und Mittel verfügen. Zudem wird die Bedeutung der Terrorismusbekämpfung und die schwierige Abgrenzung zwischen legitimer Verteidigung und Rechtsverletzungen im Kontext von asymmetrischen Konflikten beleuchtet.
Schlüsselwörter
Asymmetrischer Konflikt, internationaler Terrorismus, humanitäres Völkerrecht, „low intensity conflicts“, Streitkräfte, Bundeswehr, Operation Enduring Freedom (OEF), International Security Assistence Force (ISAF), Kombattanten, Nichtkombattanten, Zivilisten, Rechtsproblematiken, militärische Problematiken, Terrorismusbekämpfung, Sicherheitspolitik.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter asymmetrischer Kriegsführung?
Es handelt sich um Konflikte, in denen sich ungleiche Gegner gegenüberstehen, wie z. B. staatliche Armeen und nicht-staatliche terroristische Gruppen, die unterschiedliche Mittel und Taktiken anwenden.
Welche rechtlichen Probleme ergeben sich in asymmetrischen Konflikten?
Die größte Herausforderung ist die Anwendung des humanitären Völkerrechts, insbesondere die schwierige Unterscheidung zwischen Kombattanten, Nichtkombattanten und Zivilisten.
Welche Rolle spielt die Bundeswehr in diesem Kontext?
Die Bundeswehr ist durch Einsätze wie OEF und ISAF direkt am Kampf gegen den internationalen Terrorismus beteiligt und muss sich den Herausforderungen asymmetrischer Bedrohungen stellen.
Was sind „low intensity conflicts“?
Dies sind Konflikte geringerer Intensität, die oft über lange Zeiträume andauern und nicht die Form eines klassischen zwischenstaatlichen Krieges annehmen.
Was bedeutet das Zitat „Deutschland wird auch am Hindukusch verteidigt“?
Mit dieser Aussage fasste der ehemalige Verteidigungsminister Peter Struck zusammen, dass die Sicherheit Deutschlands heute auch durch Einsätze in fernen Regionen wie Afghanistan gewährleistet werden muss.
Wie unterscheiden sich asymmetrische von symmetrischen Kriegen?
In symmetrischen Kriegen kämpfen ähnliche Akteure (Staaten) mit ähnlichen Waffen nach festen Regeln; in asymmetrischen Kriegen werden diese Regeln oft gezielt durch Guerilla- oder Terrortaktiken unterlaufen.
- Arbeit zitieren
- Sönke Sönnichsen (Autor:in), 2007, Asymmetrische Kriegsführung - Ein völkerrechtliches und militärisches Problem, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/165352