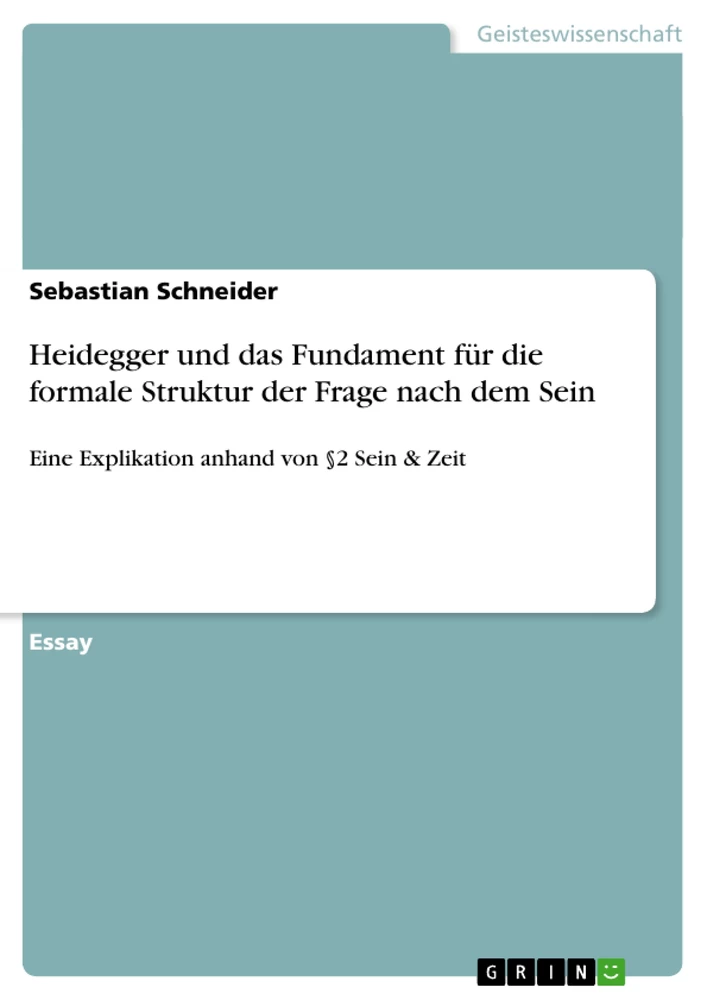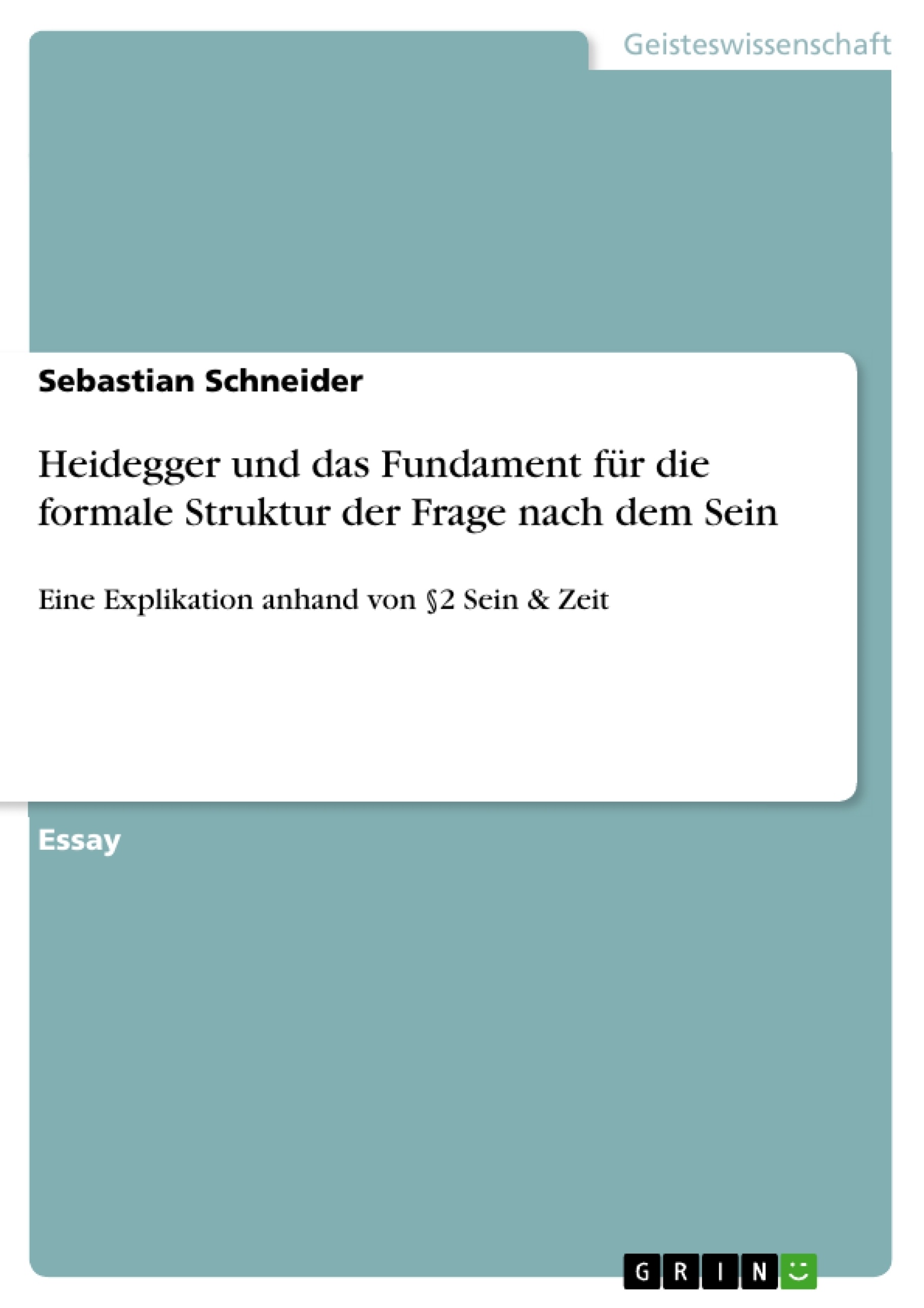Martin Heidegger, einer der großen drei Philosophen des 20. Jahrhunderts, revolutionierte durch seine Dekonstruktion der "alten" Metaphysik das gesamte Gebiet der Ontologie. Er stellte die Frage nach dem Sinn von Sein in einer völlig neuen Gestalt und hatte somit starken, ja vielmehr konstitutiven Einfluss auf die Philosophen des 20. Jahrhunderts (Satre, Camus, Hanna Arendt, Hans Jonas um nur wenige zu nennen). Doch wie stellt man eine solche Frage? Heidegger versucht in seinem §2 seiner Sein & Zeit die formalen Strukturen einer Frage freizulegen um anschließend jene Formalia in Bezug auf eine Frage nach dem Sinn von Sein zu beantworten. Diese Seminararbeit stellt die genannten Formalia zur Schau.
Inhaltsverzeichnis
- §2 Die formale Struktur der Frage nach dem Sein
- Das Menonsche Paradoxon
- Die Wiedererinnerungslehre Platons
- Heideggers Ansatz und seine Nähe zu Aristoteles und Kant
- Die drei Strukturmomente der Frage
- Das Gefragte
- Das Erfragte
- Das Befragte
- Der Fragende
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der zweite Paragraph von Heideggers "Sein und Zeit" legt das Fundament für die formale Struktur der Frage nach dem Sein. Dieser Paragraph ergründet die Strukturmomente der Frage selbst, um den konstitutiven Charakter der Frage zu analysieren. Im Zentrum steht die Frage nach dem Wesen des Fragens, und die Überwindung des menonischen Paradoxons, das die Möglichkeit des Fragens infrage stellt.
- Die Frage nach dem Sein als konstitutives Element des Denkens
- Die strukturellen Momente der Frage: Gefragtes, Erfragtes, Befragtes
- Heideggers Auseinandersetzung mit Platon, Aristoteles und Kant
- Die Überwindung des menonischen Paradoxons durch die Analyse der Frage
- Die Bedeutung der Sprache und des sprachlichen Gebrauchs in der Philosophie
Zusammenfassung der Kapitel
Dieser Paragraph behandelt die Frage nach dem Sein in ihrer formalen Struktur und analysiert das Wesen des Fragens im Allgemeinen. Zuerst wird das menonische Paradoxon beleuchtet, das die Frage stellt, wie man suchen kann, was man nicht kennt. Heidegger unterscheidet sich von Platons Lösung durch die Wiedererinnerungslehre und argumentiert stattdessen für die drei wesentlichen Strukturmomente der Frage: das Gefragte, das Erfragte und das Befragte. Der Paragraph beleuchtet auch die Nähe und Distanz Heideggers zu Aristoteles und Kant, bevor er die einzelnen Strukturmomente der Frage im Detail analysiert.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen des zweiten Paragraphen von "Sein und Zeit" beinhalten die Frage nach dem Sein, das menonische Paradoxon, die Strukturmomente der Frage, die Wiedererinnerungslehre Platons, die Philosophie Aristoteles und Kants und die Bedeutung der Sprache in der Philosophie.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Paragraph 2 von Heideggers 'Sein und Zeit'?
Dieser Paragraph behandelt die formale Struktur der Frage nach dem Sein und analysiert, was es überhaupt bedeutet, eine philosophische Frage zu stellen.
Was ist das Menonsche Paradoxon?
Es ist das Problem, dass man entweder das sucht, was man bereits kennt (dann ist die Suche unnötig), oder das, was man nicht kennt (dann weiß man nicht, wonach man sucht). Heidegger nutzt dies, um die Struktur des Fragens zu erläutern.
Welche drei Strukturmomente der Frage nennt Heidegger?
Heidegger unterscheidet das Gefragte (das Sein selbst), das Befragte (das Seiende, z.B. der Mensch) und das Erfragte (der Sinn von Sein).
Welchen Stellenwert hat der 'Fragende' in Heideggers Analyse?
Der Fragende (das Dasein) ist selbst ein Seiendes, das durch sein Fragen einen besonderen Zugang zur Seinsfrage hat, da es in seinem Sein um dieses Sein selbst geht.
Wie grenzt sich Heidegger von Platon ab?
Während Platon das Wissen um das Sein durch die Wiedererinnerungslehre (Anamnesis) erklärt, setzt Heidegger bei der phänomenologischen Analyse der Struktur des Fragens an.
- Quote paper
- Sebastian Schneider (Author), 2010, Heidegger und das Fundament für die formale Struktur der Frage nach dem Sein, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/165685